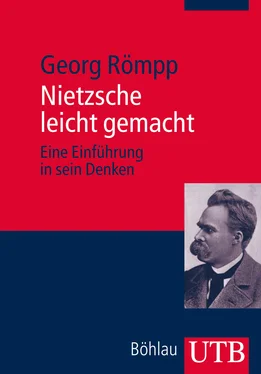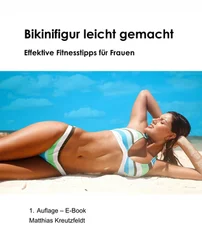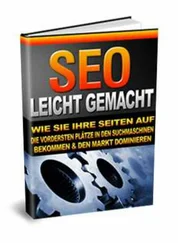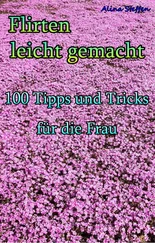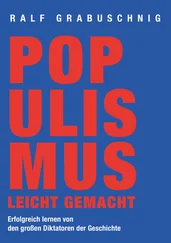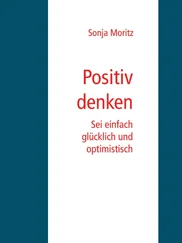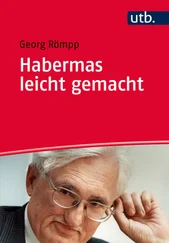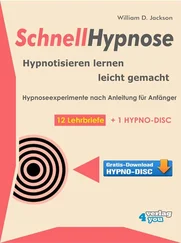Georg Römpp - Nietzsche leicht gemacht
Здесь есть возможность читать онлайн «Georg Römpp - Nietzsche leicht gemacht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Nietzsche leicht gemacht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Nietzsche leicht gemacht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Nietzsche leicht gemacht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Nietzsche leicht gemacht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Nietzsche leicht gemacht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
In einem solchen Zustand lösen sich die Begriffe ebenso auf wie die Dinge. Wir können demnach unter der alleinigen Geltung des dionysischen Prinzips auch nicht mehr von anderen Menschen als Urheber von Handlungen sprechen, d. h. wir können auch keine soziale Welt als eine Struktur von aufeinander bezogenen Handlungen mehr
<���–27|
erkennen. Nietzsche formuliert dies in seinem bisweilen etwas blumigen Tonfall so: „Unter dem Zauber des Dionysischen schließt sich nicht nur der Bund zwischen Mensch und Mensch wieder zusammen: auch die entfremdete, feindliche oder unterjochte Natur feiert wieder ihr Versöhnungsfest mit ihrem verlorenen Sohne, dem Menschen.“ (GT III-1, 25) Hier wird über das ‚Verschwimmen‘ der Unterscheidung zwischen Menschen hinaus auch noch eine ‚Versöhnung‘ zwischen Mensch und Natur angesprochen. Natürlich sollten wir dabei nicht an Natur im Sinne einer zu schützenden Umwelt denken. Gemeint ist die Welt der Objekte, die sich, würde nur das dionysische Prinzip gelten, nicht von den Menschen unterscheiden könnte, ebenso wie sich Menschen in diesem Bezug nicht voneinander differenziert auffassen könnten. Erst das apollinische Prinzip schließt jene Unterscheidung zwischen Mensch und Objektwelt auf, die Kant mithilfe der reinen Verstandesbegriffe (wie etwa Kausalität) gedacht hatte. Ohne die Identifizierung von Objekten und von ihnen unterschiedener Menschen ‚verschwimmt‘ offensichtlich aber auch die Zuordnung von Objekten zu Menschen und damit wird das Erkennen von Veränderungen als Handlungen unmöglich.
Wir hatten eingangs als das zentrale Problem, welches das jetzt thematische Werk stellt, das Verhältnis zwischen einer Reflexion auf das Wissen der Wissenschaft und einer Untersuchung des Ursprungs der Tragödie aus dem Geiste der Musik bezeichnet. Eine erste Antwort können wir nun aus der Charakterisierung des dionysischen Prinzips entnehmen. Nietzsche schreibt hier: „Singend und tanzend äussert sich der Mensch als Mitglied einer höheren Gemeinsamkeit: er hat das Gehen und das Sprechen verlernt und ist auf dem Wege, tanzend in die Lüfte emporzufliegen.“ (GT III-1, 26) Offensichtlich hat nach dieser Formulierung die Auflösung des apollinischen Prinzips der Individuierung, der Begrenzung und des Gestaltbildens etwas mit der Musik in der Form von Singen und Tanzen zu tun. Darin sieht Nietzsche eine Auflösung der Individualität des Menschen und seinen Übergang in eine rein gemeinschaftliche Gestaltung. Für den einzelnen heben sich die Grenzen bis zu einem gewissen Grad auf, und aus der Perspektive von außen ist eine neue Gestalt wahrzunehmen, in der der einzelne nur im aufgelösten Zustand enthalten ist: „Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden.“ (GT III-1, 26) Offenbar ist gerade das Kunstwerk in ganz ausgezeichneter Weise der Ort, an dem der Übergang vom Ungeformten zur Form und damit das Entstehen einer neuen Gestalt geschieht. Dieser Übergang muss schließlich weiterführen bis zu solchen bestimmten Formen, die Gegenstand von Wissenschaft sein können, weil sie in bestimmten Begriffen zum Ausdruck kommen und damit die Grundlage für ein allgemeines und mit dem Bewusstsein von Notwendigkeit auftretendes Wissen darstellen.
<���–28|
1.4 Die philosophische Bedeutung der Tragödie
Welche Bedeutung für Nietzsche die Tragödie (und zuvor die Musik) in diesem Zusammenhang hat, ergibt sich vor allem daraus, dass die Prinzipien des Apollo und des Dionysos alleine nicht bestehen können; sie sind fundamental defizitär, wie Nietzsche in der folgenden zusammenfassenden Formulierung verdeutlicht: das Apollinische und das Dionysische sind „künstlerische Mächte“,
 „die aus der Natur selbst, ohne Vermittlung des menschlichen Künstlers, hervorbrechen, und in denen sich ihre Kunsttriebe zunächst und auf direktem Wege befriedigen: einmal als die Bilderwelt des Traumes, … andererseits als rauschvolle Wirklichkeit, die wiederum des Einzelnen nicht achtet, sondern sogar das Individuum zu vernichten und durch eine mystische Einheitsempfindung zu erlösen sucht.“ (GT III-1, 26)
„die aus der Natur selbst, ohne Vermittlung des menschlichen Künstlers, hervorbrechen, und in denen sich ihre Kunsttriebe zunächst und auf direktem Wege befriedigen: einmal als die Bilderwelt des Traumes, … andererseits als rauschvolle Wirklichkeit, die wiederum des Einzelnen nicht achtet, sondern sogar das Individuum zu vernichten und durch eine mystische Einheitsempfindung zu erlösen sucht.“ (GT III-1, 26)
Nichtsdestoweniger gibt es doch charakteristische Kunstformen für diese künstlerischen Mächte, obwohl sie ohne die Präsenz des jeweils entgegengesetzten Prinzips nicht existieren könnten. Es sind dies die Plastik und das Epische auf der Seite Apollos, während der „dionysische Musiker“ und der „lyrische Genius“ Gestalten auf der dionysischen Seite der Kunst darstellen:
 „Der Plastiker und zugleich der ihm verwandte Epiker ist in das reine Anschauen der Bilder versunken. Der dionysische Musiker ist ohne jedes Bild völlig nur selbst Urschmerz und Urwiederklang desselben. Der lyrische Genius fühlt aus dem mystischen Selbstentäusserungs- und Einheitszustande eine Bilder- und Gleichniswelt hervorwachsen, die eine ganz andere Färbung, Kausalität und Schnelligkeit hat als jene Welt des Plastikers und Epikers.“ (GT III-1, 40)
„Der Plastiker und zugleich der ihm verwandte Epiker ist in das reine Anschauen der Bilder versunken. Der dionysische Musiker ist ohne jedes Bild völlig nur selbst Urschmerz und Urwiederklang desselben. Der lyrische Genius fühlt aus dem mystischen Selbstentäusserungs- und Einheitszustande eine Bilder- und Gleichniswelt hervorwachsen, die eine ganz andere Färbung, Kausalität und Schnelligkeit hat als jene Welt des Plastikers und Epikers.“ (GT III-1, 40)
Die Unterscheidung zwischen dem Epischen und dem Lyrischen bezieht sich in diesem Zusammenhang vor allem auf die Bedeutung des Erzählten – der Geschichte – in der ersteren Form und auf das Entstehen aus der Musik, die für die Kunstform des Lyrischen charakteristisch ist: „Die Melodie gebiert die Dichtung aus sich, und zwar immer wieder von Neuem.“ (GT III-1, 44 –45) Man könnte jedoch auch sagen, dass das Epische in erster Linie die Sprache zur Beschreibung von gestalteten und gebildeten Ereignissen außerhalb der Sprache einsetzt, während in der Lyrik der Ursprung die (Sprach-)Musik selbst ist und der Klang im Vordergrund steht, weshalb sie der Musik weit näher steht – üblicherweise werden Gedichte vertont, nicht aber Romane. Nietzsche beschreibt diesen Vorgang so:
<���–29|
 „Hiermit haben wir das einzig mögliche Verhältnis zwischen Poesie und Musik, Wort und Ton bezeichnet: das Wort, das Bild, der Begriff sucht einen der Musik analogen Ausdruck und erleidet jetzt die Gewalt der Musik an sich. In diesem Sinne dürfen wir in der Sprachgeschichte des griechischen Volkes zwei Hauptströmungen unterscheiden, je nachdem die Sprache die Erscheinungs- und Bilderwelt oder die Musikwelt nachahmte.“ (GT III-1, 45)
„Hiermit haben wir das einzig mögliche Verhältnis zwischen Poesie und Musik, Wort und Ton bezeichnet: das Wort, das Bild, der Begriff sucht einen der Musik analogen Ausdruck und erleidet jetzt die Gewalt der Musik an sich. In diesem Sinne dürfen wir in der Sprachgeschichte des griechischen Volkes zwei Hauptströmungen unterscheiden, je nachdem die Sprache die Erscheinungs- und Bilderwelt oder die Musikwelt nachahmte.“ (GT III-1, 45)
Wir könnten uns dieses Verhältnis von Poesie und Musik so denken: wenn Beethoven ein Musikstück als ‚Pastorale‘ bezeichnet, so wird natürlich nicht beansprucht, mit dieser Musik werde eine ländliche Szene beschrieben, sondern die Beschreibung einer ländlichen Szene wird als eine mögliche verbale Haltung gegenüber dieser Musik vorgeschlagen, die selbst natürlich keineswegs von beschreibendem Charakter ist.
Die hier gemeinte Musik beschreibt also nicht, sondern führt aus sich selbst heraus zu einer – poetischen – Sprache, weshalb „die lyrische Dichtung als die nachahmende Effulguration der Musik in Bildern und Begriffen“ betrachtet werden muss (GT III-1, 46). Der lyrische Künstler deutet also die Musik in Bildern (GT III-1, 47). Aufgrund ihrer Ursprünglichkeit ist es notwendig, der Musik „einen verschiedenen Charakter und Ursprung vor allen anderen Künsten“ zuzuerkennen (GT III-1, 99 –100). Nietzsche schrieb sogar, gerade dies sei die „wichtigste Erkenntnis aller Ästhetik, mit der, in einem ernstern Sinne genommen, die Ästhetik erst beginnt.“ (GT III-1, 100) Deren Frage ließe sich aufgrund dieser Bedeutung der Musik deshalb auch so charakterisieren: „wie verhält sich die Musik zu Bild und Begriff?“ (GT III-1, 100) Offenbar handelt es sich hier um eine Übersetzung dessen in eine kunsttheoretische Frage, was Nietzsche auch als das Verhältnis von Dionysischem und Apollinischem beschreibt. Die Musik ist also nicht einfach irgendeine Kunst, sondern von besonderer Bedeutung, weil sie, obwohl selbst nicht sprachlich, doch eine Sprache aus sich entstehen lässt, die sich ursprünglich nicht aus einer Beziehung auf Zusammenhänge in der Welt rechtfertigt. Nietzsche spricht hier von der „Befähigung der Musik, den Mythus d. h. das bedeutsamste Exempel zu gebären und gerade den tragischen Mythus: den Mythus, der von der dionysischen Erkenntnis in Gleichnissen redet“ (GT III-1, 103)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Nietzsche leicht gemacht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Nietzsche leicht gemacht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Nietzsche leicht gemacht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.