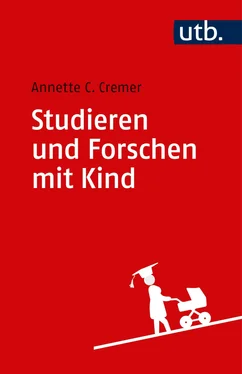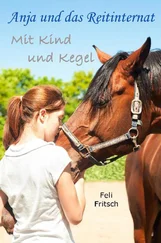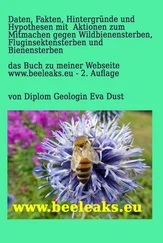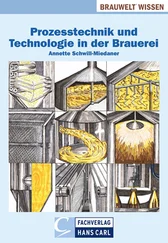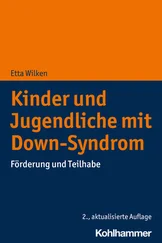Annette Caroline Cremer - Studieren und Forschen mit Kind
Здесь есть возможность читать онлайн «Annette Caroline Cremer - Studieren und Forschen mit Kind» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Studieren und Forschen mit Kind
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Studieren und Forschen mit Kind: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Studieren und Forschen mit Kind»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Studieren und Forschen mit Kind — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Studieren und Forschen mit Kind», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Erkenntnisse der letzten Jahre zeigen, dass Eltern nicht in signifikant höherem Maß zu den Studien- oder Promotionsabbrechern, jedoch überproportional zu Wissenschaftsaussteigern gehören. Das bedeutet, dass die Vereinbarkeit mit dem zunehmenden Druck als schwierig eingeschätzt wird.
Eltern arbeiten meist effizient, sind diszipliniert und zielorientiert. Trotzdem sind für das Gelingen von Studium, Promotion und Forschung mit Kind verschiedene Faktoren ausschlaggebend. Dazu gehören eine sichere finanzielle Grundversorgung in jeder Phase, ein stabiles soziales Umfeld, gesicherte Kinderbetreuung und eine verständnisvolle akademische Unterstützung. Trotz der Gleichstellungsbemühungen existiert nach wie vor ein eklatanter Unterschied zwischen Müttern und Vätern, da alte Rollenmuster noch greifen und die Mütter meist die Hauptsorge für das Kind tragen und damit weniger Zeit für ihr Studium und ihre Forschung aufwenden können. Die Ausbildungsförderung von Frauen in der Wissenschaft ist dank der Bemühungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in den letzten Jahren verstärkt in den Blick genommen worden. Besonders die Frauenförderpläne, das Professorinnenprogramm zur Erhöhung des Anteils von Frauen in der Forschung, aber auch die Exzellenzinitiativen als Best-Practice-Beispiele und nicht zuletzt der eingangs erwähnte demografische Wandel und die wachsende Kinderlosigkeit der Bildungseliten haben in diesem Zusammenhang zumindest zu einer Sensibilisierung gegenüber dem Themenfeld „Wissenschaft und Familie“ geführt.[1]
1.4 Universität mit Kind in Deutschland
Im Wintersemester 2015/16 studierten 2.757.799 Personen (davon 1.323.673 Frauen) an 426 Hochschulen, davon 107 Universitäten in Deutschland.[2]
Die 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zeigt, dass aktuell 5% der Studierenden in Deutschland ein Kind bzw. mehrere Kinder haben, also knapp 138.000 Personen. Während 50% der Eltern verheiratet sind und 32% in einer festen Partnerschaft leben, sind 18% alleinstehend. Der große Unterschied zwischen Studierenden mit und ohne Kind ist der Altersunterschied: Studierende Eltern sind durchschnittlich 31 Jahre alt und damit fast acht Jahre älter als die kinderlose Vergleichsgruppe.[3]
Deutlich höher ist der Anteil der Eltern bei der Gruppe der Promovierenden. Im Wintersemester waren in Deutschland 196.200 Studierende zur Promotion eingeschrieben.[4] Durchschnittlich 15% der Doktorand/innen – und damit mehr als 29.000 – sind Mütter oder Väter (vgl. Kap. 5).
Im Jahr 2016 schlossen laut Statistischem Bundesamt 1.581 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Habilitation ab, davon entfielen 30% (481) auf Frauen. Im Vergleich dazu waren es noch vor zehn Jahren nur 22%. Das Durchschnittsalter lag dabei bei 41 Jahren, wobei Frauen geringfügig älter waren als Männer.[5]
Im wissenschaftlichen Mittelbau ließ sich für das Jahr 2005 am Beispiel von Nordrhein-Westfalen zeigen, dass 78% der Nachwuchswissenschaftlerinnen sowie 71% der Nachwuchswissenschaftler kinderlos waren (Auferkorte-Michaelis 2006). Zum Vergleich: Der Mikrozensus 2006 wies bei Frauen mit Hochschulabschluss in der Altersgruppe der 40–47-jährigen in den westdeutschen Bundesländern eine ‚nur‘ ca. 34-prozentige Kinderlosigkeit aus (21,5% in den ostdeutschen Bundesländern).[6] Die Kinderlosigkeit in der Wissenschaft war zu diesem Zeitpunkt damit eklatant höher als in anderen akademischen Berufszweigen. Leider liegen keine aktuellen, flächendeckenden Daten zur Mutter- oder Vaterschaft dieser Personengruppe vor.
Für das Jahr 2015 verzeichnet das Statistische Bundesamt 4.689 C4-Professuren (also höchstdotierte Stellen) in Deutschland, von denen nur 536 (11,4%) von Frauen besetzt sind. Unter allen anderen Professuren (Juniorprofessuren, W2) entfallen von insgesamt 46.344 Stellen 10.535 (22,7%) auf Frauen. Auch wenn der Frauenanteil nach wie vor schockierend gering ist, lässt sich verglichen mit dem prozentualen Anteil im Jahr 1990/91 von nur 2,6% C4-Professorinnen und 5,5% C3-Professorinnen (Macha/Paetzold, Identität, 123) immerhin ein deutlicher Anstieg nachweisen. Eine empirische Studie zur Kinderlosigkeit und Elternschaft der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an den nordrhein-westfälischen Universitäten zeigte anhand eines landesweiten Samples von C3- und C4-Inhabern/Inhaberinnen 2004 eine Kinderlosigkeit in beiden Gruppen von Professorinnen von 57,7% (im Vergleich dazu nur 24,1% Kinderlosigkeit bei Professoren).[7] Obwohl die Elternschaft von Professorinnen (und Professoren) bislang nicht bundesweit erhoben wurde, darf angenommen werden, dass maximal die Hälfte aller Professorinnen zugleich Mütter sind.
Von den hochdotierten Professorenstellen entfallen in Deutschland nur 11,4% auf Frauen. Mehr als die Hälfte davon ist vermutlich kinderlos.
Diese Zahlen zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen Geschlecht (männlich/weiblich), Karriereweg und der Entscheidung für oder gegen eine Familiengründung gibt. Männer holen die Elternschaft auf dem Weg zur (für sie gegenüber den weiblichen Mitstreiterinnen wesentlich häufiger erfolgreichen) Professur oft nach, während Frauen sich offenbar immer noch zwischen Karriere und Elternschaft entscheiden (müssen).
Zusammenfassend lassen sich folgende Aussagen treffen: 1. Der Karriereweg von Frauen an den Hochschulen ist immer noch schwierig, wenn auch im Vergleich deutlich verbessert. 2. Frauen, die das Berufsziel Professur verfolgen, bleiben häufig kinderlos. 3. Da Mutterschaft biologisch nur schwer nachgeholt werden kann, existiert eine große Diskrepanz zwischen Frauen und Männern in Bezug auf die Kinderlosigkeit.
1.5 Mütter und Väter: Ein bedeutsamer Unterschied
Frauen und Männer, die studieren, haben inzwischen die gleichen Bedingungen und die gleichen Chancen während des Studiums. Dies ändert sich jedoch meist, sobald sie zu Müttern oder Vätern werden. Nicht etwa, weil sich damit die Grundbedingungen des Studierens ändern würden, sondern weil – oft auch gegen den Willen der Mütter und Väter – mit der Familiengründung eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen stattfindet: Müttern wird stärker die Aufgabe der Kinderbetreuung und ‑erziehung, Vätern die Aufgabe der Familienfinanzierung überantwortet. Entgegen aller Tendenzen zur Gleichberechtigung lässt sich dies nach wie vor beobachten, besonders während der Säuglings- und Kleinkindphasen. Je älter und damit meist selbstständiger die Kinder werden, desto besser lassen sich die Retraditionalisierung und die (oft unbewusste) Festlegung auf die Erfüllung bestimmter Geschlechterrollen wieder abschwächen.
Ein Kind zu bekommen bedeutet neben der Übernahme von Verantwortung für einen anderen Menschen zweierlei: eine Veränderung der eigenen Bedürfnisse und eine Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit. Bereits die Schwangerschaft kann für die Mutter körperlich anstrengend sein und zu mehr Ruhebedürfnis und damit geminderter Belastbarkeit führen. Ist das Kind geboren, müssen die Eltern meist mit sehr viel weniger Schlaf auskommen, besonders die Mütter, die ihre Kinder stillen. Das Kümmern um die Kinder, also das Herumtragen, Wickeln, Umziehen, Füttern, Beruhigen, Spielen usw., ist keine Nebensache, sondern ein anstrengender ‚Job‘. Auch unter idealen Betreuungsbedingungen, die täglich ein paar kinderfreie Stunden ermöglichen, sind Eltern, vor allem aber die Mütter körperlich belasteter und oft müde, sodass das eigene Bedürfnis nach mehr Schlaf oder danach, viel Zeit mit dem Nachwuchs zu verbringen, gepaart mit der vielleicht fehlenden Betreuung dazu führt, eine abendliche universitäre Pflichtveranstaltung ausfallen zu lassen oder das Semesterprogramm insgesamt ‚abzuspecken‘. Dies bewirkt automatisch eine Verlangsamung des Studiums.
Es ist wichtig, an dieser Stelle folgendes zu betonen: Das ist völlig in Ordnung so! Denn hier beginnt die Aufgabe der Institutionen, die durch strukturelle Maßnahmen die Teilhabe am Studium trotz der veränderten Lebenssituation der studierenden Mütter und Väter ermöglichen müssen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Studieren und Forschen mit Kind»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Studieren und Forschen mit Kind» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Studieren und Forschen mit Kind» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.