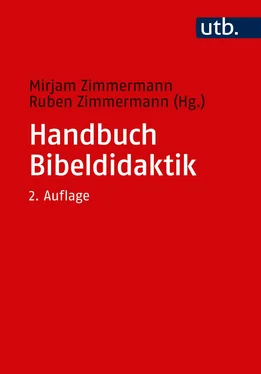Dern, Christian, Dialogische Bibeldidaktik. Biblische Ganzschriften des Alten und Neuen Testaments in den Sekundarstufen des Gymnasiums – ein unterichtspraktischer Entwurf, Beiträge zur Kinder- und Jugendtheologie 23. Kassel 2013.
Müller, Peter, Gott und die Bibel. Theologie elementar. Stuttgart 2015.
Steinkühler, Martina, Praxisbuch Bibel erleben. Göttingen 2015.
Troi-Boeck, Nadja et al. (Hg.), Wenn Jugendliche Bibel lesen. Jugendtheologie und Bibeldidaktik. Zürich 2015.
Religionspädagogische Beiträge 75/2 (2016) (Themenschwerpunkt Bibeldidaktik unter Religionspädagogik DISKURSIV 1).
Wiemer, Axel, Der Galaterbrief im Religionsunterricht. Die Theologie des Paulus in ihrer Zeit und im Dialog mit Jugendlichen heute. Göttingen 2017.
1
Vgl. z.B. Bibeltexte für die Evangelisierung der Deutschen Bibelgesellschaft https://www.die-bibel.de/service/pressebereich/pressearchiv/archiv-detailansicht/news/detail/News/lesen-lernen-mit-der-bibel-in-indonesien/; Zugriff am 17.12.2017.
2
Fricke, Michael, Biblische Themen. In: Rothgangel, Martin et al. (Hg.), Religionspädagogisches Kompendium. 7., grundlegend neu bearb. und erg. Aufl. Göttingen 2012, 374–388, hier: 375: „Das Lernen an der Bibel vermittelt religiöse Sprachfähigkeit“; Fricke unterscheidet drei theologische und vier bildungstheoretische „Begründungen für die Arbeit mit der Bibel“ (a.a.O., 374–376), womit er eine Systematik von Kropač, Ulrich, Biblisches Lernen. In: Hilger, Georg et al. (Hg.), Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf. München 62010, 416–433 aufnimmt.
3
Vgl. als erster Versuch Zimmermann, Ruben, Der ‚didaktische‘ Johannes. Neuere Trends in der Johannesforschung und ihre didaktischen Implikationen. Ein Beitrag zur mimetischen Bibeldidaktik. entwurf (2/2012), 6–9, sowie Zimmermann, Mirjam/Zimmermann, Ruben, Skizze einer mimetischen Bibeldidaktik. Schrifthermeneutik im religionspädagogischen Kontext, PrTh 49 (2014), 165–172.
4
Vgl. Grethlein, Christian, Fachdidaktik Religion. Evangelischer Religionsunterricht in Studium und Praxis. Göttingen 2005, 294.
5
Grethlein, 2006, 292 (vgl. den gesamten bibeldidaktischen Abschnitt a.a.O., 292–306).
6
Porzelt spricht hier vom „anthropologisch-korrelativen Begründungsmodell“ als Begründung des Bibelunterrichts in „nachchristlicher Zeit“, das er in Anlehnung an den Synodenbeschluss der katholischen Kirche in Deutschland (Der Religionsunterricht in der Schule, 1974) in vier Dimensionen unterteilt. Neben der (binnen)religiösen Selbstvergewisserung geht es um kulturgeschichtliche, ideologiekritische und existenzielle Selbstvergewisserung im Dialog mit der Bibel, vgl. Porzelt, Burkard, Grundlinien biblischer Didaktik. Bad Heilbrunn 2012, 54–67.
7
Siehe Fricke, 2012, 375, sowie Krupic, 2010, 420: „Biblisches Lernen als Einübung in Kritik und Hoffnung“. Kropač knüpft leitet zugleich zu einer kritischen Lektüre des Bibeltextes selbst an, indem er das skeptische Potenzial des Dekonstruktivismus in eine „aufspürende Lektüre“ integriert, die „irritierende Momente, Spannungen und Widersprüche im Text kenntlich“ macht, vgl. Kropač, Ulrich, Leser – Text – Kontext. Bibeldidaktik im Horizont (post)moderner literaturtheoretischer Strömungen. RpB 75 (2016), 62–71 (Zitate ebd. 69).
8
Ein eindrückliches Beispiel dieser Rolle der Bibel bei der Entwicklung der philosophischen Hermeneutik bietet der Sammelband Gadamer, Hans-Georg/Boehm, Gottfried, Seminar: Philosophische Hermeneutik. Frankfurt a.M. 41985, der über weite Strecken nur Theologen bzw. Bibelwissenschaftler präsentiert; vgl. jetzt auch Luther, Susanne/Zimmermann, Ruben (Hg.), Studienbuch Hermeneutik. Bibelauslegung durch die Jahrhunderte als Lernfeld der Textinterpretation. Portraits – Modelle – Quellentexte. Gütersloh 2014.
9
So eine Formulierung „fachübergreifender Kompetenzen“ biblischer Didaktik bei Lindner, Heike, Kompetenzorientierte Fachdidaktik Religion. Praxishandbuch für Studium und Referendariat. Göttingen 2012, 26–38, hier: 27; ferner Zimmermann, Mirjam/Zimmermann, Ruben, Hermeneutische Kompetenz und Bibeldidaktik. Durch Unverständnis der Bibel das Verstehen lernen. GlLern 20 (2005), 72–87.
10
Vgl. Theißen, Gerd, Zur Bibel motivieren. Aufgaben, Inhalte und Methoden einer offenen Bibeldidaktik. Gütersloh 2003, 36–46.
11
Pestalozzi, Johann Heinrich, Werke in acht Bänden. Hg. v. Paul Baumgartner. Erlenbach/Zürich 1945–1949, hier: Bd. 4 (1945), 279.
12
Aufnahme findet die Diktion etwa in Simon, Werner, Mit der Bibel leben lernen? Didaktische Grundlegung. In: Niehl, Franz Wendel (Hg.), Leben lernen mit der Bibel. Der Textkommentar zu ‚Meine Schulbibel‘. München 2003, 13–26.
13
Luther, Martin, WA 31,1; 67,24–27.
14
So etwa auch das Ziel der Bibeldidaktik bei Baldermann, Ingo, Einführung in die biblische Didaktik. Darmstadt 42011, hier: „Worte zum Leben“ (24–68), besonders „Kinder entdecken sich selbst in Worten der Bibel“ (29–31); ähnlich auch bei Theißen, 2003, 63–115, der „Lebensorientierung“, „Problemlösungspotenzial“, „Symbolverstehen“ und „Kontaktaufnahme mit Gott“ als Ziele der Bibeldidaktik benennt und dies nicht nur auf einen kirchlichen Adressatenkreis beschränkt, sondern „nach dem Beitrag der Bibel zur Lebensbewältigung – nicht nur für religiöse Menschen, sondern für Menschen überhaupt“ (a.a.O., 46) fragt. Für C. Grethlein entspricht dies gerade der Medialität des Buches selbst, das eine unverzichtbare Funktion für die Kommunikation des Evangeliums erfüllt. „Eine rein historisch oder kulturgeschichtlich orientierte Lektüre steht in Widerspruch zur Intention der Bibel. Der Umgang mit der Bibel ist als personale Interaktion zu gestalten.“ (so Grethlein, 2005, 295); ferner Fricke, 2012, 375: „Das Lernen mit der Bibel trägt zur Identitätsentwicklung bei. So verhilft die Auseinandersetzung mit biblischen Bildern und Erzählungen dazu, eigene Orientierung für das Leben aufzubauen (…)“. Oder auch Dressler, Bernhard/Schroeter-Wittke, Harald, Vorwort. In: Dies. (Hg.), Religionspädagogischer Kommentar zur Bibel. Leipzig 2012, 11–16, hier: 12: „Eine Bibeldidaktik, die die Bibellektüre nicht mit der existentiellen Frage verknüpft, wie ich mich und die Welt verstehen will, bleibt hinter der Bibel selbst zurück. Kulturhermeneutik ist mit Daseinshermeneutik zu verbinden“.
15
Ricœur, Paul, Philosophische und Theologische Hermeneutik. In: Ders./Jüngel, Eberhard, Die Metapher. Zur Hermeneutik religiöser Sprache. BEvTh. München 1974, 25–45, hier: 33. „Es heißt nicht, dem Text die eigene begrenzte Fähigkeit des Verstehens aufzuzwingen, sondern sich selbst dem Text auszusetzen und von ihm ein erweitertes Selbst zu gewinnen, einen Existenzentwurf als wirklich angeeignete Entsprechung eines Weltentwurfs“ (ebd.).
16
Entsprechend bezeichnet Bernd Schröter die Bibel im Unterricht als „ Perspektivbuch , an dem man lernen kann, die Welt und sich selbst sub specie Dei zu sehen.“ (so Schröder, Bernd, Religionspädagogik. Tübingen 2012, 611, kursiv im Original).
17
Der Philosoph Jürgen Mittelstraß hat den Geisteswissenschaften die Rolle der „Orientierungswissenschaften“ im Gegenüber zu den naturwissenschaftlichen „Verfügungswissenschaften“ zugewiesen, vgl. Mittelstraß, Jürgen, Die unheimlichen Geisteswissenschaften (Akademievortrag am 9. Februar 1995). In: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hg.), Berichte und Abhandlungen. AB 2. Berlin 1996, 215–235, hier: 234–235.
18
Die von Kropač eingeführte und vielfach rezipierte Differenzierung zwischen „theologischen“ und „bildungstheoretischen“ Begründungen der Bibeldidaktik (vgl. Fußnote 2) führt insofern eine künstliche Trennung ein, der wir hier nicht folgen.
Читать дальше