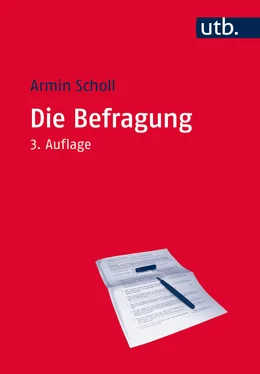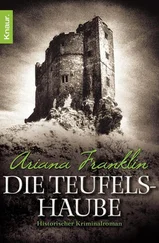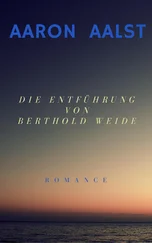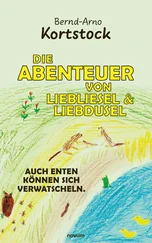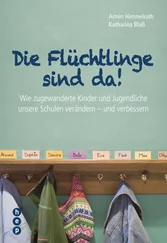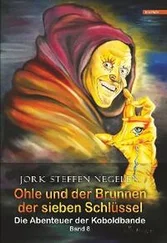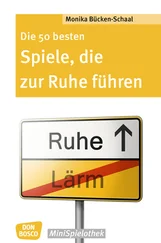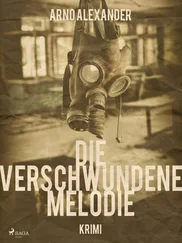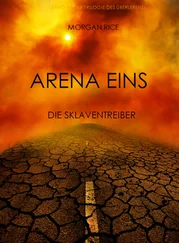Armin Scholl - Die Befragung
Здесь есть возможность читать онлайн «Armin Scholl - Die Befragung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die Befragung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die Befragung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Befragung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Parallel zum Lehrbuch werden im Internet die methodischen Anlagen ausgewählter empirischer Studien veröffentlicht, um an konkreten Beispielen die Vielfalt der praktischen Möglichkeiten und Varianten der Befragung zeigen zu können.
Das Buch will nicht nur die Regeln der Methode vermitteln, sondern auch zum kreativen Umgang mit ihr anregen. Außerdem wird großer Wert auf eine pragmatische und neutrale Darstellung qualitativer und quantitativer Befragungsformen gelegt.
Die Befragung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Befragung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
2Die Zeitschrift »Planung und Analyse« dokumentierte 1983 den »Fragebogen für Arbeiter«, den Karl Marx im Jahr 1880 in 25.000 Exemplaren als Beilage einer Zeitschrift in Frankreich verbreitete. Solche Befragungen zur wirtschaftlichen Lage der Arbeiter oder der Armen wurden im 19. Jahrhundert und bereits vorher durchgeführt (vgl. Noelle-Neumann / Petersen 1996: 620ff.; Diekmann 2011: 99ff.).
3In diesem Kontext entwarf Weber auch eine Inhaltsanalyse, sodass er für diese Methode ebenfalls als Pionier gelten kann (vgl. Weber 1911: 52).
4Eine ausführliche, methodisch dokumentierte Darstellung der bisherigen ALLBUS-Befragungen findet sich in www.gesis.org/dienstleistungen/daten/umfragedaten/allbus.
5Zudem wird auf diese Weise eine Trennlinie mitten durch die qualitativen Methoden gezogen, denn diese haben oft das Verstehen ihres Gegenstands zum Ziel und wären demnach nicht-empirisch. Diese Trennung ist unpraktikabel, wenn etwa die Daten mit dem empirischen Verfahren des narrativen Interviews erhoben und mit dem nicht-empirischen Verfahren der Hermeneutik ausgewertet wird.
6In einem Fall muss der Forschungsgegenstand nicht außerwissenschaftlich sein, nämlich wenn die Wissenschaft selbst zum Forschungsgegenstand wird, also in der Wissenschaftssoziologie. Die untersuchte Wissenschaftspraxis wird dann theoretisch und methodisch genauso wie ein außerwissenschaftlicher Forschungsgegenstand behandelt.
7Dieses Inferenzproblem ist aber nicht typisch für die Befragung, sondern betrifft ebenso die Inhaltsanalyse, bei der vom analysierten Text auf Kontexte geschlossen wird (vgl. Merten 1995), und die Beobachtung, bei der vom beobachteten Verhalten auf sinnhafte Handlungen geschlossen wird (vgl. Gehrau 2002).
8Solche Unterschiedskataloge werden vor allem von Vertretern qualitativer Methoden aufgestellt (vgl. Kleining 1982; Corbin / Strauss 1990; Honer 1989; Lamnek 2010: 124-127). Dies geschieht oft zur Rechtfertigung qualitativer Methoden gegenüber dem quantitativen »Mainstream«. In den Lehrbüchern, die von Methodologen mit vorwiegend quantitativer Präferenz verfasst werden, gelten dagegen die Regeln quantitativer Methoden als Standard für empirische Sozialforschung schlechthin. Die qualitativen Methoden werden dementsprechend an diesem Standard gemessen, was meistens in einer äußerst kurzen und oft ungerechten Abhandlung der qualitativen Methoden resultiert (vgl. etwa Diekmann 2011: 543ff.; Fowler 1988; Converse / Presser 1986).
9Im Extremfall gibt der Befragte sogar eine Antwort auf eine Einstellungsfrage, obwohl er keine Meinung dazu hat (»pseudo-opinions«). Dieses Phänomen betrifft bereits die Validität der Antwort, denn sie kann als ungültig eingestuft werden, wohingegen die Antwort auf der Basis einer nur schwachen Meinungstiefe durchaus gültig sein kann, aber sehr stimmungsoder situationsabhängig ist.
10Die induktive Forschungslogik, wie sie vor allem von der »Grounded Theory« (vgl. Corbin / Strauss 1990) bevorzugt wird, versucht zwar, die Behinderungen für die empirische Untersuchung, die von vorgefertigten Theorien und Hypothesen ausgehen (können), zu vermeiden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Forscher völlig ohne (theoretische) Vorannahmen ins Feld geht, sondern allenfalls, dass er in der Befragungssituation theoretische Sensibilität und Offenheit beibehält (vgl. Kelle / Kluge 2010: 19ff., 28f.).
11Diese Kriterien gelten zwar nicht speziell für die qualitative Sozialforschung, sondern sind grundlegend für empirische Forschung schlechthin; sie werden allerdings von qualitativen Forschern anders interpretiert.
12Prinzipiell kann eine offene Befragungsform auch standardisiert ausgewertet werden. Man verlässt dann allerdings die qualitative Methodologie.
13Diese abstrakten Kategorien reduzieren zwar auch den lebensweltlichen Hintergrund des Befragten; diese Reduktion ist aber nicht als (so stark) isoliert vom Entstehungskontext zu verstehen wie bei der quantitativ-standardisierten Erhebung von Variablen (vgl. Kvale / Brinkmann 2009: 201-208).
14Diekmann (2011: 533) bestreitet die heutige Relevanz dieses Anspruchs und vermerkt süffisant, dass der zunehmende Einsatz qualitativer Verfahren in der Markt- und Meinungsforschung ein Indiz für die Entkoppelung von gesellschaftskritischen Vorstellungen von Sozialforschung und der Anwendung bestimmter Methoden ist.
15Ausführlich mit dem Verhältnis quantitativer und qualitativer Forschung beschäftigten sich Garz / Kraimer (1991): Puristische Positionen gehen entweder von der Inkommensurabilität (Unvereinbarkeit) oder von der Substitution (Ersetzbarkeit) beider Forschungsstrategien aus. Pragmatische Positionen halten das Verhältnis eher für komplementär (ergänzend) oder symbiotisch (kreuzvalidierend) (vgl. auch Hoffmann-Riem 1980; Kleining 1982; Brosius / Haas / Koschel 2012: 4f.).
| [29]2 | Verfahren der Befragung |
Die Verfahren der Befragung lassen sich nach ihrem Kommunikationsmodus in drei Gruppen unterteilen: persönliche (face to face), telefonische und schriftliche Befragungen. Das jüngste Verfahren der Online-Befragung stellt zwar eigentlich nur eine Variante der schriftlichen Befragung dar, aber sie bekommt zunehmend ein eigenes Profil und wird deshalb hier als eigenständiges Verfahren behandelt. Neben der Charakterisierung der Verfahren selbst wird auch die jeweilige Stichprobenpraxis beschrieben, weil diese wesentlich zu den Vorteilen und Nachteilen des Verfahrens beiträgt. Die Unterstützung der Befragung durch den Computer, die unter dem Oberbegriff »Computer Assisted Interviewing« (CAI) firmiert, erschließt neue Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Befragungsverfahren, die aber auch mit neuen Anforderungen und Problemen verbunden sind.
| 2.1 | Das persönliche (face-to-face) Interview |
| 2.1.1 | Beschreibung und Varianten |
Das persönliche Interview ist eine Befragungsform, das auf der Anwesenheit von einem (selten zwei) Interviewer(n) und einem (selten mehreren) Befragten basiert. Es wird deshalb auch als »face-to-face«-Interview bezeichnet.
Grundsätzlich lassen sich drei Varianten unterscheiden: das Hausinterview, das Passanteninterview und die »Klassenzimmer«-Befragung.
Beim Hausinterview sucht der Interviewer den Befragten auf, entweder in dessen Privatwohnung, an seinem Arbeitsplatz oder an einem verabredeten anderen Ort. Es ist die häufigste Variante der mündlichen Befragung, die auch die größten Möglichkeiten bietet, während die anderen Varianten verschiedenen Beschränkungen unterliegen.
Beim Passanteninterview führt der Interviewer die Befragung im öffentlichen Raum durch, zum Beispiel in der Fußgängerpassage einer Innenstadt. Für den Einsatz dieser Variante müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein bzw. Beschränkungen berücksichtigt werden (vgl. Nötzel 1989; Friedrichs / Wolf 1990):
Die Grundgesamtheit muss in Beziehung stehen mit dem Ort der Befragung. Dies ist der Fall, wenn Käufer in der Innenstadt oder Passanten, die an einer Plakatwand oder an einem Flugblattverteiler vorbeigehen, interviewt werden.
[30]Die Interviews müssen kurz gehalten werden, da die Situation flüchtig ist und die Passanten andere Ziele verfolgen und wenig Zeit haben.
Externe Faktoren wie Wetter und Tageszeit beeinflussen den Ablauf von Passanteninterviews wesentlich, sodass die Bedingungen vorher genau ermittelt werden müssen.
Bei der Klassenzimmer-Befragung werden die Fragebögen durch einen Verteiler persönlich an die Befragten übergeben, aber von diesen selbst ausgefüllt (selfadministered questionnaires). Der Verteiler der Fragebögen motiviert zur Teilnahme an der Befragung, steht für Rückfragen der Befragten zur Verfügung und erläutert gegebenenfalls den Zweck der Untersuchung, greift aber sonst nicht ein. Damit ist die Klassenzimmer-Befragung eine Hybridform aus mündlicher und schriftlicher Befragung (vgl. Hafermalz 1976: 12). Voraussetzung für diese Befragungsart ist allerdings, dass die Befragten räumlich nicht verstreut sind, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten, relativ geschlossenen Ort versammelt sein müssen, an dem die Fragebögen verteilt und in der Regel auch wieder eingesammelt werden müssen. Damit reduziert sich die Einsatzmöglichkeit dieser Variante der persönlichen Befragung auf Fragestellungen, bei denen in der Regel homogene Gruppen untersucht werden sollen (Schulklassen, Universitätsseminare, Ressorts in journalistischen Redaktionen, Abteilungen in Unternehmen und Behörden usw.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die Befragung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Befragung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die Befragung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.