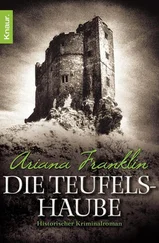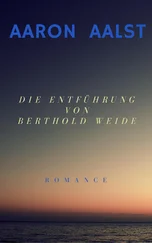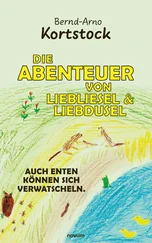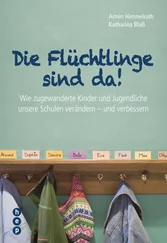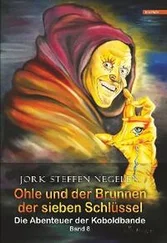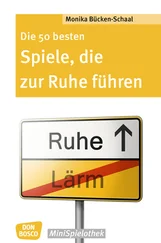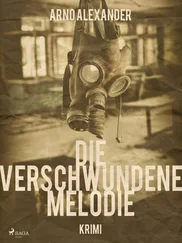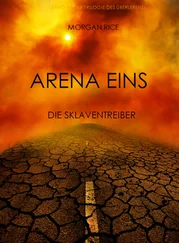1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Haushalt oder Zielperson trotz mehrmaliger Versuche nicht erreichbar;
Haushalt oder Zielperson verweigert jede Auskunft ohne Angabe von Gründen, aus Zeitmangel, aus Interesselosigkeit oder aus prinzipiellen Erwägungen gegen Meinungsforschung;
Zielperson bricht das Interview frühzeitig ab;
Zielperson ist krank oder kann dem Interview geistig nicht folgen;
Interview ist fehlerhaft und kann nicht ausgewertet werden17 (vgl. Behrens / Löffler 1999: 88f.; Porst 1991: 61).
Die Ausschöpfungsquote ist ein wichtiger Indikator für die Qualität der Stichprobenrealisierung; sie wird wie folgt berechnet 18: Ausgangspunkt ist die Bruttostichprobe, die alle ausgewählten und eingesetzten Adressen umfasst. Davon werden die qualitätsneutralen Ausfälle abgezogen; der Rest ist die Nettostichprobe [34]oder »bereinigte« Stichprobe. Von dieser werden die relevanten Ausfälle abgezogen, sodass der Anteil der tatsächlich durchgeführten und auswertbaren Interviews an der Nettostichprobe die Ausschöpfungsquote ergibt. Man kann zwar nicht eindeutig mathematisch bestimmen, unterhalb welcher Grenze eine Stichprobe nicht mehr repräsentativ ist, aber die Marktforschung sieht als Konvention eine Mindestausschöpfung von 70 Prozent an, deren Unterschreitung zumindest begründet werden muss (vgl. Behrens / Löffler 1999: 88ff.). Kritiker bezweifeln allerdings, dass bei einem Ausfall von bis zu 30 Prozent die wahrscheinlichkeitstheoretischen Annahmen der Zufallsauswahl noch gültig sind. Zudem ist die geforderte Ausschöpfungsquote von 70 Prozent in der Praxis selten in einem vertretbaren Aufwand zu realisieren (vgl. Sommer 1987: 300f.).
Quotenstichprobe
Wie aus diesen Ausführungen ersichtlich wird, ist das Vorgehen auf ADM-Basis in der Praxis sehr aufwändig. Aus diesem Grund bevorzugen einige Meinungsforschungsinstitute das Quotenverfahren , das bereits in 40er Jahren in den USA entwickelt wurde.
Ausgangspunkt ist nicht die Grundgesamtheit selbst und ihre Elemente, sondern die statistischen Proportionen bzw. Merkmalsverteilungen der Grundgesamtheit. Aufgrund amtlicher Daten des Mikrozensus oder den Ergebnissen der »MediaAnalyse« (→  www.utb-shop.de, Kapitel 1.2.1) sind folgende Merkmale und ihre Verteilungen in der Grundgesamtheit bekannt:
www.utb-shop.de, Kapitel 1.2.1) sind folgende Merkmale und ihre Verteilungen in der Grundgesamtheit bekannt:
regionale Verteilung nach Bundesländern, Regierungsbezirken und Gemeindegrößen (vier Wohnortgrößegruppen);
Geschlecht;
Alter bzw. (vier) Altersgruppen;
Anteil Berufstätiger und (sechs) Berufsgruppen;
bekannte Konsummerkmale (Besitz bestimmter Konsumartikel).
Anhand dieser Merkmale wird ein Quotenplan entwickelt, der einen modellgerechten Miniaturquerschnitt der Grundgesamtheit abbildet. Mit diesen Quotenvorgaben suchen die Interviewer die Befragten selbstständig aus. Damit einher gehen zwei Annahmen: Durch die komplexe Quotenvorgabe, die mehrere Merkmale umfasst, ist der Interviewer in seinem Ermessensspielraum eingeschränkt und praktisch gezwungen, die Befragten annäherungsweise zufällig auszuwählen, sodass systematische Verzerrungen zumindest verringert werden können. Über die (wenigen) Quotenmerkmale hinweg wird Repräsentanz auch für andere Merkmale, die mit ihnen korrelieren, hergestellt. Dies kann man zumindest für [35]diejenigen weiteren Merkmale kontrollieren, für die externe Daten vorliegen (vgl. Noelle-Neumann / Petersen 1996: 255ff.; Meier / Hansen 1999: 103ff.).
Folgende Anforderungen sind an die Erstellung von Quotenplänen zu stellen:
Die Quoten müssen objektiv und spezifisch sein, sodass sie nicht erst vom Interviewer interpretiert werden müssen.
Die Quotenvorgabe darf weder zu einfach sein, um zu vermeiden, dass der Interviewer (nur) Personen aus seinem Bekanntenkreis auswählt, noch zu schwierig sein, um zu vermeiden, dass der Interviewer die Befragtenmerkmale fälscht und sie an die Quotenvorgabe anpasst.
Der Fragebogen sollte multithematisch sein, damit der Interviewer die Zielpersonen nicht nach ihrer (vermeintlichen) Themenkompetenz auswählt.
Die Interviews sollten vorwiegend in Wohnungen und nicht auf der Straße durchgeführt werden, damit mobile Personen nicht überrepräsentiert werden.
Die Befragung sollte auf möglichst viele Interviewer verteilt sein, sodass individuelle Verzerrungen sich nicht stark auf das Gesamtergebnis auswirken oder sich im Durchschnitt ausgleichen (können).
Dementsprechend sollte die Zahl der Interviews pro Interviewer möglichst gering sein, damit die Aufgabe auch zeitlich zu bewältigen ist und keine Frustrationen mit der Quotenerfüllung entstehen.
Insgesamt sollte das Interviewernetz eines Instituts soziodemografisch heterogen, ähnlich der Bevölkerungsstruktur, zusammengesetzt sein, damit keine Verzerrungen entstehen selbst für den Fall, dass die Interviewer Zielpersonen aus ihrem Milieu bevorzugt auswählen.
Die Interviewer müssen intensiv geschult und ihre Tätigkeit regelmäßig und zentral kontrolliert werden, damit Verstöße im Vorfeld minimiert und während der Feldzeit schnell entdeckt und korrigiert werden können (vgl. Noelle-Neumann / Petersen 1996: 278f.; Meier / Hansen 1999: 109ff.).
Mittlerweile haben etliche Methodenexperimente stattgefunden, um Unterschiede zwischen Zufallsverfahren und Quotenverfahren zu ermitteln. Tatsächlich stimmen die Verteilungen weitgehend überein (vgl. Reuband 1998b; Noelle-Neumann / Petersen 1996: 263ff.). Dennoch verbleibt als Nachteil des Quotenverfahrens, dass die Qualität der Auswahl selbst nicht kontrollierbar ist. Die Berechnung einer Ausschöpfungsquote ist nicht möglich, da der Interviewer zielgerichtet die Personen selbst aussucht und nicht angibt, wie viele Fehlversuche er hatte. Auch ist nicht kontrollierbar, ob er mehrfach dieselben Personen befragt.
Für beide Verfahren gilt: Repräsentanz ist weitgehend abhängig von der Feldarbeit, denn die Kontrolle der Einhaltung der Zufallsauswahl oder der Quotenmerkmale [36]erfordert einen erheblichen Aufwand. Dies gilt insbesondere, um die oben genannten relevanten Fehler der Verweigerung und der Nichterreichbarkeit (→ Kapitel 7.3.3) zu vermindern (vgl. Erichson 1992: 23ff.).
Weitere Stichprobenmodelle
Neben diesen beiden Grundformen der Stichprobenziehung gibt es zahlreiche Sonderformen, die insbesondere eingesetzt werden, wenn es nicht um bevölkerungsrepräsentative Umfragen geht, sondern um sehr spezifische Bevölkerungsgruppen oder um direkte Vergleiche zwischen verschiedenen Befragtengruppen.
Wenn die Auswahl der Zielpersonen in Abhängigkeit von einem bestimmten Ereignis, etwa von einer Messe, erfolgt, werden Zeitintervallstichproben eingesetzt. Diese sind zeit- und ortsabhängig. Es handelt sich in der Regel um mehrstufige Stichproben, bei denen im ersten Schritt die Befragungsorte ausgewählt werden, zum Beispiel die Eingänge der Messe und die Räume innerhalb der Messehalle. Danach werden die Zeitintervalle bestimmt, innerhalb derer die Befragung durchgeführt wird. Die Auswahl der Befragten erfolgt durch ein bestimmtes, vorher festgelegtes Kriterium, zum Beispiel jede x-te Person, die eine gedachte Linie überschreitet. Für die Entwicklung eines Stichprobenplans sollten die besonderen Gegebenheiten des Ereignisses berücksichtigt werden, um Verzerrungen zu vermeiden (vgl. von der Heyde 1999: 113ff.; Nötzel 1987b).
Speziell für die Klassenzimmer-Befragung ist in der Regel eine Klumpenstichprobe sinnvoll. Dies ist eine mehrstufige Auswahl, bei der räumlich abgegrenzte (Teile von) Organisationen (etwa Schulklassen) entweder per Zufall oder je nach Fragestellung der Untersuchung bewusst ausgewählt werden. Innerhalb dieser ausgewählten Einheiten werden dann alle Individuen (das heißt der ganze »Klumpen«) befragt. Der Vorteil besteht in der Effizienz bei der Durchführung. Allerdings wirkt sich die Klumpung dann negativ aus, wenn die Klumpen sehr homogen sind, weil dann die Gesamtstichprobe weniger Varianz aufweist als bei anderen Stichprobenverfahren und in Bezug auf das homogene Merkmal zu systematischen Verzerrungen führt.
Читать дальше
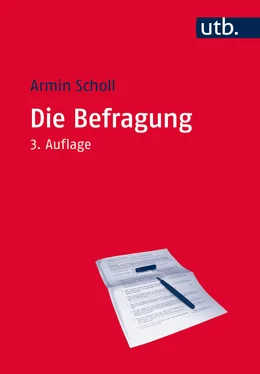
 www.utb-shop.de, Kapitel 1.2.1) sind folgende Merkmale und ihre Verteilungen in der Grundgesamtheit bekannt:
www.utb-shop.de, Kapitel 1.2.1) sind folgende Merkmale und ihre Verteilungen in der Grundgesamtheit bekannt: