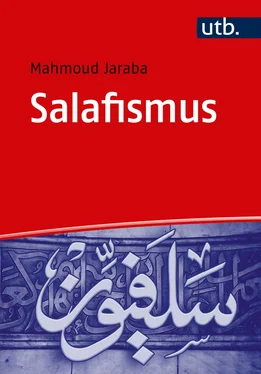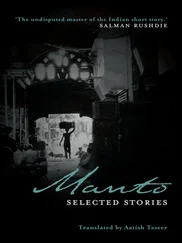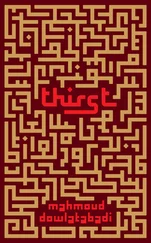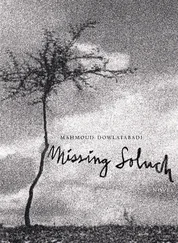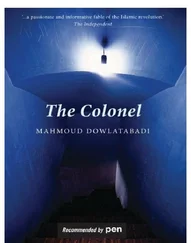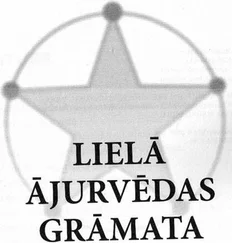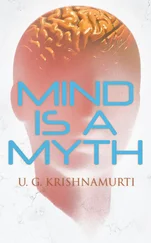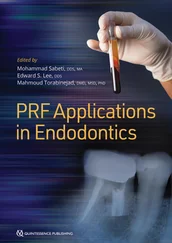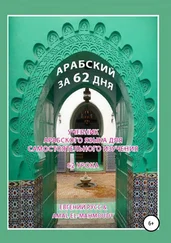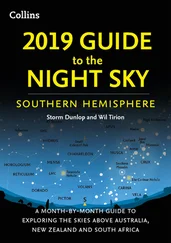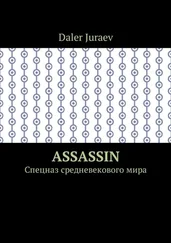Literatur
[9]
Es ist mir ein besonderes Anliegen, an dieser Stelle meine Dankbarkeit denen auszusprechen, ohne die die Arbeit am und das Erscheinen des vorliegenden Buches nicht möglich gewesen wäre.
Meiner Frau Eman bin ich zu weit mehr an Dankbarkeit verpflichtet, als ich das jemals in Worte fassen könnte. Ihre unglaubliche Geduld, unermüdliche Ermutigung und einzigartige Fürsorge für unsere drei Kinder Danya, Raneem und Hadi, insbesondere in meiner häufigen Abwesenheit während meiner Feldforschung, haben alles erst möglich gemacht.
Ein Buch über Salafisten und Extremismus zu verfassen, erwies sich als wesentlich herausfordernder, als ich es ursprünglich erwartet hatte. Ausdrücklich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Mathias Rohe, der die Texte mit vielen wertvollen Anmerkungen kommentiert hat. Die uneingeschränkte Unterstützung meiner Kollegen und Freunde während meiner Feldforschung und anschließenden Schreibphase war dabei ebenfalls von unschätzbarem Wert. Jörn Thielmann, Tarek Badawia, David Malluche, Hatem Elliesie, Peter Spiewok, Gennadi Melnik und Abdelghafar Salim sind demgemäß wesentliche Anteile am Gelingen dieses Werkes zuzuschreiben. Ihnen gilt mein besonderer Dank, der weit über den rein fachlichen Austausch reicht.
Last, but surely not least, richte ich meine Dankbarkeit an Sabine Kruse vom facultas Verlag für die professionelle und verständnisvolle Betreuung sowie Andreas Deppe und Sina Nikolajew für das bewährt gründliche Lektorat.
Dieses Buch ist ein Ergebnis der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Islam in Bayern , welche ein Kooperationsprojekt zwischen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und dem Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa EZIRE an der FAU Erlangen-Nürnberg – geleitet von Prof. Mathias Rohe und Dr. Jörn Thielmann – war. Der Bayerischen Aka-[10]demie der Wissenschaften und ihrem Präsidenten Prof. Dr. Thomas O. Höllmann gilt mein herzlicher Dank für die Ermöglichung meiner Forschung. Das Ergebnis des Gesamtprojekts findet man unter https://islam.badw.de/die-arbeitsgruppe.html.
Die Ansichten und Analysen, die in diesem Buch formuliert werden, sind alleinig die des Verfassers. Die darin enthaltenen Befunde bestehen aus den originären Feldforschungsdaten des Verfassers. Diese wurden nach bestem Wissen und Gewissen unter sorgsamer Berücksichtigung wissenschaftlicher Standards erhoben und ausgewertet.
[11]
Kapitel 1
Extremismus und Metanarrativ
1.1 Einleitung
Bevor ich meine Feldforschung zu der Beziehung zwischen Extremismus und Salafismus bzw. der Salafīya im Bundesland Bayern im November 2015 begann, hatte ich bereits eine grobe Vorstellung davon, was mich für ein Milieu erwarten würde (zur Geschichte, der Ideologie und den Glaubensgrundsätzen des Salafismus siehe Lauzière 2016). Ich verfolge die salafistische Szene seit vielen Jahren sowohl über Social Media als auch über ihre Aktivitäten in Moscheen. Daher war ich über die internen ideologischen Diskussionen, die von den Anhängern des Salafismus übernommen werden, sowie auch über ihre ablehnenden Haltungen gegenüber anderen, seien es andersdenkende Muslime oder Andersgläubige, auf dem Laufenden (für einen Überblick über die unterschiedlichen salafistischen Strömungen siehe Lohlker 2016).
Ich hatte bereits viel über die strengen Überzeugungen der Salafisten sowohl im Hinblick auf andere Muslime als auch auf durch ihre unterschiedliche Religion definierten ‚Anderen‘ gehört und gelesen. Dennoch versuchte ich möglichst unvoreingenommen an die Feldforschung heranzugehen und mein fachliches und thematisches Hintergrundwissen gegenüber den emischen Perspektiven der Akteure und der Erfahrung im Feld zurückzustellen. Nichtsdestotrotz stellte ich mich aus pragmatischen Gründen darauf ein, dass ich eventuell mit stark ideologisch gefärbten Aussagen und Sichtweisen konfrontiert werden würde, die stark von meinen persönlichen Standpunkten abweichen und zu emotionalen Konflikten in der Beziehung zu meinen Informanten führen könnten. Auch wenn wir in der ethnographischen Forschung stets das Ideal der Unvoreingenommenheit anzustreben haben, so ist dies doch [12]in der Praxis nie ganz zu erreichen, da unsere ‚wissenschaftliche‘ Perspektive immer zu einem gewissen Grad auch von subjektiven Faktoren und unserem theoretischen Hintergrundwissen beeinflusst wird. Diese Tatsache sollte nach Ansicht der meisten Ethnologen anerkannt und bewusst reflektiert werden, um ihren Einfluss auf die Annäherung an emische Perspektiven und Konzepte und damit auf die Objektivität der Forschungsergebnisse möglichst gering zu halten.
Ein Erlebnis während meiner Feldforschung, das ich überhaupt nicht erwartete und das mich trotz meiner Kenntnis der salafistischen Szene und ihrer Ideologie sehr überraschte, war der Erhalt einer SMS, die ich eines Abends Ende Oktober 2016 erhielt. Als ich von einem mühevollen und langen Arbeitstag, an dem ich Interviews mit einer Gruppe von ideologischen Salafisten (zur Definition siehe Abschnitt 2.6) geführt hatte, nach Hause zurückgekommen war, sah ich, dass mir Salah 1, mit dem ich mich am Mittag desselben Tages getroffen hatte, eine SMS geschickt hatte, in der er mich vor dem Kauf eines Autos für meine Frau warnte. Der Grund dafür war, dass ich Salah 2, der im Automobilhandel tätig ist, von diesem Vorhaben erzählt hatte. Doch Salah vertrat den Standpunkt, dass es der Frau im Islam verboten sei, Auto zu fahren. Deshalb schickte er mir die folgende Nachricht:
Friede sei mit Dir Bruder. Gerne helfe ich dir bei deiner Suche nach einem Auto. Jedoch muss ich dich als dein Glaubensbruder im Islam vor deiner Idee, deiner Frau das Autofahren zu erlauben, dringend warnen. Das wäre ein schwerer Fehler und ist eine Verleitung von Satan. Wenn du Hilfe beim Erwerb eines Führerscheins in Deutschland brauchst, kann ich dir damit helfen. Ich wünsche dir eine Gute Nacht. Dein Glaubensbruder im Islam.
Eine weitere Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hatte, war, dass Salah nicht in einem konservativen religiösen Umfeld wie dem Königreich Saudi-Arabien, welches zu diesem Zeitpunkt der letzte Staat war, der Frauen das Autofahren verbot, geboren und aufgewachsen war, sondern in einem westlichen Staat, in dem Frauen durch Gesetze und die Verfassung die gleichen Rechte wie Männer genießen. Salah wurde in [13]eine katholische Familie geboren, entschied sich aber im Jahr 2015 dazu, zum Islam zu konvertieren. Er wählte einen neuen Namen, um seinen Austritt aus der Welt des Christentums und seinen Eintritt in die des Islam kenntlich zu machen. Nach seinem Übertritt zum Islam verging kein Jahr, bis Salah damit begann, extremistischen ideologischen (Näheres sogleich unter 1.2) Gedanken anzuhängen, die er für die Grundlagen und den Kern des Islam hielt.
Dazu gehören z. B. das Verbot für Frauen, Auto zu fahren, die Strenge in der Ausübung der religiösen Riten und das Urteilen über den Abfall vom Glauben, um andere, seien es die Anhänger anderer Religionen oder Muslime, die die religiösen Riten nicht befolgen, zu Ungläubigen zu erklären ( takfīr ) und entsprechend zu behandeln. Salah begann einen Blick auf die Welt und einen Umgang mit ihr zu entwickeln, der von der engstirnigen und extremistischen ideologischen Perspektive des ideologischen Salafismus geprägt war. Als ich versuchte, mit ihm darüber zu diskutieren, dass das Autofahren nicht zu den Lehren des Islam gehöre, es keinen einzigen religiösen Text gebe, der Frauen das Fahren verbiete, und das Königreich Saudi-Arabien das einzige muslimische Land sei, in dem Frauen nicht Autofahren dürfen, war dies die letzte Unterhaltung zwischen uns. Er brach den Kontakt ab und sprach nicht mehr mit mir. Er war weiterhin der Ansicht, dass ich eine große Sünde begehe, indem ich meiner Frau das Autofahren erlaube, und dass ich folglich kein guter Muslim mehr sei, mit dem er sich unterhalten kann.
Читать дальше