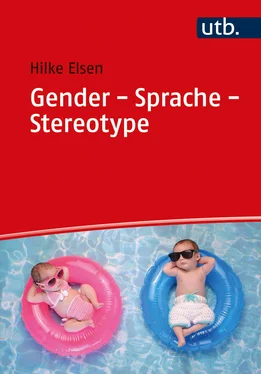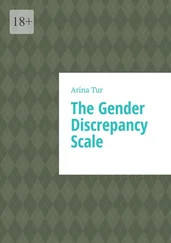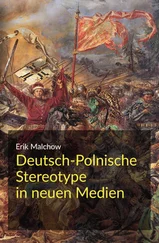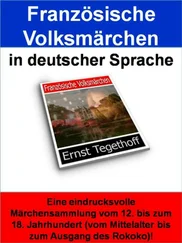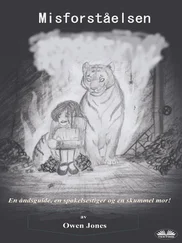1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Polemische Debatten und aggressive Reaktionen sind bis heute nicht abgerissen (Kap. 5.5.5). Aber sie waren und sind wohl weniger gegen die eigentliche Sachlage als generell gegen Frauen und Feministinnen gerichtet und der Angst geschuldet, eine privilegierte Position zu verlieren. Die sozialpolitische Situation hatte sich jedoch verändert: Frauen wurden mehr und mehr Rechte zuerkannt mit dem Ziel, eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern aktiv herzustellen. Die feministische Sprachkritik richtete sich darauf, dies auch auf der sprachlichen Ebene sichtbar zu machen. Daher führte sie immer wieder AsymmetrienAsymmetrie an, die fast immer zum Nachteil der Frauen arbeiten. Hätte es ein ausgewogenes Verhältnis der Ungleichmäßigkeiten mit Vor- und Nachteilen für Frauen und Männer gegeben, wäre das Thema nicht so nachdrücklich diskutiert worden. Stattdessen aber liegt gerade in diesem überproportional hohen Nachteil schon die erste Asymmetrie. Die Diskussion wurde erschwert durch die anfänglich eher auf Intuition beruhende Argumentation auf Seiten der Kritiker/innen und die grundsätzlich ablehnende Haltung der Gegenseite, die auf die meisten Argumente nicht wirklich einging.
Auf der Ebene des Sprachsystems ist eine Kategorie wie GenusGenus durchaus neutralNeutralform und zunächst nicht an biologische Eigenschaften von Referent/innen gekoppelt, zumal der überwiegende Teil von Nomen für unbelebte Dinge oder Abstrakta steht. Die Diskussion ging von Linguistinnen aus, die sich dieser Tatsache bewusst waren. Aber das war nicht der Punkt. Vielmehr ging es darum, wie eine Form mental verarbeitet bzw. verstanden wird. Beispiele aus anderen Sprachen und anderen Zeitstufen zeigen, dass bei Bedarf eine angeblich neutrale maskuline Form als Beleg für gemeinte männliche Referenten herangezogen wurde / wird. Die feministische Kritik zielte also vorrangig auf das Verständnis außerhalb des Kreises der linguistisch geschulten Sprachbenutzer/innen ab. So kam es auch zur Verwendung des Begriffs Sexismus bzw. sexistische Sprache . Sexismus bedeutet unabhängig davon, welches Geschlecht betroffen ist, Benachteiligung bzw. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, wird jedoch de facto kaum auf Benachteiligung von Männern bezogen. Gefordert wurde daher, Frauen gleichberechtigt zu behandeln, dann aber auch sichtbar zu machen. Dafür bot sich die BeidnennungBeidnennung durchaus an. Darüber hinaus sollte dabei auch sprachlich klar werden, dass eigentlich männlich erlebte Funktionen und Aufgaben auch von Frauen übernommen werden können und dass schließlich sprachlich präziser zu formulieren sei (Müller 1988). Weiterhin haben zwar PronominaPronomen wie man und jedermann keine maskuline Referenz im grammatischen Sinne, nichtsdestotrotz lösen sie Assoziationen aus, die eher nicht weibliche Bezüge haben. Die Argumentationen, die auf eine konsequente NeutralitätNeutralform des Genus abzielen, ignorieren völlig die Tatsachen und gehen auf die eigentliche Kritik nicht ein, dass aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Bedingungen auch ein veränderter Bedarf besteht, Sprache zu verwenden.
Die feministischen Bedenken richteten sich damit auch gegen die Willkürlichkeit der Interpretation, die rein nach Erfordernis ein Maskulinum als neutral oder männlich (und Frauen damit ausschließend) auslegte. Sie forderten Gleichbehandlung. Die Strukturalist/innen verkennen ein wesentliches Problem des deutschen Genussystems, dass nämlich in einigen Bereichen über ein GenusGenus durchaus auf Sexusbiologisches Geschlecht, Sexus referiert wird, vgl. der Mann/die Frau, die Mutter Mutter / der Vater, die Oma/der Opa, die Henne/der Hahn, die Lehrerin Lehrer/in, -kraft, -schaft /der Lehrer etc. Sexus und Genus sind daher nicht grundsätzlich und ausnahmslos unabhängig voneinander. Dies war aber zunächst noch nicht empirisch bewiesen.
Der feministischen Sprachkritik ging es aber auch um die öffentliche Wahrnehmung: Luise Pusch mit ihren stark übertriebenen, aber nicht unbedingt immer ernst gemeinten Forderungen war sie auf jeden Fall sicher. Wie sich Jahre darauf zeigen sollte, erwies sich die feministische Sprachkritik als effektiv, da sie öffentliche Diskussionen bewirkte, Vorschriften und Gesetzgebungen beeinflusste und die nötigen Sprachwandelerscheinungen auslöste, die heute für mehr Gerechtigkeit in der deutschen Sprache sorgen (weiter auch Kap. 5).
Im Zuge der Französischen Revolution formierten sich Ende des 18. Jahrhunderts aus sozialpolitischer Unzufriedenheit heraus Proteste, die neben Demokratie und Gerechtigkeit auch eigens Frauenrechte forderten. Im Zusammenhang mit den FrauenbewegungenFrauenbewegung setzte sich in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts die Erkenntnis durch, dass es keine sprachliche Gleichberechtigung gab. So kam es zur Forderung, Gleichheit auch sprachlich zu realisieren. Die frühe Sprachkritik fand Unterschiede bei der sprachlichen Behandlung von Frauen und bei den sprachlichen Verhaltensweisen. Frauen verwenden gern Ausdrücke, die eine Behauptung abschwächen. Sie vermeiden dadurch aus Höflichkeit und Kompromissbereitschaft klare Aussagen. Dies wiederum wird als Unsicherheit und Schwäche gedeutet. Beim Sprechen über Frauen geht der eindeutige Bezug auf die Frau durch das generische Maskulinum verloren. Beides wirkt sich zum Nachteil von Frauen aus. Die feministische Sprachkritik forderte darum, sich dieser Probleme bewusst zu werden und beispielsweise maskuline Bezeichnungen für Frauen zu meiden, weil das missverständlich und unklar ist und dadurch Frauen willkürlich ausgeschlossen werden können und unsichtbar sind. Sie kritisierten aber auch andere AsymmetrienAsymmetrie, die sich jeweils für die Männer vorteilhaft auswirkten.
Die Gegenposition bestritt die Möglichkeit einer assoziativen Verbindung zwischen GenusGenus und Gender, erklärte das Thema für unwichtig, da es einerseits im Rahmen der Gleichstellung andere Themen gebe, andererseits die Referenz in der Regel klar sei. Die Alternativformen seien unnötig, kompliziert bzw. umständlich. Die Rolle der Parole Parole wurde ebenfalls als belanglos gesehen. Sehr auffällig aber waren die vielen polemischen und beleidigenden Reaktionen, die eine ernsthafte Diskussion behinderten.
Vorerst fehlten noch empirische Studien, die eine assoziative Verbindung von GenusGenus und Gender beweisen konnten. So blieb es zunächst bei Annahmen, die sich in theoretischen Grundsatzdiskussionen gegenüberstanden.
Giele (1988) veröffentlichte einen geschichtlichen Überblick aus soziologischer Sicht. Eine kurze Geschichte der Feministischen LinguistikFeministische Linguistik liefert Samel (2000, Kap. 1). Zur literatur- und kulturwissenschaftlichen Perspektive vgl. Frey Steffen (2017), Bergmann et al. (2012). Von Thorne/Henley (1975b) kommt ein sehr detaillierter Überblick über den Stand der Forschung Mitte der 70er Jahre. Über die ganze Vielfalt der Gender Studien stellten beispielsweise Braun/Stephan (2006) eine Artikelsammlung zusammen. Kurze Darstellungen der Situation zum Ende des letzten Jahrhunderts aus Sicht verschiedener deutschsprachiger Länder stammen von Doleschal (1998), Peyer/Wyss (1998), Schoenthal (1998), Trempelmann (1998). Überblicksdarstellungen kommen von Schoenthal (1985), Hornscheidt (2006). Zur Situation in Österreich vgl. Aspöck (1983).
Die frühen Stellungnahmen zum Zusammenhang von Sprache und Geschlecht Anfang des letzten Jahrhunderts beruhten auf eigenen impressionistischen und sehr subjektiven Beobachtungen, wie etwa die von Otto Jespersen, oder verschiedenen anthropologischen Arbeiten, die alle ausschließlich von Männern publiziert waren. Frühe Analysen basierten auf unsystematisch zusammengestellten Datensammlungen, waren nicht repräsentativ und setzten alles Männliche als Norm an (vgl. Hellinger 1990). Etwas später berücksichtigten die ersten soziolinguistischenSoziolinguistik, -isch Studien Geschlecht als Variable und räumten den Frauen eine Rolle bei Sprachwandelerscheinungen ein.
Читать дальше