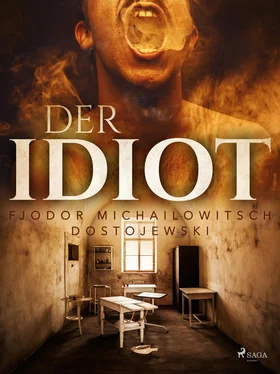Fjodor M Dostojewski - Der Idiot
Здесь есть возможность читать онлайн «Fjodor M Dostojewski - Der Idiot» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der Idiot
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der Idiot: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der Idiot»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der Idiot — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der Idiot», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Der Fürst schwieg und blickte die Damen alle an.
»Das sieht nun freilich nicht wie Quietismus aus«, sagte Alexandra vor sich hin.
»Und jetzt, bitte, erzählen Sie uns, wie Sie verliebt waren!« sagte Adelaida.
Der Fürst blickte sie erstaunt an.
»Hören Sie!« fuhr Adelaida schnell fort. »Sie sind uns auch noch die Beschreibung des Baseler Bildes schuldig, aber jetzt möchte ich hören, wie Sie verliebt waren; leugnen Sie nicht, Sie sind verliebt gewesen! Zudem werden Sie, sobald Sie zu erzählen anfangen, aufhören, Philosoph zu sein.«
»Jedesmal, wenn Sie mit einer Erzählung fertig sind, schämen Sie sich sofort dessen, was Sie erzählt haben«, bemerkte Aglaja plötzlich. »Woher kommt das?«
»Was redest du da für dummes Zeug«, schalt die Generalin und blickte Aglaja mißbilligend an.
»Ja, das war sehr unverständig«, stimmte Alexandra ihr bei.
»Glauben Sie nicht, daß sie das wirklich meint, Fürst«, wandte sich die Generalin an diesen, »sie redet absichtlich so, aus irgendwelcher Tücke; so dumm ist sie gar nicht. Nehmen Sie es nicht übel, daß die Mädchen Sie so quälen! Gewiß führen sie irgend etwas im Schilde; aber sie sind schon sehr für Sie eingenommen. Ich kenne ihre Gesichter.«
»Auch ich kenne die Gesichter der jungen Damen«, erwiderte der Fürst mit besonders starker Betonung.
»Wieso?« fragte Adelaida neugierig.
»Was wissen Sie von unsern Gesichtern?« fragten auch die beiden andern in lebhafter Spannung.
Aber der Fürst schwieg mit ernster Miene; alle warteten auf seine Antwort.
»Ich werde es Ihnen später sagen«, versetzte er leise und ernst.
»Sie wollen sich durchaus interessant machen«, rief Aglaja. »Und was Sie dabei für ein feierliches Gesicht machen!«
»Nun gut«, sagte Adelaida wieder in ihrer hastigen Art. »Aber wenn Sie ein solcher Kenner von Gesichtern sind, dann sind Sie sicherlich auch verliebt gewesen; ich habe also richtig vermutet. Erzählen Sie uns also davon.«
»Ich bin nicht verliebt gewesen«, antwortete der Fürst ebenso leise und ernst wie vorher, »ich... war auf andere Weise glücklich.«
»Wie denn? Wodurch denn?«
»Nun gut, ich will es Ihnen erzählen«, sagte der Fürst; er schien in tiefes Nachdenken versunken zu sein.
VI
»Da schauen Sie mich nun alle mit solcher Neugier an«, begann er, »daß Sie mir am Ende noch böse werden, wenn ich diese Neugier nicht befriedige. Nein, nein, ich scherze nur«, fügte er schnell mit einem Lächeln hinzu. »Dort... dort gab es viele Kinder, und ich bin die ganze Zeit über mit Kindern zusammen gewesen, nur mit Kindern. Es waren die Kinder jenes Dorfes, eine ganze Schar, die die Schule besuchte. Unterrichtet habe ich sie nicht, o nein, dazu war ein Schullehrer dort, Jules Thibaut; ich habe sie wohl auch dies und das gelehrt, größtenteils aber war ich ohne solche Absicht mit ihnen zusammen, und die ganzen vier Jahre habe ich in dieser Weise verlebt. Weiter hatte ich keine Wünsche. Ich sagte ihnen alles, ohne ihnen etwas zu verheimlichen. Ihre Eltern und Verwandten waren alle auf mich ärgerlich, weil die Kinder zuletzt ohne mich gar nicht mehr leben konnten und mich immer umdrängten, und der Schullehrer wurde schließlich mein ärgster Feind. Ich hatte dort viele Feinde, alle um der Kinder willen. Sogar Schneider machte mir Vorwürfe. Und was fürchteten sie eigentlich? Man kann einem Kind alles sagen, geradezu alles; mich hat oft die Wahrnehmung überrascht, wie schlecht die Erwachsenen die Kinder kennen, sogar die Väter und Mütter ihre eigenen Kinder. Man darf den Kindern nichts unter dem Vorwand verheimlichen, sie seien noch zu klein, und es sei für sie noch zu früh, dies und jenes zu wissen. Welch ein trauriger, unglücklicher Gedanke! Und wie gut merken es die Kinder selbst, daß die Väter sie für zu klein und unverständig halten, während sie doch in Wirklichkeit alles verstehen! Die Erwachsenen wissen nicht, daß die Kinder selbst in den schwierigsten Angelegenheiten oft einen sehr guten Rat geben können. O Gott, wenn einen so ein hübsches Vögelchen vertrauensvoll und glücklich anblickt, da schämt man sich ja, es zu betrügen! Vögelchen nenne ich die Kinder, weil die Vögelchen das Schönste sind, was es auf der Welt gibt. Übrigens waren alle Leute im Dorfe namentlich wegen eines bestimmten Falles über mich aufgebracht... Thibaut aber beneidete mich einfach; am Anfang schüttelte er immer den Kopf und wunderte sich darüber, wie es zuging, daß die Kinder bei mir alles begriffen und bei ihm fast nichts, aber als ich ihm dann sagte, wir beide könnten sie nichts lehren, sondern umgekehrt sie uns, da lachte er mich aus. Und wie mochte er mich nur beneiden und verleumden, da er doch selbst im steten Umgang mit den Kindern lebte! Durch den Umgang mit Kindern aber wird die Seele gesund... Es war da im Schneiderschen Institute ein Patient, ein sehr unglücklicher Mensch. Sein Unglück war so furchtbar, daß es wohl kaum etwas Ähnliches gab. Er war zur Heilung von Geistesstörung eingeliefert worden; aber nach meiner Meinung war er nicht geistig gestört, sondern litt nur entsetzlich, und das war seine ganze Krankheit. Und wenn Sie nun wüßten, was für ihn zuletzt unsere Kinder wurden ... Aber von diesem Patienten will ich Ihnen lieber ein andermal erzählen; jetzt möchte ich erzählen, wie das alles anfing. Die Kinder liebten mich zuerst nicht. Ich war so groß und immer so unbeholfen; ich weiß, daß ich unschön bin... dazu kam endlich noch, daß ich Ausländer war. Die Kinder machten sich anfangs über mich lustig, und dann fingen sie sogar an, mit Steinen nach mir zu werfen, als sie gesehen hatten, daß ich Marie küßte. Ich habe sie aber nur ein einziges Mal geküßt... Nein, lachen Sie nicht!« schaltete der Fürst hastig ein, um das Lächeln seiner Zuhörerinnen zu unterbinden, »von Liebe war dabei ganz und gar nicht die Rede. Wenn Sie wüßten, was für ein unglückliches Geschöpf sie war, würden Sie selbst sie ebenso bemitleiden, wie ich es tat. Sie war aus unserem Dorf. Ihre Mutter war eine alte Frau, die in ihrem kleinen, ganz baufälligen, zweifenstrigen Häuschen das eine Fenster mit einer Art Ladentisch versehen hatte; aus diesem Fenster verkaufte sie mit Erlaubnis der Dorfobrigkeit Schnüre, Zwirn, Tabak, Seife, alles immer für ganz wenige Groschen, und davon lebte sie. Sie war krank: die Füße waren ihr dauernd geschwollen, so daß sie immer auf demselben Fleck sitzen mußte. Marie war ihre Tochter, zwanzig Jahre alt, schwächlich und mager; schon längst hatte bei ihr die Schwindsucht begonnen, aber trotzdem ging sie immer auf Tagelohn zu schwerer Arbeit in die Häuser – sie scheuerte die Fußböden, wusch Wäsche, fegte die Höfe und versorgte das Vieh. Ein durchreisender französischer Kommis verführte sie und nahm sie mit, ließ sie aber eine Woche darauf unterwegs im Stich und machte sich heimlich davon. Sich durchbettelnd kehrte sie wieder nach Hause zurück, ganz schmutzig, in Lumpen, mit zerrissenen Schuhen; sie war eine ganze Woche lang zu Fuß gewandert, hatte im Freien übernachtet und sich stark erkältet, ihre Füße waren wund, die Hände geschwollen und rissig. Übrigens war sie auch vorher nicht hübsch gewesen; nur die Augen waren still, gut und unschuldig. Sie war im höchsten Grade schweigsam. Einmal, noch vor jenem Vorfall, fing sie bei der Arbeit auf einmal an zu singen, und ich weiß noch, daß alle sich wunderten und zu lachen anfingen: ›Marie singt! Was denn? Marie singt!‹ Sie wurde schrecklich verlegen, und ihr Gesang verstummte dann für ihr ganzes Leben. Damals hatten die Leute sie noch freundlich behandelt, aber als sie krank und heruntergekommen zurückgekehrt war, da hatte niemand mit ihr auch nur das geringste Mitleid. Wie grausam die Menschen in solchen Fällen sind! Was für herzlose Anschauungen sie von solchen Dingen haben! Als erste empfing die Mutter sie mit Zorn und Verachtung: ›Du hast mich jetzt entehrt!‹ Sie war auch die erste, die sie der Schande preisgab: als man im Dorfe hörte, daß Marie zurückgekommen sei, da kamen alle eilig herbeigelaufen, um sie zu sehen, und fast das ganze Dorf versammelte sich in dem Häuschen der Alten: Greise, Kinder, Frauen, Mädchen, alle, alle, eine ungeduldige, gierige Menge. Marie lag hungrig und zerlumpt auf dem Fußboden zu den Füßen der Alten und weinte. Als alle herbeigelaufen kamen, bedeckte sie ihr Gesicht mit dem aufgelösten, wirren Haar und drückte es an den Boden. Alle Umstehenden betrachteten sie, als ob sie ein Scheusal wäre. Die alten Männer brachen den Stab über sie und schalten, die jungen Leute machten sich sogar über sie lustig, die Frauen schimpften auf sie und verdammten sie und sahen sie mit größter Verachtung an wie eine ekle Spinne. Die Mutter ließ das alles geschehen, saß selbst dabei, nickte mit dem Kopf und billigte diese Roheiten. Die Mutter war damals schon sehr krank und dem Tode nahe, zwei Monate darauf starb sie auch wirklich; sie wußte, daß sie bald sterben werde, wollte sich aber trotzdem bis zu ihrem Tode nicht mit ihrer Tochter versöhnen, sie redete sogar kein Wort mit ihr, jagte sie zum Schlafen auf den Flur hinaus und gab ihr fast nichts zu essen. Sie mußte ihre kranken Füße oft in warmes Wasser stellen; Marie wusch sie ihr alle Tage und pflegte die Mutter, aber diese nahm alle Dienstleistungen der Tochter schweigend hin, ohne ihr auch nur ein einziges freundliches Wort zu gönnen. Marie ertrug alles, und als ich dann später mit ihr bekannt wurde, nahm ich wahr, daß sie diese Behandlung sogar selbst für gerecht erachtete und sich selbst für das allerschlechteste Geschöpf hielt. Als die Mutter dauernd an das Bett gefesselt war, kamen die alten Frauen des Dorfes der Reihe nach zu ihr, um sie zu pflegen, das ist dort so Sitte. Nun bekam Marie überhaupt nichts mehr zu essen, im Dorfe aber jagten alle Leute sie fort, und nicht einmal Arbeit wollte ihr jemand geben wie früher. Alle behandelten sie wie eine Verworfene, und die Männer betrachteten sie gar nicht mehr als Frau, solche unflätigen Schimpfworte gebrauchten sie ihr gegenüber. Manchmal, indes nur sehr selten, warfen sie ihr, wenn sie sich sonntags betrunken hatten, spaßeshalber ein paar Groschen hin, einfach auf die Erde, und Marie hob sie schweigend auf. Sie fing schon damals an, Blut zu husten. Schließlich waren ihre Lumpen schon vollständig zu Fetzen geworden, so daß sie sich schämte, sich im Dorfe blicken zu lassen; barfuß ging sie schon seit ihrer Heimkehr. Da begann die ganze Kinderschar – es waren über vierzig Schulkinder – sie zu verhöhnen und sogar mit Schmutz nach ihr zu werfen. Sie bat den Hirten, er möge ihr erlauben, die Kühe zu hüten, aber der Hirt jagte sie weg. Da fing sie an, ohne seine Erlaubnis mit der Herde für den ganzen Tag hinauszuziehen. Da sie dem Hirten sehr viel Nutzen brachte und er dies bemerkte, trieb er sie nun nicht mehr fort und gab ihr manchmal die Überreste seines Mittagessens, Brot und Käse. Er hielt das für eine große Gnade seinerseits. Als die Mutter gestorben war, schämte sich der Pastor nicht, Marie in der Kirche vor allem Volk an den Pranger zu stellen. Marie stand, so wie sie war, in ihren Lumpen, am Sarge. Es hatte sich eine Menge Leute eingefunden, um zu sehen, wie sie weinen und hinter dem Sarge hergehen würde; da wandte sich der Pastor – er war noch ein junger Mann, und sein ganzer Ehrgeiz war, ein großer Prediger zu werden – an alle Anwesenden und zeigte auf Marie. ›Die ist es, die an dem Tode dieser achtenswerten Frau die Schuld trägt‹ (das war unwahr, da die Mutter schon seit zwei Jahren krank gewesen war), ›da steht sie vor euch und wagt nicht aufzublicken, weil Gottes Finger sie gezeichnet hat; da ist sie nun, barfuß und in Lumpen, ein abschreckendes Beispiel für diejenigen, die vom Pfade der Tugend abirren möchten! Und wer ist es? Es ist die eigene Tochter!‹ und in dieser Art immer weiter. Und denken Sie sich: diese Gemeinheit gefiel fast allen, aber... nun ereignete sich etwas Besonderes: die Kinder traten für Marie ein, denn zu dieser Zeit waren die Kinder alle schon auf meiner Seite und hatten Marie liebgewonnen. Das war so zugegangen. Ich wollte gern etwas für Marie tun; es war dringend nötig, daß ihr jemand Geld gab, aber Geld hatte ich dort nie auch nur eine Kopeke in meinem Besitz. Ich hatte eine kleine Brillantnadel, die verkaufte ich an einen Trödler, der in den Dörfern herumzog und mit alten Kleidern handelte. Er gab mir dafür acht Frank, obwohl sie gut vierzig wert war. Lange Zeit bemühte ich mich, Marie allein zu treffen; endlich begegneten wir einander außerhalb des Dorfes, an einem Zaun, auf einem Seitenpfad, der in die Berge führte, bei einem Baum. Dort gab ich ihr die acht Frank und sagte ihr, sie möchte damit sparsam umgehen, da ich nicht mehr hätte, und dann küßte ich sie und sagte, sie solle nicht denken, daß ich irgendeine unlautere Absicht hätte; ich hätte sie nicht etwa geküßt, weil ich in sie verliebt wäre, sondern weil sie mir sehr leid täte und ich sie gleich von Anfang an durchaus nicht für schuldbeladen, sondern nur für unglücklich gehalten hätte. Ich wollte sie gern gleich bei dieser Begegnung trösten und ihr deutlich machen, daß sie sich gar nicht für soviel schlechter als alle zu halten brauche, aber sie schien das gar nicht zu verstehen. Ich merkte das gleich, obwohl sie fast die ganze Zeit über schwieg und mit niedergeschlagenen Augen vor mir stand und sich furchtbar schämte. Als ich zu Ende war, küßte sie mir die Hand, und ich griff sofort nach der ihren und wollte sie ihr küssen, aber sie zog sie schnell weg. In diesem Augenblick erspähten uns auf einmal die Kinder, ein ganzer Schwarm; ich erfuhr später, daß sie mir schon lange nachspioniert hatten. Sie fingen an zu pfeifen, in die Hände zu klatschen und zu lachen, Marie aber lief eiligst davon. Ich wollte den Kindern etwas sagen, aber sie warfen nach mir mit Steinen. Noch an demselben Tage erfuhren alle, was vorgefallen war, das ganze Dorf; alle fielen sie wieder über Marie her und wurden ihr noch mehr feind. Ich hörte sogar, daß man vorhatte, sie zu einer Strafe zu verurteilen; indes ging das, Gott sei Dank, noch so vorüber. Aber dafür ließen ihr die Kinder gar keine Ruhe mehr, sie verhöhnten sie noch ärger als vorher und bewarfen sie mit Schmutz, sie jagten ihr nach, und sie floh dann vor ihnen mit ihrer schwachen Brust ganz außer Atem, und die Kinder schreiend und schimpfend hinter ihr her. Einmal begann ich sogar, mich mit ihnen herumzuschlagen. Dann versuchte ich mit ihnen zu reden und redete zu ihnen jeden Tag, sooft ich nur die Möglichkeit hatte. Manchmal blieben sie stehen und hörten zu, obwohl sie immer noch schimpften. Ich erzählte ihnen, wie unglücklich Marie sei; bald hörten sie denn auch auf zu schimpfen und gingen schweigend fort. Allmählich kam es dazu, daß wir miteinander Gespräche führten; ich verheimlichte ihnen nichts, sondern erzählte ihnen alles. Sie hörten sehr neugierig zu und begannen bald, Marie zu bemitleiden. Einzelne fingen an, wenn sie ihr begegneten, sie freundlich zu grüßen; es ist dort Sitte, wenn man einander begegnet, ob man sich nun kennt oder nicht, sich zu grüßen und ›Grüß Gott‹ zu sagen. Ich kann mir vorstellen, wie erstaunt Marie darüber war. Eines Tages verschafften sich zwei kleine Mädchen etwas Essen, trugen es ihr hin, gaben es ihr und kamen dann zu mir, um es mir zu sagen. Sie erzählten mir, Marie habe geweint, und sie hätten sie jetzt sehr lieb. Bald fingen alle an, sie liebzuhaben, und gleichzeitig auf einmal auch mich. Sie kamen nun oft zu mir und baten immer, ich möchte ihnen etwas erzählen; ich muß wohl gut erzählt haben, weil sie mir sehr gern zuhörten. In der Folgezeit lernte und las ich immer nur in der Absicht, es ihnen nachher zu erzählen, und so habe ich ihnen in den ganzen nächsten drei Jahren immer etwas erzählt. Als mir dann alle, auch Schneider, Vorwürfe darüber machten, daß ich mit den Kindern wie mit Erwachsenen spräche und ihnen nichts verheimlichte, antwortete ich ihnen, man müsse sich schämen, den Kindern etwas vorzulügen, sie erführen ja doch alles, wie sehr man es ihnen auch zu verbergen suche, und erführen es vielleicht auf eine häßliche Weise; wenn sie es aber von mir hörten, so sei das nicht der Fall. Ein jeder brauche sich nur an seine eigene Kindheit zu erinnern. Aber sie stimmten mir nicht bei ... Geküßt hatte ich Marie zwei Wochen vor dem Tode ihrer Mutter, und als der Pastor jene Leichenrede hielt, waren schon alle Kinder auf meiner Seite. Ich erzählte ihnen sofort, wie sich der Pastor benommen hatte, und sagte ihnen, wie ich darüber urteilte; alle waren sie empört, einige so sehr, daß sie ihm die Fenster einwarfen. Dies verbot ich ihnen, weil das nicht mehr recht war, aber im Dorfe hatte man sofort alles erfahren und beschuldigte mich nun, ich verdürbe die Kinder. Dann erfuhren auch alle, daß die Kinder Marie liebhatten, und bekamen einen gewaltigen Schreck; Marie jedoch fühlte sich schon ganz glücklich. Man verbot den Kindern, mit ihr zusammenzukommen; aber sie liefen heimlich zu ihr, nach dem ziemlich weit, fast eine halbe Werst vom Dorfe entfernten Weideplatz der Herde; sie brachten ihr dies und das zum Essen mit, manche aber liefen auch einfach hin, um sie zu umarmen, zu küssen und ihr zu sagen: ›Je vous aime, Marie!‹ und dann Hals über Kopf wieder zurückzurennen. Marie verlor infolge dieses unerwarteten Glückes fast den Verstand; so etwas hätte sie sich nie träumen lassen; sie schämte sich und freute sich zugleich. Besondere Freude machte es den zu ihr hinlaufenden Kindern und namentlich den kleinen Mädchen, ihr mitzuteilen, daß ich sie, Marie, liebte und sehr viel mit ihnen von ihr spräche.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der Idiot»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der Idiot» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der Idiot» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.