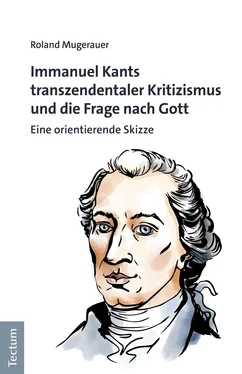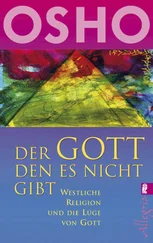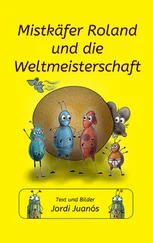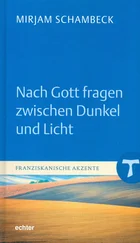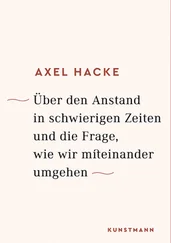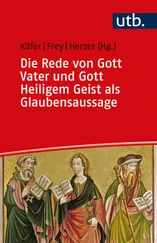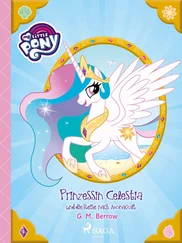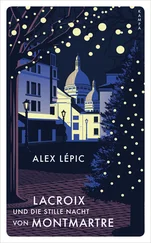Philosophiehistorisch wie systematisch ist die für Kants Transzendental-Philosophie grundlegende transzendentale Haupterkenntnis von besonderer Bedeutung, dass nicht das Objekt das Subjekt, sondern dass das Subjekt sein Objekt bestimmt. Nicht unsere Erkenntnis muss „sich nach den Gegenständen richten“, sondern „die Gegenstände müssen sich nach dem Erkenntnis richten“ (KrV B XVI) – so eine zentrale Formulierung der ‚kopernikanischen Wende‘ durch Kant selbst. Daher ist es unabdingbar, zu verstehen, wie Kant im Rahmen der Grundfrage: „Wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich?“ in ‚transzendentaler Inblicknahme‘ die ‚kopernikanische Wende‘ vollzieht vom Objekt zum Subjekt, und zwar zu den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis sowie zu den Grenzen möglicher Erkenntnis. Dies gilt gerade für die Erkenntnisgrenzen, die der menschlichen Vernunft im Blick auf philosophisch-metaphysische Gotteserkenntnis gesetzt sind.
Während Kant die Endlichkeit und Begrenztheit der menschlichen Erkenntnismöglichkeiten akzentuiert, näherhin ihre Beschränkung auf mögliche Erfahrung und bloße Erscheinung, geht es dem an Kant anschließenden deutschen Idealismus darum, die kantischen Geltungsbeschränkungen ‚aufzuheben‘ und unbedingte Gültigkeit für die Erkenntnis zurückzuerlangen. Es geht den Denkern des Idealismus um ‚absolutes Wissen‘. Die kantische Selbstbescheidung der metaphysischen Vernunft wird im Philosophieren des deutschen Idealismus gewissermaßen aufgegeben. In Sonderheit Hegel erhebt den höchstansprüchlichen metaphysikrestitutiven Versuch, sich in einer konstruktiven Metaphysik mittels einer spekulativen Dialektik zum Standpunkt Gottes selbst oder zum absoluten Wissen zu erheben. Bei Kant hingegen ist die unvermeidbare Dialektik der menschlichen Vernunft Ausdruck ihrer konstitutiven Endlichkeit und Begrenztheit. Will man Hegel beurteilen, muss man Kant verstanden haben. Dies gilt für die Denker und die Philosophien des deutschen Idealismus überhaupt.
Kants Philosophie kann als ‚Philosophie der menschlichen Endlichkeit‘ tituliert werden. Sein transzendentalkritisches Unternehmen, das die Möglichkeiten der (herkömmlichen ontologischen) Metaphysik und der ‚spekulativen‘ 7Vernunfterkenntnis (selbst)kritisch prüft, kann mahnen zu metaphysischer und epistemischer Selbstbescheidung. Um die Möglichkeiten von – kantianisierend gesprochen – „Metaphysik als Wissenschaft“ und näherhin einer philosophischen Theologie überhaupt angemessen ausloten zu können, ist eine Auseinandersetzung mit Kants Transzendental-Philosophie unverzichtbar, selbst wenn sie noch nicht ‚das letzte Wort‘ ist oder sein kann.
Von besonderer Bedeutung ist Kants Philosophie auch deshalb, weil seine transzendentale Vernunftkritik zumindest nahe legt, dass, entgegen Ansprüchen auf Überwindung ‚der‘ Metaphysik und von ‚Metaphysik-Verabschiedung‘ in der Gegenwartsphilosophie, der philosophierende Mensch bei aller Metaphysikkritik der Metaphysik als ernstes philosophisches Problem (und nicht nur als beliebiges Verlangen) nicht ‚entkommt‘ – und mit ihr gewissermaßen auch nicht der philosophischen Frage nach Gott. Dies schon aus Gründen der strukturellen Verfasstheit der menschlichen Vernunft. Gerade Kant, von Moses Mendelssohn (*1729; †1786) als ‚Alleszermalmer‘ der Metaphysik bezeichnet, begründet dann, nachdem er in der Kritik der reinen Vernunft die herkömmliche Metaphysica specialis als unmöglich erwiesen hat (als Wissenschaft), über die reine praktische Vernunft eine Art ‚Ethico-Metaphysik‘, in der auf dem Felde des Praktischen die altbekannten und zentralen metaphysischen Themen wieder auftauchen: Gott, Seele, Unsterblichkeit. 8
1.2 Kant und das Problem der Möglichkeit von Metaphysik und affirmativer Theologie
Kant, der den metaphysischen Ansprüchen kritisch gegenübersteht, behauptet selbst nie einfachhin den ‚Tod‘ der Metaphysik, wie sie ihm insbesondere als ontologische Metaphysik (metaphysica generalis) und als affirmative Theologie (metaphysica specialis) aus der Leibniz-Wolffschen Schulmetaphysik vertraut ist, (als Wissenschaft). Angesichts des beeindruckenden Fortschritts der neuzeitlichen Naturwissenschaft erscheinen ihm aber die dauernden Streitigkeiten der Philosophen ‚in metaphysicis‘ als Skandal. Es geht ihm deshalb darum, dieses Ärgernis mit seinen die Philosophie diskreditierenden Folgen zu beseitigen durch transzendentalkritische Prüfung der Frage, ob es Metaphysik überhaupt als Wissenschaft geben kann (und nicht nur als Naturanlage). Vor Augen hat er dabei die Ansprüche der herkömmlichen Metaphysica specialis als reine ‚spekulative‘ Wissenschaft.
Hinter Kants Auffassung und dann auch seiner ‚Architektonik‘ der Kritik der reinen Vernunft mit ihrer Zuordnung der Metaphysica specialis und ihrer Ein- und Zuordnung der Gottesfrage (rationale Theologie) steht die Leibniz-Wolffsche Schulmetaphysik mit ihrer philosophisch-systematischen Unterscheidung von Metaphysica universalis (oder generalis) und Metaphysica specialis – oder genauer: dreier ‚spezieller‘ Metaphysiken (rationale Psychologie, rationale Kosmologie, rationale oder natürliche Theologie). Denn in der neuzeitlichen Metaphysik wird die spezifisch aristotelische Einheit von Ontologie und Theologie 9gelöst im Sinne einer sehr weitgehenden Selbstständigkeit der (allgemeinen) Ontologie oder ‚allgemeinen Metaphysik‘ (metaphysica generalis (ens qua ens)), deren Untersuchungsgegenstand die allgemeinen Bestimmungen der Seienden und deren Systematik sind. Die Gottesfrage wird zugewiesen einem Bereich der ‚speziellen‘ Metaphysik (metaphysica specialis, näherhin: theologia naturalis (Gott als ens perfectissimum)). Während die metaphysica universalis (oder generalis) bei Kant zur Analytik des reinen Verstandes wird, werden die traditionellen Gegenstände der ‚speziellen Metaphysiken‘ zu den Untersuchungsgegenständen der ‚transzendentalen Dialektik‘ (s. dazu später). Bei Aristoteles gehört hingegen beides noch zusammen, insofern die Metaphysik in eins Metaphysica generalis und Metaphysica specialis ist.
Es geht Kant gerade darum, die Metaphysik, wenn möglich, in den ‚sicheren Gang einer Wissenschaft‘ zu versetzen. Das (Ideal-)Modell von Wissenschaft sind für Kant dabei Mathematik, näherhin Arithmetik und Geometrie, sowie Naturwissenschaft, näherhin Physik (seinerzeit als klassische Mechanik). Wenn Metaphysik als Wissenschaft möglich ist, so hat sie für Kant dieses normative Ideal strenger Wissenschaftlichkeit zu erfüllen, wie es Mathematik und Naturwissenschaft ihm repräsentieren. Im Sinn hat Kant hier vor allem die Erkenntnis dessen, was allgemein und notwendig gültig ist. Ist ‚Metaphysik‘ als Wissenschaft möglich, so hat sie, transzendentalkritisch verstanden und ‚gewendet‘, zum Inhalt Erkenntnis oder Wissen von allgemeiner sowie notwendiger Gültigkeit, und zwar Wissen, das a priori gilt. An der Beantwortung der Frage, ob und inwiefern es eine derartige Erkenntnis oder ein derartiges Wissen in metaphysicis gibt, entscheidet sich, ob und inwiefern Metaphysik aus transzendentalkritischer Perspektive als Wissenschaft möglich ist.
Die transzendentalkritische Prüfung Kants ergibt, dass Metaphysik im Sinne der tradierten affirmativen Metaphysica specialis nicht möglich ist, nicht zuletzt nicht möglich ist als Theologia naturalis, die den höchsten und ehrwürdigsten Gegenstand der Metaphysica specialis, Gott, behandelt. Gleichwohl aber restituiert Kant im Felde der praktischen reinen Vernunft dann gewissermaßen eine neue Form von Metaphysica specialis, nämlich eine ‚Metaphysica practica‘, die in ihren drei zentralen Themen: Gott, Seele, Unsterblichkeit, der überkommenen Metaphysica specialis entspricht, die er in ihren Ansprüchen destruiert und als unberechtigt erwiesen hat.
Über diese ‚Metaphysica practica‘ Kants geht, wie erwähnt, der deutsche Idealismus dann hinaus und unternimmt es, in gewisser und bestimmter Weise, die ‚alte‘ Metaphysik mit ihrem Gottesthema zu restituieren, indem er, seinem Selbstverständnis nach, ‚Kant über Kant hinausführt‘ und einen unbedingten Geltungshorizont wiedergewinnt. In gewisser Weise werden damit die alten Erkenntnisansprüche der Metaphysik und der philosophischen Theologie in der Behandlung der Frage nach dem Absoluten ‚reetabliert‘ – mit welchem Recht auch immer dies geschieht.
Читать дальше