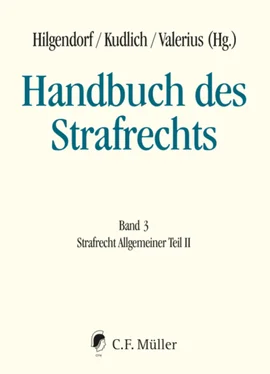12. Abschnitt: Täterschaft und Teilnahme
Inhaltsverzeichnis
§ 49 Strafbarkeit juristischer Personen
§ 50 Die Lehre von der Beteiligung
§ 51 Mittäterschaft
§ 52 Mittelbare Täterschaft
§ 53 Anstiftung
§ 54 Beihilfe
§ 55 Besondere persönliche Merkmale
12. Abschnitt: Täterschaft und Teilnahme› § 49 Strafbarkeit juristischer Personen
Martin Paul Waßmer
§ 49 Strafbarkeit juristischer Personen
A. Einführung1
B.Historischer Überblick2 – 19
I. Vom Altertum bis zum Beginn der Neuzeit2 – 4
II. Von der Aufklärung bis zu den Weltkriegen5 – 9
III. Die Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland10 – 19
C. Verantwortlichkeit von Verbänden im bisherigen Recht20 – 54
I.Verbandsgeldbuße (§ 30 OWiG)21 – 37
1. Entstehung, Zweck und Rechtsnatur21 – 27
2. Voraussetzungen der Festsetzung28 – 32
3. Bußgeldrahmen und Bußgeldzumessung33, 34
4. Verfahren und Vollstreckung35 – 37
II.Weitere Sanktionen und Maßnahmen38 – 54
1. Einziehung von Taterträgen (§§ 73 ff. StGB, § 29a OWiG)38 – 41
2. Mehrerlösabführung (§ 10 Abs. 2 WiStrG 1954)42, 43
3. Umsatzbezogene Geldbußen44, 45
4. Einziehung von Gegenständen (§ 74e StGB, § 29 OWiG)46, 47
5. Verwaltungsrechtliche Maßnahmen48 – 52
6. Registereinträge53, 54
D.Die Diskussion um die Einführung eines Verbandsstrafrechts55 – 125
I. Dogmatische Aspekte55 – 84
1. Handlungsfähigkeit56 – 59
2. Schuldfähigkeit60 – 78
a) Schuldgelöstes Strafrecht61
b) Schuld = nur Individualschuld62
c)Schuld = auch Verbandsschuld63 – 78
aa) Verschulden der Mitglieder63
bb) Originäres Organisationsverschulden64 – 69
cc) Zurechnung des Verschuldens70 – 78
3. Straffähigkeit79, 80
4. Doppelbestrafung81, 82
5. Kollektivbestrafung83, 84
II. Rechts- und kriminalpolitische Aspekte85 – 119
1. Internationales und europäisches Recht86 – 91
2. Auslandsrechte92, 93
3. Individualverantwortung94 – 100
a) Beweisnot und Verschleierung95, 96
b) Pflichten von Individualtätern und Zurechnungsstrukturen97, 98
c) Individualstrafandrohung und Freistellungsklausel99, 100
4. Verbandsverantwortung101 – 119
a) Sanktionsinstrumentarium102 – 106
b) Verfolgung und Verfolgungspraxis107 – 110
c) Rechtsschutz und richterliche Kontrolle111, 112
d) Gerichtsverfahren und Öffentlichkeit113, 114
e) Unrechts- und Schuldgehalt sowie Angemessenheit der Sanktion115
f) Strafrechtliches Risiko und gesellschaftliche Verantwortung116 – 118
g) Prozessuale Regelungen119
III. Konzeptionelle Aspekte120 – 124
1. Vicarious liability-Modell121
2. Maßregelmodelle122
3. Modell originärer Verbandsverantwortlichkeit123
4. Zurechnungs- oder Repräsentationsmodell124
IV. Zusammenfassung125
E.Zum Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs (2013)126 – 133
I. Konzept und Ausgestaltung126 – 129
II. Bewertung130 – 133
F.Zum Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes (2020)134 – 177
I.Konzept und Ausgestaltung134 – 159
1. Grundsätzliches134 – 137
2. Materiell-rechtliche Vorschriften138 – 150
3. Verfahrensvorschriften151 – 157
4. Verbandssanktionenregister158, 159
II. Bewertung160 – 177
1. Konzept161 – 164
2. Beseitigung von strukturellen Defiziten, insb. Verschärfung der Sanktionen165 – 171
3. Beseitigung von Anwendungs- und Vollzugsdefiziten, insb. Legalitätsprinzip172
4. Verfahrensvorschriften, insb. Berücksichtigung verbandsinterner Untersuchungen173 – 177
G. Fazit und Ausblick178
Ausgewählte Literatur
12. Abschnitt: Täterschaft und Teilnahme› § 49 Strafbarkeit juristischer Personen› A. Einführung
1
Strafen können im geltenden deutschen Recht nur gegenüber natürlichen Personen(Menschen) verhängt werden: „Societas delinquere non potest“. Gegen juristische Personen und Personenvereinigungenist bislang lediglich die Festsetzung einer Geldbuße nach § 30 OWiG vorgesehen ( Rn. 21 ff.), die als „Verbandsgeldbuße“ bezeichnet wird, mitunter auch, den Hauptanwendungsbereich kennzeichnend, als „Unternehmensgeldbuße“. Der Blick in die Geschichte ( Rn. 2 ff.) zeigt allerdings nicht nur, dass es in Deutschland früher Verbandsstrafen gab, sondern auch, dass schon sehr lange diskutiert wird, ob ein Verbandsstrafrecht (wieder) eingeführt werden soll. Diese Diskussion wird dogmatisch ( Rn. 55 ff.) sowie rechts- und kriminalpolitisch ( Rn. 85 ff.) geführt. Nach Schünemann [1] handelt es sich um das inzwischen „meistdiskutierte Problem der Wirtschaftskriminalität“, geht es doch um eine Schlüsselfrage des modernen Wirtschaftsstrafrechts. Gegenwärtig ist die Thematik erneut sehr aktuell, da Verbands- bzw. Unternehmensstrafrechte, ausgehend vom anglo-amerikanischen Rechtskreis, mittlerweile in fast allen EU-Staaten geschaffen wurden ( Rn. 92). Es überrascht daher nicht, dass bereits im September 2013 vom Land Nordrhein-Westfalen der Entwurf eines „Verbandsstrafgesetzbuchs“ (VerbStrG) vorgestellt wurde ( Rn. 17, 126 ff.). Mitte August 2019 legte das BMJV den ersten Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten (Verbandssanktionengesetz – VerSanG)“ vor ( Rn. 18), dem am 21. April 2020 der finale Referentenentwurf ( Rn. 19, 134 ff.) folgte.
12. Abschnitt: Täterschaft und Teilnahme› § 49 Strafbarkeit juristischer Personen› B. Historischer Überblick
B. Historischer Überblick
I. Vom Altertum bis zum Beginn der Neuzeit
2
Ob in der Römerzeit[2] der Satz „societas delinquere non potest“, der eine lange rechtskulturelle Tradition suggeriert, jemals galt, ist ungeklärt. Jedenfalls dürfte er kaum im heutigen Sinne verstanden worden sein, da dem römischen Recht das Konzept der juristischen Person fremd war. Überliefert sind Strafverfahren gegen die damals wichtigsten Verbände, die Provinzialstädte (municipii).
3
Aus der germanischen Frühzeit[3] sind Kollektivstrafen bekannt. Die Sippe, eine auf Blutsverwandtschaft beruhende Gemeinschaft, hatte auch rechtliche Bedeutung. Beging ein Angehöriger eine Straftat, konnte die Sippe des Opfers „Fehde“ gegen den Täter und dessen Sippe führen. Durch eine Ausgleichszahlung (Buße), welche die Sippe (i.d.R. in Form von Vieh) aufbringen musste, konnte auf die Fehde verzichtet bzw. diese beendet werden.
4
Im Mittelalter[4] gewannen zunehmend räumliche (Bauernschaften, Marktgenossenschaften, Land- und Stadtgemeinden) und personale Verbände (z.B. Bürgerverbände, Gilden, Zünfte) an Bedeutung. Die rechtlichen Grundlagen für die Bestrafung dieser Verbände, insb. mittels Geldstrafen, aber auch durch den Entzug von Privilegien, Reichsacht, Zerstörung und Eroberung, schufen die Lehrer des weltlichen und kirchlichen Rechts. Die Glossatoren nahmen an, dass es Personengesamtheiten gebe, die unabhängig vom Wechsel ihrer Mitglieder Träger von Rechten seien, und die Gesamtheit als solche zivil- und strafrechtlich verantwortlich sei. Die Kanonisten entwickelten das Konzept der juristischen Person, das durch eine von den Mitgliedern zu unterscheidende Rechtsfähigkeit, die „universitas“, charakterisiert war, der grds. die Delikts- und Straffähigkeit zugesprochen wurde. Dagegen vertrat Papst Innozenz IV auf dem Konzil von Lyon (1245) die Auffassung, die universitas sei handlungs- und deliktsunfähig und damit für weltliche und geistige Strafen unempfänglich („nihil potest facere dolo“; „impossible est quod universitas delinquat“). Nachfolgend bejahten allerdings einflussreiche Postglossatoren die Straffähigkeit. So unterschied Bartolo da Sassoferrato (1313–1357) zwischen eigentlichen Körperschaftsdelikten (delicta propia), bei denen die universitas Täter und das Mitglied Mittäter oder Anstifter ist, und uneigentlichen Körperschaftsdelikten (delicta impropia), bei denen dies umgekehrt sein sollte. Diese Auffassung wurde auch in Deutschland rezipiert. Man erkannte zwar, dass eine kollektive Bestrafung ungerecht sein konnte, und bemühte sich, Unschuldige (Kinder, Greise, Unzurechnungsfähige) freizustellen, dennoch bestanden Bestimmungen über die Bestrafung von Städten, Gemeinden, Gilden und Zünften wegen politischer bzw. wirtschaftlicher Delikte. So enthielt die Reichskammergerichtsordnung von 1555 Vorschriften über das Verfahren gegen Gemeinden wegen Landfriedensbruchs. Diese Verfahren wurden bis ins 18. Jahrhundert geführt.
Читать дальше