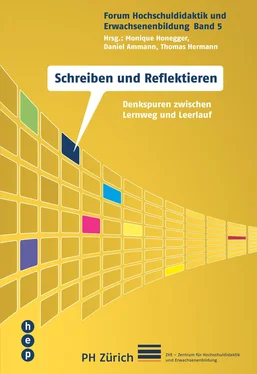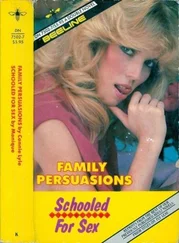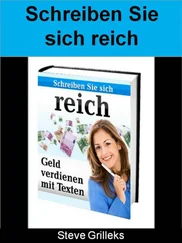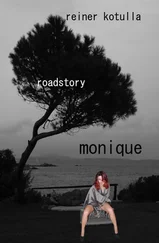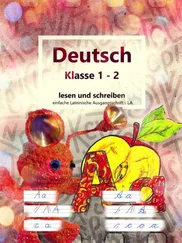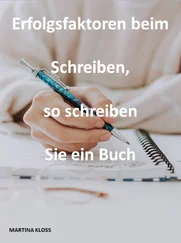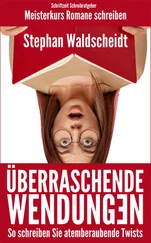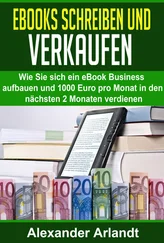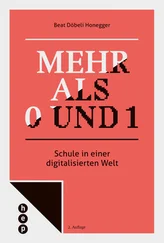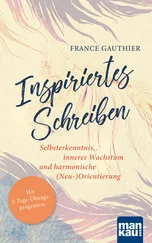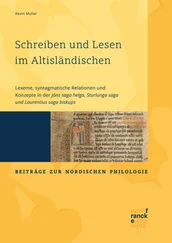Indem Studiengänge eine große Quantität geschriebener Reflexionen verlangen, bewirken sie in Studierenden bisweilen paradoxerweise das, was sie durch die Reflexion eigentlich verhindern wollten. Lernende erleben aufgrund der Vielzahl von schriftlichen Leistungsnachweisen, des Leistungsdrucks und des Produktionsdrucks Reflexionen nicht als hilfreiches persönliches Abbilden von inneren Prozessen oder innerem Suchen. Weil Reflexion Teil der Lernaufgabe ist, in der die Dozierenden die innere Involviertheit der Studierenden überprüfen, erfahren die Lernenden Reflexionen eher als erzwungene »Testimonials«, in denen sie – um den Leistungsnachweis, die ECTS-Punkte zu erhalten – bekunden müssen, persönlich involviert zu sein.
Der Zwang zur Reflexion führt somit zu einer »Anti-Reflexion«. Anstatt wahrer Erkenntnisse werden Bekenntnisse geschrieben, die wenig mit inneren Prozessen zu tun haben.
Die Dozierenden ihrerseits gewöhnen sich daran, Bekenntnisse und nicht vielleicht auch kritische, subjektive Irrwege, Zweifel, wir nennen sie jetzt mal Erkenntnisse, zu lesen. Durch diese Verfremdung entsteht im Studienkontext eine spezifische Textform von Reflexionen. Solche Texte sind randvoll mit Hinweisen dazu, dass »wirklich viel gelernt wurde und es unglaublich spannend und interessant war und alles, was folgen wird, mit großer Freude und Lernlust erwartet wird«.
Ambivalenz zwischen Lust und Zwang
Die Ambivalenz zwischen Lust und Zwang, die mit jeder Reflexion verbunden ist, lässt sich nicht auflösen. Drei didaktische Paradigmen für erfolgreiches Reflektieren beim Schreiben könnten so lauten:
▸Dozierende wissen, dass Reflexion schnell als Zwang erlebt wird. Schreibenmüssen kann das Erleben von Zwang verstärken. Das muss nicht negativ sein.
▸Dozierende veranlassen lustvoll erlebte Reflexion, indem sie diese freiwillig empfehlen. Schreibendürfen kann lustvoll erlebt werden.
▸Reflexion und Schreiben dosiert und gezielt einsetzen (vgl. den Beitrag von Keller in diesem Band).
Tradition zwischen Bekenntnis und Erkenntnis
Das Bekenntnis müssen wir ablegen, und die Erkenntnis dürfen wir verkünden. Reflektieren übers Lernen besteht darin, auf eigene Lücken oder fehlende Kompetenzen hinzuweisen (Bekenntnis). Erkenntnisse sind dann Teil des Lernens, wenn wir auf gefüllte Lücken oder neu erworbene Einsichten oder Kompetenzen hinweisen. Das Schreiben kennt sowohl die rhetorische Tradition des Bekenntnisses als auch diejenige der Erkenntnis. Beide Zugänge können erfolgreich sein, aber sie können auch zementieren und sowohl Lehrenden als auch Lernenden als rhetorische Hülsen dienen.
▸Dozierende wissen um den Unterschied zwischen Bekenntnis und Erkenntnis und arbeiten mit beiden Anlagen.
▸Studierende üben sich in beiden Formen. Bekenntnisse verfassen sie eher für bewertende Dozierende, Erkenntnisse für Peers (vgl. den Beitrag von Zimmermann & Rickert in diesem Band).
Bilanz der Dimensionen des schriftlichen Reflektierens
Abschließend seien die Dimensionen des schriftlichen Reflektierens nochmals in der Übersicht aufgezählt:
▸Reflektiert wird im Studium, um zu lernen und um bewusstes Reflektieren für ein Weiterlernen nach dem Studium zu etablieren.
▸Schreiben und Reflektieren intensiviert das Erleben von Lust und Zwang beim Lernen, weil Schreiben in formellen Kontexten die innere Affektwahrnehmung verstärkt (vgl. Honegger 2015).
▸Reflektieren geht auch ohne Schreiben oder anders (vgl. die Beiträge von Keller sowie Honegger & Beglinger und Nyffenegger in diesem Band).
▸Schriftliche Lernaufgaben, die in einem Zuviel des Schreibens im Studium zum Reflektieren anleiten, können auf vier Aspekte hin überprüft werden:
(1)Ist ein Publikum für die Reflexion, sind Leser/-innen nötig, um zu lernen?
(2)Wenn ja, sollen es Peers oder Dozierende sein?
(3)Ist eine Beurteilung/Bewertung der Reflexion nötig, um zu lernen?
(4)Ist erzwungenes Schreiben fürs effektive Reflektieren nötig, um zu lernen?
Literatur
Beck, Erwin, Titus Guldimann und Michael Zutavern. 2000. »Eigenständiges Lernen fördern: Metakognition im Unterricht.« In Beiträge zur gymnasialen Bildung: Wissensvermittlung und Methodenkompetenz, hrsg. v. Hessischen Landesinstitut für Pädagogik, 51–93. Wiesbaden: Hessisches Landesinstitut für Pädagogik.
Berning, Johannes, Berthold Seibt, Kordula Schulze und Annika Witte. 2008. Journalschreiben – Wege zum schreibenden Denken. Berlin: LIT.
Bräuer, Gerd. 2003. Schreiben als reflexive Praxis: Tagebuch, Arbeitsjournal, Portfolio. 2., unveränd. Aufl. Freiburg im Breisgau: Fillibach.
Bräuer, Gerd. 2014. Das Portfolio als Reflexionsmedium für Lehrende und Studierende. UTB 4141. Opladen: Budrich.
Bräuer, Gerd und Kirsten Schindler, Hrsg. 2011. Schreibarrangements für Schule, Hochschule, Beruf. Freiburg im Breisgau: Fillibach.
Dreyfürst, Stefanie und Nadja Sennewald, Hrsg. 2014. Schreiben: Grundlagentexte zu Theorie, Didaktik und Beratung. Opladen: Budrich.
Fakultative Lernaufgabe Bildung und Erziehung Ques. PH Zürich. Zugriff 9.9.2015. https://stud.phzh.ch/globalassets/stud.phzh.ch/primar_studiweb/quest/quest-3-2015f/e-lernjournal-quest-edk_150210.pdf
Hayes, John. (1996) 2014. »Kognition und Affekt beim Schreiben: Ein neues Konzept.« In Schreiben: Grundlagentexte zu Theorie, Didaktik und Beratung, hrsg. v. Stephanie Dreyfürst und Nadja Sennewald, 57–86. Opladen: Budrich.
Honegger, Monique, Hrsg. 2015 (im Druck). Schreiben und Scham: Wenn ein Affekt zur Sprache kommt. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Keller, Stefan. 2014. »E-Portfolios als Lern- und Prüfungsinstrumente in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung.« Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung 32 (1): 101–119.
Klotz, Peter. 1996. Grammatische Wege zur Textgestaltungskompetenz. Theorie und Empirie. Germanistische Linguistik, 171. Tübingen: Niemeyer.
Miskovic, Jeanina. 2006. »Das Lernpotential von reflexivem Schreiben in der Lehrer-Innenausbildung.« Zeitschrift Schreiben, 9. Juni, 1–5. Zugriff 8.5.2015. www.zeitschrift-schreiben.eu/2006/miskovic_Portfolio.pdf.
Saxalber, Annemarie und Ursula Esterl, Hrsg. 2010. Schreibprozesse begleiten: Vom schulischen zum universitären Schreiben. Innsbruck: StudienVerlag.
Corinne Wyss und Daniel Ammann Rundum reflektieren Von der praktischen Erfahrung zum planvollen Handeln
In den letzten Jahren sind zahlreiche Aufsätze, Untersuchungen und Ratgeber erschienen, die Reflexion im Lehrberuf thematisieren. Sowohl in der Empirie als auch in der Praxis hat Reflexion an Bedeutung gewonnen. Aus verschiedenen Publikationen geht jedoch hervor, dass das Konzept von Reflexion trotz seiner Popularität noch unscharf definiert ist (vgl. z.B. Williams & Grudnoff 2011, 281; Marcos, Sanchez & Tillema 2011, 22; Rodgers 2002, 842). Unsere Ausführungen sollen zur Klärung des Begriffs beitragen und die Absichten und Ziele aufzeigen, die mit Reflexion in der Unterrichtspraxis verbunden werden. Als Instrument für die (hochschul-)didaktische Praxis entwerfen wir ein handlungsleitendes Modell und legen Gelingensbedingungen professioneller Reflexion dar.
Absichtsvolles Üben
Übung macht zwar den Meister und die Meisterin, verspricht eine bekannte Redensart, aber langjährige Erfahrung allein garantiert noch keinen Lernfortschritt. Routine kann sogar hinderlich sein, wenn Fertigkeiten und Handgriffe zwar automatisiert, aber nicht überprüft und optimiert werden. Erst im Zusammenspiel zwischen kritischer Selbstevaluation und externem Feedback wird Entwicklung angestoßen. In der Reflexion richtet sich der Blick zum Beispiel auf ausgewählte Vorkommnisse oder Stolpersteine und kann in der Analyse Muster oder Strategien zutage fördern, die bisher nicht hinterfragt wurden und nur unter bestimmten Voraussetzungen zum erwünschten Ziel führen. Kritisches und wertschätzendes Feedback, sowohl von Peers als auch von erfahrenen Mentorinnen und Mentoren, unterstützt diesen Prozess durch Leitfragen, Anregungen, Übungsaufträge und abgestimmten fachlichen Input. Eine Aufgabe dieses Settings ist die Komplexitätsreduktion, denn der Novize oder die Novizin ist noch nicht mit allen Faktoren vertraut und kann den Blick nicht gleichzeitig und von Anfang an auf alle Ebenen richten.
Читать дальше