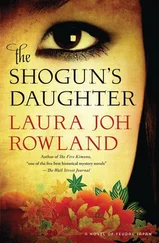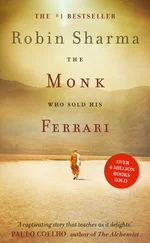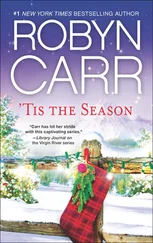Das Spannungsverhältnis von Neutralitätsforderungen, Werturteilen und der narrativen Struktur historischen Denkens ist Gegenstand des Betrags von Jörn Rüsen. In seiner Argumentation tritt er von der Frage, ob Lehrkräfte im Geschichtsunterricht ihre Meinung sagen dürfen, zunächst zurück und wendet sich einer theoretischen Bestimmung geschichtlichen Wissens und seiner Vermittlung zu. Konfrontiert mit dem Sachverhalt, dass Geschichtsschreibung vergangenen Geschehnissen Sinn zuschreibt, geht Rüsen der Verwicklung dieses Wissens mit Werturteilen in Auswahl, Präsentation und Erzählform nach. Die Multiperspektivität als Prinzip des Unterrichts und die Idee einer Autonomie der historischen Urteilsbildung von Schüler_innen seien pädagogische Antworten auf die wertbedingte Struktur geschichtlichen Wissens. Problematisch werde die Multiperspektivität dem Autor zur Folge aber dann, wenn diese mit ethnozentrischen Deutungsmustern konfrontiert werde, die antipluralistisch sind. Ausgehend von diesem Problemaufriss entwickelt Rüsen die Idee einer pluralistischen und auf dem Gedanken der Menschwürde basierenden »Leitkultur«, in der Geschichtsschreibung sich durch Diskursfähigkeit, qualitative Begründungskriterien und Selbstreflexivität auszeichnen müsse. Rüsen argumentiert so für eine Verlagerung der Frage vom Was auf das Wie des Erzählens in seinen geschichtspädagogischen Überlegungen.
Benedikt Widmaier beschäftigt sich in seinem Beitrag mit der historischen Genese und kontemporären gesellschaftspolitischen Rolle des Leitbilds einer wehrhaften Demokratie. Ausgehend von einer historischen Rekonstruktion der Idee einer wehrhaften oder auch streitbaren Demokratie in den 1950er-Jahren entwickelt er eine Kritik der politischen und pädagogischen Funktion und Nutzung dieses Leitbilds, welches sich – so seine Argumentation – als latent anachronistische Orientierungsvorgabe nicht mehr als Grundlage für eine zeitgemäße politische Bildung eigne.
Dorothee Gronostays Beitrag analysiert theoretische Rahmungen und empirische Befunde zur Frage der Offenlegung politischer Ansichten von Lehrpersonen. Dabei wird die Offenlegungsfrage als professionelle und berufsethische Entscheidung von praktizierenden Lehrkräften verstanden, die Abwägungen erforderlich macht. In ihrem Beitrag diskutiert sie diese Frage ausgehend von einschlägigen empirischen Befunden, professionsethischen Überlegungen zum Lehramt als politischem Beruf und der hierfür zentralen Unterscheidung zwischen Parteinahme und Parteilichkeit.
Ausgangspunkt des Beitrags von Thomas Goll ist die inhaltliche Unterbestimmtheit und geringe Ergiebigkeit des Kontroversitätsgebots in der Beutelsbacher Version für fachdidaktische Fragestellungen. Dies Gebot könne – unprofessionell angewandt – problematische Einstellungen der Ratlosigkeit bis hin zur Politikverdrossenheit bei Schüler_innen hervorbringen, wenn etwa im Politikunterricht Positionen beliebig nebeneinander aufgereiht werden und ohne sachlichmethodische Behandlung bleiben. Gleichwohl verteidigt Goll die Ansicht, dass Kontroversität einen Beitrag zu einem gelingenden und guten Politikunterricht leisten kann, wenn dieses Gebot als ein diskursives Legimitationsprinzip reformuliert wird, das an einem fachdidaktischen Kriterium orientiert ist. Mit der Rückbindung an das fachdidaktische Kriterium sollen Entscheidungen über im Unterricht behandelte Positionen und Kontroversen der professionellen fachdidaktischen Expertise der Lehrkräfte zugewiesen werden, die ihren Unterricht wissenschaftsorientiert gestalten und die Bildung politischer Mündigkeit fördern müssen.
Im folgenden dritten Teil geht Christina Brüning aus von einer im schulischen und universitären Betrieb wahrnehmbaren Verunsicherung bezüglich der Akzeptabilität von Äußerungen und Kontroversen bei Schüler_innen, Studierenden und Lehrkräften als Folge eines Rechtsrucks der politischen und medialen Landschaft seit 2010. In ihrem Beitrag führt sie diese Verunsicherungen auf eine Fehldeutung und einen Missbrauch des Beutelsbacher Konsenses zurück, der als rechtliche Grundlage insbesondere von der AfD fehlinterpretiert werde, um Einfluss auf die unterrichtlichen Inhalte zu gewinnen. Diese Strategie sei deswegen erfolgreich, weil die historische Genese des Beutelsbacher Konsenses und dessen demokratische Orientierung selbst bei Fachkräften oftmals unbekannt sind. Mit Hilfe einer historischen Kontextualisierung des Konsenses weist sie auf die demokratische und menschenrechtliche Fundierung der historisch-politischen Bildung in der Schule hin, die in einer Demokratie nicht wertneutral sein könne. Zur pädagogisch-praktischen Orientierung erläutert sie Argumentations- und Handlungsoptionen im Umgang mit rechtsextremistischen, menschen- und wissenschaftsfeindlichen Aussagen anhand von Beispielen aus dem Geschichtsunterricht und aktuellen politischen Konflikten.
Für eine Didaktik des kritischen Denkens spricht sich David Lanius in seiner wissenschaftstheoretisch gestützten Beschäftigung mit Fake News, Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen aus. Mit einer Relationierung dieser Begriffe hinsichtlich der Fragen von Wahrheit vs. Lüge, Wahrhaftigkeit vs. Täuschungsversuch oder der Negation jedes Wahrheitsanspruchs – Bullshit – arbeitet er Kriterien für begriffliche Unterscheidungen heraus und entwickelt einen Rahmen für pädagogische Überlegungen zur Vermittlung von epistemischen und demokratischen Argumentationskompetenzen. Er konstatiert einen Zusammenhang zwischen der Komplexität des Wissens- und Wahrheitsbegriffs und der Wirkmächtigkeit und Gefährlichkeit von Fake News und Verschwörungstheorien und skizziert Vorschläge für die Auseinandersetzung mit demokratiefeindlichen Entwicklungen. Der weitestgehende Vorschlag von Lanius ist die Einführung eines eigenständigen Unterrichtsfachs für Kritisches Denken, in dem neben wissenschaftstheoretischen Begriffen und Einsichten, metakognitiven Kompetenzen und Medienkritikfähigkeit auch demokratische Handlungskompetenz gefördert werden sollten.
Ausgehend von schulpädagogischen und bildungstheoretischen Argumentationen zum Neutralitätsgebot kritisieren Christoph Haker und Lukas Otterspeer Forderungen der AfD nach einer »Neutralen Schule«. Die Meldeportale der AfD werden von den Autoren als Einschränkungen der Autonomie der Schule und des Unterrichts kritisiert, die Verunsicherungen schüren und Bildungsprozesse behindern sollen. Auf der Basis eines sozialtheoretischen Unterrichtsverständnisses kritisieren die Autoren Forderungen nach Unabhängigkeit und Distanziertheit, weil diese eine »teilnahmslose Haltung« der Lehrkräfte propagieren. Für eine demokratische Gesellschaft und eine entsprechende Streitkultur bedarf es aus ihrer Sicht einer »engagierten, subjektiven, parteiischen und involvierten« Lehrer_innenpersönlichkeit, die ihre Meinung sagen soll. Dem Problem der Überwältigung begegnen sie mit einer auf Foucaults Machttheorie rekurrierenden »Orientierungskategorie« der »bedingten Autonomie«, mit der sie die Bedingungen des Wie der Positionierung seitens der Lehrkraft formulieren. Sie sprechen sich dafür aus, Interaktionen im Unterricht als »Machtspiele« zu interpretieren, zur Selbstreflexion aufzufordern, Schüler_innen immer schon Autonomie zuzusprechen und ihnen so Gelegenheiten zu bieten, Formen der Wissensvermittlung zu hinterfragen und sich selbst zu positionieren.
Subin Nijhawan setzt sich in seinem provokant gehaltenen Essay mit der Frage auseinander, ob und inwieweit es sich um eine zu beanstandende Überwältigung im Sinne des Beutelsbacher Konsenses handelt, wenn Jugendliche angesichts unbestreitbarer globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel aufgefordert werden, sich in aktiver politischer Absicht zu engagieren. Er diskutiert die damit verbundenen Fragen nach der angemessenen und legitimen Rolle von Lehrkräften ausgehend von der Vorstellung des Projekts The Blue Planet und im Rahmen einer Konzeption von Bildung für nachhaltige Entwicklung, um so neue Perspektiven auf den Beutelsbacher Konsens zu eröffnen.
Читать дальше