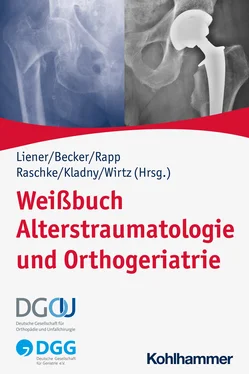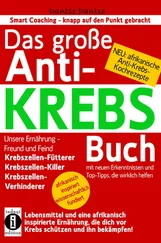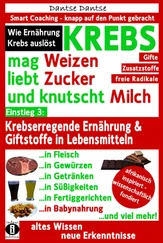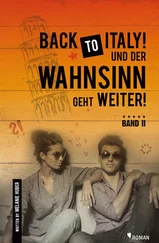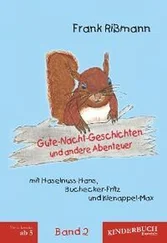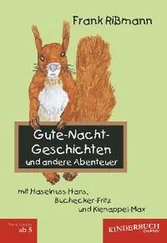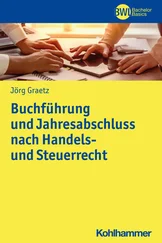Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie
Здесь есть возможность читать онлайн «Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Situation des neuen Weißbuchs Alterstraumatologie und Orthogeriatrie beschreibt somit den Aufbruch in eine neu strukturierte Versorgung, die zusammen mit der Reorganisation der Notaufnahmen zu einer nachhaltigen Veränderung des deutschen Krankenhaussystems führen wird. Es gibt noch viele offene Fragen. Die hohen Strukturvoraussetzungen des G-BA müssen refinanziert werden. Die Umstellung von einem 5-Tage-Angebot auf ein 7-Tage-Angebot der interdisziplinären Behandlung sind mit weiteren erheblichen Kosten verbunden. Eine große Herausforderung für die Krankenhausträger ist die Umsetzung dieser Vorgaben.
In Deutschland werden derzeit mehr als 450.000 Patienten mit Fragilitätsfrakturen stationär behandelt. Eine vergleichbar große Anzahl an Patienten wird darüber hinaus mit orthopädischen Erkrankungen im Alter von mindestens 80 Jahren oder älter als 70 Jahren mit einem geriatrischen Multimorbiditätsprofil stationär betreut. Wesentlicher Unterschied zu alterstraumatologischen Patienten ist bei orthogeriatrischen Patienten in der Regel das Fehlen einer notfallmäßigen Behandlungsnotwendigkeit, so dass insbesondere bei planbaren Eingriffen ein präinterventioneller Zeitraum besteht. Gerade dieser sollte und muss multiprofessionell genutzt werden, um die perioperative Komplikationsrate zu senken und das Outcome zu verbessern.
Bis dato sind jedoch die strukturelle Organisation und die hiermit verbundenen Prozesse für planbare orthopädische Eingriffe noch nicht optimal auf die orthogeriatrischen Herausforderungen vorbereitet. Die Gesundheitspolitik und die Leistungsträger legen – zu Recht – großen Wert auf die Qualität der Versorgung. Die prä-, intra- und postoperative Versorgung der hochaltrigen Patienten setzt eine koordinierte und verzahnte Behandlung von Orthopädie und Unfallchirurgie, Anästhesie, Geriatrie und Bereichen wie Pflege- und Therapieberufe voraus.
Das neuaufgelegte Weißbuch setzt sich zum Ziel, die Strukturen und Prozesse in der Alterstraumatologie fortzuschreiben und für die orthogeriatrischen Patienten erstmalig zu definieren.
Es geht darum, bis 2025 überall interdisziplinäre und interprofessionelle Einheiten zu schaffen, die die Stärken sämtlicher Teammitglieder gegenseitig anerkennen und fördern. Bei der Diskussion ist zu bedenken, dass die gegenwärtige Bewertung durch die DRG-Systematik diese Prozesse nur teilweise im Rahmen der frührehabilitativen Komplexbehandlung abbildet. So werden derzeit nur knapp 50 % der Patienten über das Merkmal einer frührehabilitativen Komplexbehandlung korrekt erfasst.
Bei praktisch allen älteren Patienten wird die Behandlung nicht mit der Entlassung aus dem Akutbereich oder der stationären Rehabilitation abgeschlossen sein. Die ambulante Weiterbehandlung weist erhebliche Defizite und Lücken auf. Dies betrifft die konsequente Erfassung und die Behandlung der Osteoporose zur Sekundärprävention ebenso wie eine konsequente Sturzprävention. Bei der Verbesserung der Schnittstellen steht Deutschland immer noch am Anfang.
Vor diesem Hintergrund enthält das neuaufgelegte Weißbuch eine Zusammenfassung der prä- peri- und postoperativen Phase. Der Stand der Wissenschaft wird in einer auch für Nichtmediziner verständlichen Sprache zusammengefasst.
Stuttgart, Münster, Bonn und Herzogenaurach, im Herbst 2021
Ulrich Christoph Liener, Clemens Becker, Kilian Rapp,
Michael J. Raschke, Bernd Kladny, Dieter Christian Wirtz
1Zugunsten einer lesefreundlichen Darstellung wird in diesem Herausgeberwerk bei personenbezogenen Bezeichnungen in der Regel die männliche Form verwendet. Diese schließt alle Geschlechtsformen ein (weiblich, männlich, divers).
I Einführung in die Alterstraumatologie
1 Epidemiologie und Kosten osteoporotischer Frakturen in Deutschland
2 Evidenz für orthogeriatrisches Co-Management nach proximalen Femurfrakturen
1 Epidemiologie und Kosten osteoporotischer Frakturen in Deutschland
Kilian Rapp, Dietrich Rothenbacher und Hans-Helmut König
Die bedeutsamsten osteoporotischen Frakturen treten am Oberarm, Unterarm, den Wirbelkörpern, dem Becken und der Hüfte auf. Sie sind ganz überwiegend ein Problem des höheren und sehr hohen Alters. Allerdings unterscheiden sich die einzelnen Frakturtypen bezüglich ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung. So werden z. B. handgelenksnahe Frakturen sehr häufig bei noch relativ jungen Frauen zwischen 50 und 70 Jahren beobachtet, während Frakturen der Hüfte oder des Beckens bei beiden Geschlechtern typische Frakturen des hohen und sehr hohen Alters sind. Dies spiegelt sich auch in den typischen »Frakturbiografien« wider, in denen auf zunächst weniger dramatische Frakturen mit zunehmendem Alter funktionell immer folgenreichere Frakturen auftreten. So hatte z. B. mindestens die Hälfte der Personen mit einer Hüftfraktur zuvor eine andere osteoporotische Fraktur erlitten.
Im Jahr 2019 wurden nach der offiziellen Statistik des Bundes etwa 431.000 Personen über 65 Jahre aufgrund einer Fraktur am Oberarm, Unterarm, den Wirbelkörpern, dem Becken und der Hüfte behandelt. Hüftfrakturen führten mit 39 % am häufigsten zu einer stationären Behandlung. Allerdings werden Frakturen des Unterarms oder der Wirbelkörper häufig nicht stationär, sondern ambulant behandelt, und deshalb – zieht man nur die Krankenhausstatistik zu Rate – deutlich unterschätzt. Valide Daten für die Krankheitslast aller osteoporotischer Frakturen liegen für Deutschland nicht vor. Für Europa wird geschätzt, dass etwa 30 % der Frakturen auf die Hüfte, 28 % auf den Unterarm, 24 % auf die Wirbelkörper und 12 % auf den Oberarm entfallen (Johnell und Kanis 2006).
Merke:
Die Hüftfraktur ist die am häufigsten im Krankenhaus behandelte Fraktur.
In Deutschland finden sich 3 von 4 der osteoporotischen Frakturen bei Frauen. Dies liegt zum einen an einem generell erhöhten Frakturrisiko, zum anderen aber auch an einer höheren Lebenserwartung. Bei Frauen beträgt das Lebenszeitrisiko in Deutschland für eine der hauptsächlichen osteoporotischen Frakturen (Hüfte, Unterarm, Wirbelkörper, proximaler Humerus) im Alter von 50 Jahren circa 35 %, bei Männern 20 %. Die rohe Inzidenz bei Männern und Frauen im Alter von 50 Jahren oder darüber in Deutschland betrug im Jahr 2017 23 pro 1.000 Personen und war damit nach Schweden die zweithöchste in Europa (Borgström et al. 2020).
Merke:
Etwa jede dritte 50-jährige Frau und jeder fünfte 50-jährige Mann wird im Laufe des Lebens eine osteoporotische Fraktur erleiden.
Da das Frakturrisiko mit dem Alter zunimmt, ist aufgrund der demografischen Alterung unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren auch mit einer Zunahme osteoporotischer Frakturen zu rechnen. Wenn man davon ausgeht, dass sich das alters- und geschlechtsspezifische Risiko, eine Fraktur zu erleiden, in den nächsten Jahrzehnten nicht ändert, so ist bis 2030 bzw. 2050 mit einer Zunahme der Frakturen um 21 % bzw. 57 % zu rechnen (eigene Hochrechnung). Bei Hüftfrakturen muss bis 2050 sogar mit einer Zunahme von circa 70 % ausgegangen werden, sollte es nicht gelingen, das Frakturrisiko deutlich zu senken. Das wiegt deshalb besonders schwer, da die Hüfte die Frakturlokalisation ist, die sowohl funktionell als auch finanziell die weitreichendsten Folgen hat. Deshalb soll hier auf diesen Frakturtyp etwas ausführlicher eingegangen werden.
Für Deutschland liegen gute Daten für die Inzidenz von Hüftfrakturen vor (Icks et al. 2008). Während es in mehreren anderen Industrieländern in den letzten 10 Jahren zu einem Rückgang der altersspezifischen Frakturrate kam (Cooper et al. 2011), ist dies für Deutschland bisher noch nicht zu verzeichnen (Icks et al. 2013). Ein besonders hohes Risiko für Hüftfrakturen haben Personen, die bereits pflegebedürftig sind, unabhängig davon, ob sie zuhause oder im Pflegeheim leben. So verursachen 12 % der Personen über 65 Jahre, die Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, etwa die Hälfte aller in Deutschland auftretenden Hüftfrakturen (Rapp et al. 2012). Für Pflegeheimbewohner verfügt Deutschland über die derzeit weltweit besten Inzidenzdaten (Rapp et al. 2008; Rapp et al. 2012). So sind z. B. jährlich 3 bis 4 Hüftfrakturen pro 100 Bewohnerplätze zu erwarten. Werden Bewohner zeitlich ab ihrer Aufnahme ins Pflegeheim beobachtet, so ist die Anzahl noch höher. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass das Risiko einer Fraktur in den ersten Monaten in der neuen Umgebung erheblich erhöht ist (Rapp et al. 2008).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeriatrie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.