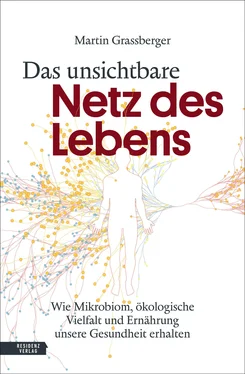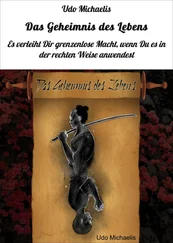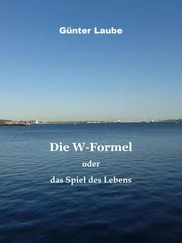Untersuchungen an dem Jäger- und Sammler-Volk der Hadza in Afrika haben vor Kurzem gezeigt, dass deren tägliches Inaktivitätsniveau durchaus mit dem von Menschen aus modernen Industrienationen vergleichbar ist. Allerdings, und hier liegt der gravierende Unterschied, verbringen sie erstens die restliche Zeit mit erheblich anstrengenderen körperlichen Tätigkeiten und zweitens besitzen sie keine Bürostühle oder andere Sessel. Denn selbst wenn sie sich in Ruhe befanden, verbrachten sie die »sitzende« Zeit sehr häufig in Körperhaltungen wie Hocken, die zu einer höheren Muskelaktivität in Ruhe führen als das Sitzen auf einem Stuhl. Vereinfacht kann man daraus ableiten, dass uns die Evolution nicht zu Büromenschen gemacht hat und dass auch Bürostühle und bequeme Fernsehsessel einen Mismatch darstellen, der auf lange Sicht seinen Gesundheitstribut fordert. 23
Der Stamm der Hadza wird uns noch in zahlreichen Belangen dieses Buches öfters begegnen, wenn es darum geht, Einsichten zu unseren vermuteten früheren Lebensgewohnheiten als Jäger und Sammler zu erlangen.
Wir haben nun schon einige ganz wesentliche Einsichten hinsichtlich unserer Anfälligkeit für Krankheiten gewonnen, die nicht ohne Weiteres auf der Hand liegen und auch in der Medizin nur unzureichend Berücksichtigung finden:
•Evolutionäre Kräfte wirken im Wesentlichen nur bis zum Abschluss der Reproduktionsphase bzw. werden Gene für bestimmte Eigenschaften vor allem dann positiv selektioniert, wenn sie die Zeugung und das Überleben der Nachkommen positiv beeinflussen, das heißt wahrscheinlicher machen. Genetische Eigenschaften bzw. Risiken, die sich erst später im Leben manifestieren (z. B. durch das erhöhte Risiko für eine bestimmte Krankheit), spielen in der Evolution, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle.
•Aus heutiger Sicht nachteilige genetische Eigenschaften können in früheren Zeiten bzw. unter anderen Gegebenheiten durchaus mit Vorteilen wie Infektionsresistenz verbunden gewesen sein. Sie setzten sich über Generationen durch und wurden weitervererbt, wenn sie das Überleben und damit den Reproduktionserfolg in früheren Zeiten, wenn auch nur minimal, wahrscheinlicher machten.
•Durch die vielfältige Wirkung mancher Gene in unserem Körper kann ein und dasselbe Gen sowohl mit Vorteilen in früheren Lebensabschnitten als auch mit einem erhöhten Krankheitsrisiko in der zweiten Lebenshälfte einhergehen (antagonistische Pleiotropie).
•Unsere ererbten Gene geben uns nur in den seltensten Fällen Auskunft über unser Risiko für chronische Krankheiten. Im Durchschnitt erklärt die Genetik nicht mehr als fünf bis zehn Prozent des Risikos für die häufigsten Erkrankungen.
•Die meisten Eigenschaften unseres Körpers sind bei genauerer Betrachtung Kompromisslösungen in Form sogenannter Tradeoffs, die während unserer langen evolutionären Vergangenheit von den ersten Einzellern bis zum modernen Menschen entstanden sind.
•Selbst die Auslösbarkeit, Qualität und Quantität von angeborenen Schutz- und Abwehrmechanismen stellen eine Kompromisslösung zwischen Kosten und Nutzen nach dem Brandmelder-Prinzip dar. Störungen dieser Balance können uns mitunter teuer zu stehen kommen.
•Ein sogenannter evolutionärer Mismatch tritt auf, wenn eine neuartige Umgebung angetroffen wird, die in der Evolutionsgeschichte davor in dieser Form noch nie erlebt wurde. Derartige »Nichtübereinstimmungen« zwischen evolutionärer Ausstattung und neuartiger Umgebung sind in unserer modernen Gesellschaft eine häufige Ursache für die Entstehung von Gesundheitsstörungen und Krankheiten.
Wie Sie sehen, sind in diesem Zusammenhang Attribute wie »gut« oder »schlecht« nur sehr relative, vor allem menschliche Größenordnungen. Denn wie wir ebenfalls gesehen haben, vermehren sich auch durchwegs negativ behaftete genetische Eigenschaften in einer Population, wenn sie nur mit ausreichendem Reproduktionserfolg einhergehen. Das Überleben bis zur Reproduktionsphase und die erfolgreiche Reproduktion selbst sind hier die bestimmenden Größen und nicht zwingend das individuelle Wohlergehen und schon gar nicht der Gesundheitszustand im fortgeschrittenen (postreproduktiven) Alter!
Um an dieser Stelle noch einmal die Brücke zur Ernährung zu schlagen: Nahrung, die primär zwar mehr oder weniger »vertragen« wird, sich aber bei längerem Verzehr im Verlauf des späteren Lebens negativ auf unsere Gesundheit auswirkt (weil wir z. B. nicht optimal an ihren Verzehr »angepasst« sind oder sich andere negative Effekte bei längerem oder erhöhtem Konsum einstellen), kann unter bestimmten Lebens- und Umweltbedingungen aus evolutionärer Sicht dennoch den entscheidenden Vorteil bieten, wenn sie ein Individuum zumindest in ein reproduktives Alter mit entsprechend häufigem Nachwuchs bringt. Ob diese Nahrung sich langfristig negativ auf unsere Gesundheit auswirkt, ist hierbei zunächst völlig sekundär! Die Lebenserfahrung zeigt, dass auch Menschen mit einer miserablen Ernährung und entsprechendem Gesundheitszustand in jüngeren Jahren dennoch beträchtlichen Nachwuchs haben können, solange sie nicht unfruchtbar oder dermaßen schwer krank werden, dass eine Fortpflanzung nicht im Raum steht. Die Rechnung in Form schwerer gesundheitlicher Komplikationen wird ihnen häufig erst Jahrzehnte später, nach erfolgter Reproduktion präsentiert. Ja selbst negative gesundheitliche Folgen in jungen Jahren lassen eine schlechte Ernährung aus evolutionärer Sicht immer noch besser abschneiden als der Hungertod.
Wir Menschen entwickelten uns im Laufe der Evolution zu einem Omnivoren (Allesfresser), der sein Überleben und seine weltweite Verbreitung der Tatsache verdankt, dass er mit einer relativ breiten Palette von Nahrungsmitteln sein Auslangen finden kann. Ich möchte mich im Verlauf des Buches auf Basis der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse darauf konzentrieren, wie wir trotz unserer zum Teil »mangelhaften« körperlichen Ausstattung unserer stetig ansteigenden Lebenserwartung erheblich mehr gesunde Lebensjahre verleihen können.
Bisher war von Genen, Evolution und körperlichen Merkmalen die Rede, die mit unserem Gesundheitszustand in Verbindung stehen. Unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit wäre aber alles andere als vollständig, wenn wir die zeitlebens bestehende Möglichkeit zur variablen Interpretation dieses Erbgutes außer Acht ließen.
Epigenetik
Die (unterschätzte) Macht der Epigenetik
Dass alle Eigenschaften eines Lebewesens (Phänotyp) nur von seinen ererbten Genen abhängen (Genotyp), gilt mittlerweile als überholt. Denn sogenannte epigenetische Prozesse bestimmen maßgeblich darüber, ob und in welchem Umfang die Information eines Gens überhaupt abgelesen werden kann ( Abbildung 2). Veränderungen an der DNA-Doppelhelix unseres Erbgutes (vor allem durch DNA-Methylierung und Histonmodifikation) sind hierfür die Ursache. Im Kontext dieses Buches ist von besonderer Bedeutung, dass diese epigenetischen Modifikationen (auch als »Epimutationen« bezeichnet), bei denen sich die Buchstabenreihenfolge des DNA-Stranges selbst nicht verändert, eindeutig von Umweltfaktoren abhängig sind und über mehrere Generationen (!) weitergegeben werden können. 1So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die Ernährungssituation von Großvätern (väterlicherseits) in deren kindlicher Entwicklungsphase mit der Gesamtsterblichkeit und insbesondere mit der Krebssterblichkeit ihrer männlichen Enkelkinder zusammenhängt. 2
Die Ursache für derartige Phänomene mit weitreichender Bedeutung (die Ernährung des Großvaters bestimmt die Lebenserwartung des Enkels) liegt in der epigenetischen Veränderung der großväterlichen Gene in Abhängigkeit von der damaligen Ernährungslage. Im selben Jahr wurde sogar über eine epigenetische Vererbung von Auffälligkeiten frühkindlich traumatisierter Mäuse an deren Nachkommen berichtet, wobei der Effekt sogar noch in der Urenkelgeneration (vierte Generation!) nachweisbar war. 3
Читать дальше