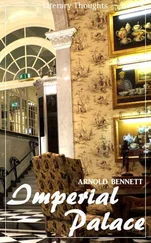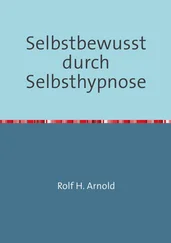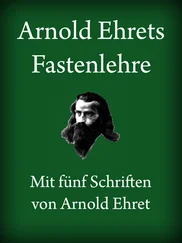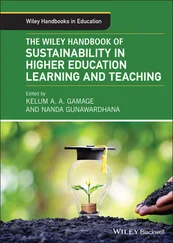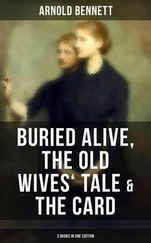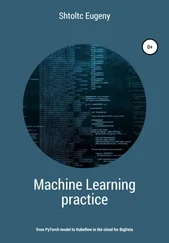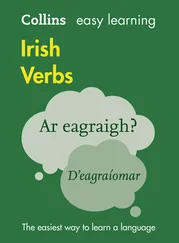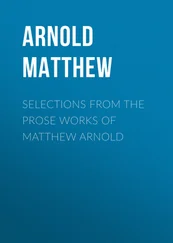1 ...7 8 9 11 12 13 ...39 In betrieblichen Weiterbildungsangeboten haben dagegen, zum Teil in Zusammenarbeit mit Hochschulen, MOOCs zu einer (Wieder-)Entdeckung virtuellen Lehrens und Lernens geführt; sie werden gerade in Großunternehmen auch als Form des Wissensmanagements gesehen, oft mit zusätzlichen Betreuungsleistungen versehen, und Absolventenquoten von 70 % sind unter derart veränderten Rahmenbedingungen nicht selten (Strube 2014).
Erkenntnisse aus der Nutzung virtueller Bildungsangebote
Die Resultate dieser kurzen Betrachtungen sowie der Blick in zwei frühere empirische Untersuchungen (Uhl 2003; Haug/Wedekind 2009) umfangreicher Hochschulprojekte zur Entwicklung und Einführung virtueller Studienangebote im grundständigen Studium zeigen beispielhaft, dass für die Implementierung von E-Learning im Lehren und Lernen noch einige Probleme zu bewältigen und Entwicklungen zu leisten sind:
Die Studierenden ziehen offensichtlich das Präsenzstudium dem Online-Studium vor, und die Lehrenden bleiben lieber bei der Präsenzlehre, die sie mit vielfältigen begleitenden digitalen Medien unterstützen, obwohl beide keineswegs computer- und internetfeindlich sind, sondern Computer und Internet zur Informationsverarbeitung, Informationssuche und Kommunikation vielfältig und intensiv nutzen.
Trotz der mentoriellen Betreuung reicht den Studierenden diese Kommunikation für ein erfolgreiches Studium offensichtlich nicht aus. Die unmittelbare Kommunikation mit den Lehrenden über die Studieninhalte in Präsenzveranstaltungen – und damit auch unmittelbar mit anderen Studierenden – ist dazu anscheinend unverzichtbar notwendig.
Die für erforderlich gehaltene unmittelbare Kommunikation mit den Lehrenden und den anderen Studierenden schließt nicht aus, dass die Studierenden auch die Möglichkeiten der Online-Kommunikation ausgiebig nutzen. Insgesamt hat mit Computer und Internet eine erhebliche Intensivierung und Ausweitung der Kommunikation stattgefunden, die positive Effekte hat, aber auch viel Zeit kostet.
Es ist nicht so, dass die Studierenden die virtuellen Studienangebote nicht nutzen. Allerdings verwenden sie diese in anderer Weise, als sich dies die Entwickler der Angebote vorgestellt haben. Sie ziehen Gewinn aus den Online-Studienangeboten, indem sie diese als interaktive und multimediale Studienmaterialien neben Büchern, Zeitschriften, Arbeitsblättern etc. verwenden.
Es entsteht die Gefahr für die Studierenden, worauf Schulmeister (2009, 321) hinweist, dass sie „die Gedankenschnipsel der Geistesverwandten in Weblogs“ lesen, sich aber „kaum noch Zeit für die umfangreichen Originale und die anspruchsvollen Monografien“ nehmen. „Was auf diese Weise entsteht, das sind nicht wissenschaftliche Schulen wie ehedem, auch nicht echte Diskurszirkel, sondern Zitationskartelle“ (ebd.). Das führt zu einer Verflachung der Studieninhalte und einem Defizit in der Bildung kritisch reflektierender Handlungsfähigkeiten.
Ohne die Einrichtung von Kompetenzzentren mit der erforderlichen personellen und finanziellen Ausstattung und ohne eine Unterstützung der Lehrenden durch Teletutoren ist der hohe Aufwand virtueller Studienangebote für die Lehrenden nur schwer oder gar nicht zu schaffen. Dafür sind neue Personal- und Finanzstrukturen in Hochschulen für eine erfolgreiche Etablierung virtueller Studienangebote notwendig.
Hinzugekommen ist in den letzten Jahren eine Zunahme der digitalen Vernetzung, die zu einer Flut von oft auch anonymen Informations- und Kommunikationshäppchen und damit auch zu einer Belastung ohne großen Nutzen geführt hat und noch weiter zunehmend führt. Diese Informations- und Kommunikationsflut kann auch dazu führen, dass eine kritisch reflektierende Bildung, die auch die Gründe, Bedingungen und Zusammenhänge im Blick hat, zerstört wird. Es ist daher notwendig, in den gemeinsamen Lehr- und Lernprozessen zu einer souveränen Nutzung der sozialen Netzwerke und einer entsprechenden Kommunikationskultur in der Bildung und der Gesellschaft auszubilden.
Auch das Lesen von E-Books kann zu einer Abwendung von der gegenständlichen Welt und einer geringeren Konzentration des Lesens führen, wie aktuell diskutiert wird. Küchemann (2017) berichtet von einer internationalen Tagung, dass viele „Studien […] das Lesen auf Bildschirmen grundsätzlich als oberflächlicher, flüchtiger, ablenkungsanfälliger aus[weisen]. Wenn das Gelesene nicht mit einem festen Ort – auf einer Seite, innerhalb eines Buchs – verknüpft werden kann, weil das Gerät immer nur eine Seite anzeigt oder der Text zum Lesen gescrollt werden muss, hat es die Erinnerung schwer.“ Es wird daher wichtig, da die Bildschirme alltäglich genutzt werden, das Lesen und Verstehen der auf dem Bildschirm präsentierten digitalen Medien zu lernen.
Diese Ergebnisse insgesamt betrachtet führen zu drei aufeinander aufbauenden zentralen Fragen, die im Folgenden beantwortet werden sollen. (1) Was sind die konstituierenden Faktoren von Bildungsprozessen? (2) Was sind die konstituierenden Faktoren für ein erfolgreiches virtuelles Lehren und Lernen? (3) Wie ist die virtuelle Lehr- und Lernkultur zu entwickeln, damit eine mögliche Verflachung des E-Learning verhindert und der Erwerb fundierter Handlungskompetenzen gefördert wird?
2.3 Konstituierende Faktoren von Bildungsprozessen
Entscheidend für die Planung, Gestaltung und Durchführung erfolgreicher Bildungsprozesse mit digitalen Medien ist zunächst die allgemeine Klärung der konstituierenden Faktoren für erfolgreiche Bildungsprozesse sowie der möglichen Behinderungen. Eine Grundlage dafür bietet die subjektwissenschaftliche Lerntheorie, wie sie von Holzkamp (1993) entwickelt wurde.
Defizitäre lerntheoretische Basis
Online-Studienangebote und multimediale und interaktive Lernprogramme sind in der Vergangenheit überwiegend nach Modellen des Instruktionsdesigns erstellt worden, denen die Vorstellung von der Herstellung von Lernen durch Lehrmaschinen zugrunde liegt. „Die Masse der Lernangebote im Netz [...] werden einfach additiv zur herkömmlichen Lehre eingeführt und richten sich in der Regel nach altbekannten Lernkonzepten, häufig behaviouristischer Provenienz. [...] Noch ist die Präsenzausbildung der virtuellen Ausbildung in der Regel überlegen“ (Schulmeister 2001, 363). Das bedeutet, dass die multimedial und interaktiv präsentierten Lerninhalte, die in allen Einzelheiten – Aktionen und erwarteten Reaktionen – in den Instruktionsstrukturen des Mediums fixiert sind, von den Studierenden von einem vorgegebenen Ausgangspunkt zu einem ebenso vorgegebenen Endpunkt eines Lernprozesses linear oder in wählbaren Verzweigungen fortschreitend durchzuarbeiten sind. Was sie dabei nach jedem definierten Lernschritt behalten haben, können sie mit den ebenfalls im Medium vorgegebenen Tests (meist Fragen mit vorgegebenen Auswahlantworten) oder programmierten Übungsaufgaben jeweils selbstständig prüfen. Der Unterschied zur gescheiterten Programmierten Unterweisung in den 1960er-Jahren liegt in der komfortabler eingebauten Interaktivität, die dem Lernenden einen begrenzten Spielraum in den Wegen des Erlernens der vorgegebenen Inhalte lässt.
Missverhältnis von Lerngrund und Lernziel
Diese Vorgehensweisen medialen Lehrens werden heute meist zurückgewiesen, weil sie offensichtlich nicht den Ansprüchen der Lernenden an ihre subjektiven Lern- bzw. Bildungsprozesse entsprechen. Die damals den meisten Online-Lernangeboten zugrunde liegende Vorstellung des Verhältnisses von Lehren und Lernen hat Holzkamp (1993, 385 ff., 391, 408) ausführlich analysiert und als „Lehrlernkurzschluss“ bezeichnet und zurückgewiesen. Weil die Lerngründe der lernenden Subjekte nicht der Ausgangspunkt ihrer Lernaktivitäten sind, sondern die Lernziele unabhängig von den subjektiven Lerngründen planmäßig bis in alle Einzelheiten vorgegeben werden, wird Lehren und Lernen gleichgesetzt. Wenn der erhoffte Lernerfolg nicht eintritt, so wird die Ursache entweder in der mangelnden Begabung der Lernenden oder in der mangelnden Motivierungs- und Vermittlungsfähigkeit der Lehrenden gesucht – bei virtuellen Bildungsangeboten werden die Ursachen analog darin gesehen, dass sie entweder nicht gut genug für unterschiedliche Begabungen programmiert sind oder nicht hinreichend motivieren bzw. erfolgreiche Behaltensleistungen nach jedem Lernschritt, ausgedrückt durch Setzen eines Häkchens im richtigen Kästchen, nicht hinreichend durch lobende Icons verstärken.
Читать дальше