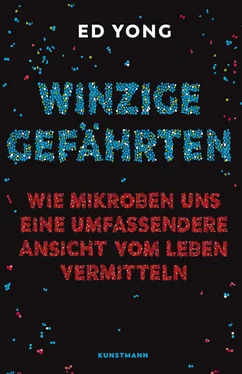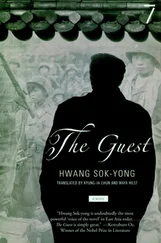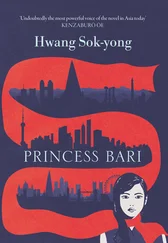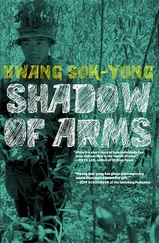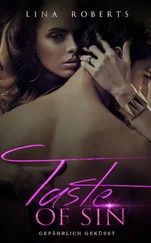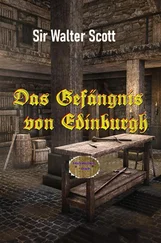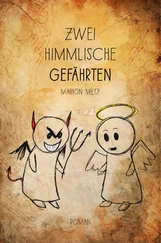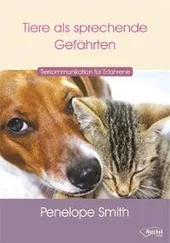Den Menschen würde es seltsamerweise gut gehen. Im Gegensatz zu anderen Tieren, für die Keimfreiheit den schnellen Tod bedeuten würde, kämen wir noch auf Wochen, Monate oder sogar Jahre hinaus zurecht. Unter Umständen würde unsere Gesundheit leiden, aber wir hätten dringendere Sorgen. Sehr schnell würde sich Abfall ansammeln, denn Mikroorganismen sind die Könige der Zersetzung. Mit den Weidetieren würden auch unsere Nutztiere zugrunde gehen. Das Gleiche gilt für unsere Nutzpflanzen: Mikroorganismen versorgen die Pflanzen mit Stickstoff, und ohne sie würde die Erde eine katastrophale Entgrünung erleben. (Dieses Buch konzentriert sich jedoch ausschließlich auf Tiere, was mir die Botanikbegeisterten unter den Lesern verzeihen mögen.) »Wir sagen in Verbindung mit dem katastrophalen Versagen der Lebensmittelversorgung den vollständigen gesellschaftlichen Zusammenbruch innerhalb nur eines Jahres voraus«, schrieben die Mikrobiologen Jack Gilbert und Josh Neufeld, nachdem sie dieses Gedankenexperiment angestellt hatten. 12»Die meisten biologischen Arten auf der Erde würden aussterben, und die Populationsgröße der Arten, die überdauern, würde sich stark vermindern.«
Mikroorganismen sind wichtig. Doch wir haben sie nicht zur Kenntnis genommen. Wir haben sie gefürchtet und gehasst. Jetzt ist es an der Zeit, ihren Wert richtig einzuschätzen, denn es nicht zu tun, kommt einem gewaltigen Verzicht auf Kenntnisse über unsere eigene Biologie gleich. In diesem Buch möchte ich zeigen, wie das Tierreich wirklich aussieht und wie viel staunenswerter es wird, wenn man es als die Welt der Partnerschaften sieht, die es in Wirklichkeit ist. Eine solche Version der Naturgeschichte vertieft die bekanntere Form, die von den größten Naturforschern der Vergangenheit begründet wurde.
Im März 1854 machte sich ein einunddreißigjähriger Brite namens Alfred Russel Wallace auf eine abenteuerliche, acht Jahre währende Reise über die Inseln Malaysias und Indonesiens. 13Er sah Orang-Utans mit rotem Fell, Kängurus, die durch die Bäume hüpfen, prächtige Paradiesvögel, riesige Schwalbenschwanz-Schmetterlinge, Hirscheber, deren Stoßzähne aus der Schnauze nach oben wachsen, und einen Frosch, der mit seinen fallschirmähnlichen Füßen von Baum zu Baum durch die Luft gleitet. Die Wunder, die er sah, fing Wallace mit Netzen, griff nach ihnen oder erschoss sie, und schließlich hatte er eine erstaun liche Sammlung von über 125.000 Funden zusammengetragen: Tiergehäuse, Pflanzen und Tausende von Insekten, die er mit Nadeln an Brettern befestigt hatte; Vögel und Säugetiere, gehäutet, ausgestopft oder in Konservierungsflüssigkeit eingelegt. Aber im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen beschriftete Wallace auch alle Gegenstände peinlich genau und notierte, wo er sie jeweils gefunden hatte.
Das war entscheidend. Aus solchen Einzelheiten konnte Wallace eine Gesetzmäßigkeit ableiten. Bei Tieren, die an einem bestimmten Ort lebten, fiel ihm selbst dann eine große Vielgestaltigkeit auf, wenn sie zu derselben Spezies gehörten. Er sah, dass manche Inseln die einzige Heimat bestimmter Arten waren. Als er von Bali in östlicher Richtung nach Lombok segelte – eine Entfernung von nur rund 35 Kilometern –, machten die Tiere Asiens plötzlich der ganz anderen Tierwelt von Australasien Platz, als wären die beiden Inseln durch eine unsichtbare Schranke (die man später als Wallace-Linie bezeichnete) getrennt. Aus gutem Grund wird Wallace heute als Vater der Biogeografie gepriesen, jener Wissenschaft, die erforscht, wo Arten vorhanden sind und wo nicht. Aber wie David Quammen in Der Gesang des Dodo schreibt: »Wird sie von Wissenschaftlern betrieben, die Verstand haben, so beschränkt sich die Biogeografie nicht darauf, zu fragen Welche Arten? und Wo? Sie fragt auch Warum? und, was manchmal noch entscheidender ist, Warum nicht?« 14
Genauso beginnt die Erforschung der Mikrobiome: Man katalogisiert, welche Arten man auf verschiedenen Tieren oder an verschiedenen Körperteilen desselben Tieres findet. Welche Arten leben wo? Warum? Und warum nicht? Wir müssen etwas über ihre Biogeografie wissen, erst dann können wir tiefer gehende Erkenntnisse über ihre Beiträge zum Leben gewinnen. Wallace’ Beobachtungen und Funde führten ihn zu der definierenden Erkenntnis der Biologie: Arten verändern sich. »Jede Spezies ist sowohl räumlich als auch zeitlich in Verbindung mit einer bereits vorhandenen, eng verwandten Spezies ins Dasein getreten«, schrieb er immer wieder und manchmal in Kursivschrift. 15Tiere treten in Wettbewerb: Die am besten geeigneten Individuen überleben, pflanzen sich fort und geben so ihre vorteilhaften Merkmale an ihre Nachkommen weiter. Das heißt, sie erleben eine Evolution durch natürliche Selektion. Das war eine der wichtigsten Erleuchtungen, die es in der Wissenschaft jemals gab, und sie begann mit einer rastlosen Neugier auf die Welt, mit dem Wunsch, sie zu erforschen, und mit der Bereitschaft, festzuhalten, wer wo zu Hause ist.
Wallace war nur einer von vielen Naturforschern und Entdeckern, die sich auf der ganzen Welt herumtrieben und ihre Reichtümer katalogisierten. Charles Darwin erduldete eine fünfjährige Weltumsegelung an Bord der HMS Beagle; dabei entdeckte er in Argentinien die fossilen Knochen riesiger Faul- und Gürteltiere, und auf den Galapagosinseln stieß er auf Riesenschildkröten, Meeresechsen und verschiedene Finkenarten. Seine Erlebnisse und Sammlungen legten den geistigen Grundstock für die gleiche Idee, die unabhängig davon auch in Wallace’ Geist aufgekeimt war: die Evolutionstheorie, die sich untrennbar mit dem Namen Darwin verbinden sollte. Thomas Henry Huxley, der die natürliche Selektion leidenschaftlich verteidigte und deshalb als »Darwins Bulldogge« bekannt wurde, reiste nach Australien und Neuguinea, um dort die wirbellosen Meerestiere zu studieren. Der Botaniker Joseph Hooker gelangte auf verschlungenen Wegen bis in die Antarktis und sammelte unterwegs Pflanzen. In jüngerer Zeit schrieb E. O. Wilson, der zuvor die Ameisen Melanesiens erforscht hatte, ein Lehrbuch über Biogeografie.
Häufig stellt man sich vor, dass diese sagenumwobenen Wissenschaftler sich ausschließlich auf die sichtbare Welt der Tiere und Pflanzen konzentrierten, die verborgene Welt der Mikroorganismen dagegen völlig außer Acht ließen. Das stimmt nicht ganz. Darwin sammelte bekanntermaßen auch Mikroben – er sprach von »Infusorien« –, die auf das Deck der Beagle geweht wurden, und korrespondierte mit führenden Mikrobiologen seiner Zeit. 16Aber viel konnte er mit den Hilfsmitteln, die ihm zur Verfügung standen, nicht ausrichten.
Heutige Wissenschaftler dagegen können Proben von Mikroorganismen sammeln und sie in ihre Bestandteile zerlegen, ihre DNA gewinnen und sie durch Sequenzierung ihrer Gene identifizieren. Damit tun sie genau das Gleiche wie Darwin und Wallace: Sie sammeln Proben von unterschiedlichen Orten, identifizieren sie und stellen die grundlegende Frage: Wer lebt wo? Sie können ebenfalls Biogeografie betreiben – nur in einem anderen Größenmaßstab. Die sanfte Zartheit eines Wattebäuschchens tritt an die Stelle des Schmetterlingsnetzes. Gene abzulesen ist so, als würde man ein Bestimmungsbuch durchblättern. Und ein Nachmittag im Zoo, an dem man von Käfig zu Käfig geht, kann etwas Ähnliches sein wie die Reise der Beagle, die von Insel zu Insel segelte.
Von Inseln waren Darwin, Wallace und ihresgleichen besonders fasziniert, und das aus gutem Grund. Inseln sucht man auf, wenn man das Leben in seinen besonders exotischen, farbenfrohen Formen und all seinen Superlativen finden will. Ihre Alleinlage, ihre festen Grenzen und ihre beschränkte Größe sorgen dafür, dass die Evolution in die Vollen gehen kann. Die Gesetze der Biologie sind hier leichter und in konzentrierterer Form zu erkennen als auf dem weiten, zusammenhängenden Festland. Aber eine Insel muss keine Landmasse sein, die von Wasser umgeben ist. Für Mikroorganismen ist eigentlich jeder Wirtsorganismus eine Insel – eine Welt, umgeben von Leere. Meine Hand, die ich im Zoo von San Diego ausstrecke, um Baba zu streicheln, ist wie ein Floß, das Arten von einer Insel in Menschengestalt zu einer Insel in Gestalt eines Schuppentiers transportiert. Ein Erwachsener, der von der Cholera niedergestreckt wird, gleicht der Insel Guam, die von Schlangen aus dem Ausland besiedelt wird. Niemand ist eine Insel? Das stimmt nicht: Aus Sicht der Bakterien ist jeder von uns eine Insel. 17
Читать дальше