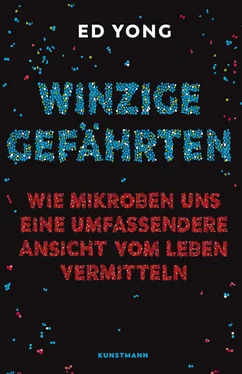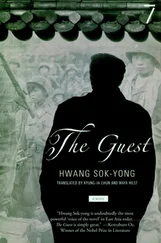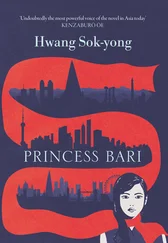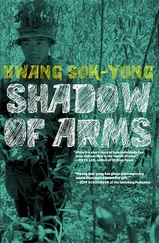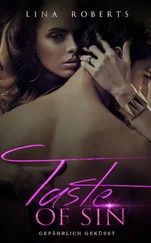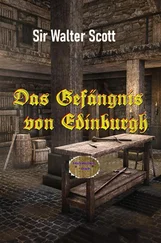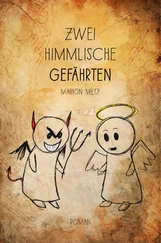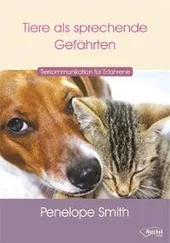Ein solches Tier ist der Plattwurm Paracatenula. Dieses winzige Geschöpf, das auf der ganzen Welt in warmen Meeressedimenten lebt, treibt die Symbiose ins Extrem. Sein Körper ist ungefähr einen Zentimeter lang und besteht zu fast 50 Prozent aus bakteriellen Symbionten. Sie sind im Trophosom verpackt, einem Körperhohlraum, der den Wurm fast zu 90 Prozent ausfüllt. Hinter dem Gehirn befinden sich praktisch nur noch Mikroben oder ihre Lebensräume. Harald Gruber-Vodicka, der diese Plattwürmer erforscht, bezeichnet die Bakterien als Motor und Batterie: Sie versorgen den Wurm mit Energie und speichern sie in Form von Fetten und Schwefelverbindungen. Diese Speicher verleihen dem Plattwurm seine leuchtend weiße Farbe. Außerdem liefern sie den Antrieb für seine ungewöhnlichste Fähigkeit: Paracatenula ist ein Meister der Regeneration. 18Schneidet man ihn in der Mitte durch, werden beide Teile wieder zu vollständig funktionsfähigen Tieren. An der hinteren Hälfte wächst sogar ein neuer Kopf mit einem Gehirn. »Wenn man sie klein hackt, kann man zehn von ihnen bekommen«, sagt Gruber-Vodicka. »Genau das tun sie wahrscheinlich in der Natur. Sie werden immer länger, dann bricht ein Ende ab, und es sind zwei.« Diese Fähigkeit ist vollständig vom Trophosom, den darin lebenden Bakterien und der von ihnen gespeicherten Energie abhängig. Solange ein Bruchteil des Plattwurms eine ausreichende Zahl von Symbionten enthält, kann daraus wieder das ganze Tier werden. Sind zu wenig Symbionten vorhanden, stirbt es. Was das bedeutet, widerspricht der Intuition: Der einzige Teil des Plattwurms, der sich nicht regenerieren kann, ist der bakterienfreie Kopf. Am Schwanz wächst ein neues Gehirn, aber das Gehirn allein bringt keinen Schwanz hervor.
Die Partnerschaft von Paracatenula mit den Mikroorganismen ist typisch für das gesamte Tierreich, Sie und mich eingeschlossen. Wir mögen nicht über die wundersamen Selbstheilungskräfte des Plattwurms verfügen, aber auch wir beherbergen Mikroorganismen im Inneren unseres Körpers und stehen während unseres gesamten Lebens mit ihnen in Wechselbeziehung. Anders als Hadfields Röhrenwürmer, deren Körperbau sich durch Bakterien aus der Umwelt zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben verändert, wird unser Körper durch die Bakterien in uns ständig neu aufgebaut und umgeformt. Unsere Beziehung zu ihnen ist kein einmaliger Austausch, sondern ein ständiges Aushandeln.
Wie wir bereits erfahren haben, wirken sich Mikroorganismen auf die Entwicklung des Darms und anderer Organe aus, aber auch nachdem diese Aufgabe erledigt ist, kommen sie nicht zur Ruhe. Den Körper eines Tieres in Gang zu halten, erfordert Arbeit. Oder, mit den Worten von Oliver Sacks: »Nichts ist für das Überleben und die Unabhängigkeit von Lebewesen – seien es nun Elefanten oder Protozoen – von größerer Bedeutung als die Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden inneren Umwelt.« 19Und dafür sind Mikroorganismen unentbehrlich. Sie wirken sich auf die Fettspeicherung aus. Sie tragen dazu bei, dass die innere Auskleidung des Darms und die Hautoberfläche sich erneuern können, indem geschädigte und abgestorbene Zellen durch neue ersetzt werden. Sie sorgen für die Unversehrtheit der Blut-Hirn-Schranke, eines Geflechts aus dicht gedrängten Zellen, das Nährstoffe und kleine Moleküle vom Blut ins Gehirn passieren lässt, größeren Molekülen und lebenden Zellen aber den Weg versperrt. Und sie beeinflussen sogar den unaufhörlichen Umbau des Skeletts, in dessen Verlauf frische Knochenmasse eingelagert und altes Material resorbiert wird. 20
Nirgendwo ist dieser ständige Einfluss deutlicher zu erkennen als im Immunsystem, den Zellen und Molekülen, die gemeinsam unseren Organismus vor Infektionen und anderen Gefahren schützen. Dieses System ist höllisch kompliziert. Man kann sich eine riesige Wundermaschine à la Rube Goldberg vorstellen, die aus einer scheinbar endlosen Anordnung von Bestandteilen besteht, und diese Bestandteile erzeugen einander, lösen einander aus und geben sich gegenseitig Signale. Nun stellen wir uns die gleiche Maschine als knarrendes, halb fertiges Chaos vor, in dem jedes Einzelteil nur halb ausgebildet, in zu geringer Zahl vorhanden oder falsch verdrahtet ist. So sieht das Immunsystem eines keimfreien Tieres aus. Das ist der Grund, warum ein solches Tier »für Infektionen aller Art anfällig [ist] … das Tier verharrt in einem infantilen Unreifestadium und ist den Gefahren der Welt nicht gewachsen«, wie Theodor Rosebury es formulierte. 21
Wie wir daran ablesen können, stellt das Genom eines Tieres nicht alles bereit, das dafür notwendig ist, dass ein ausgereiftes Immunsystem entstehen kann. Es bedarf auch des Beitrag eines Mikrobioms. 22In Hunderten von Fachartikeln wurde an ganz unterschiedlichen biologischen Arten – beispielsweise Mäusen, Tsetsefliegen und Zebrafischen – gezeigt, dass Mikroben in irgendeiner Form dazu beitragen, das Immunsystem zu formen. Sie haben Einfluss auf die Entstehung ganzer Klassen von Immunzellen und auf die Entwicklung von Organen, die solche Zellen herstellen und speichern. Besonders wichtig sind sie im Frühstadium des Lebens, wenn der Immunapparat zum ersten Mal aufgebaut wird und sich auf die große, böse Welt einstellt. Und auch wenn die Maschine erst einmal läuft, stimmen Mikroorganismen ihre Reaktionen weiterhin auf Gefahren ab. 23
Ein gutes Beispiel sind Entzündungen: Bei diesen Abwehrreaktionen eilen Immunzellen an den Ort einer Verletzung oder Infektion, was zu Schwellungen, Rötungen und Wärmeentwicklung führt. Sie tragen entscheidend dazu bei, den Körper vor Gefahren zu schützen; ohne Entzündungen wären wir von Infektionen durchsetzt. Zum Problem wird eine Entzündung, wenn sie sich im ganzen Körper ausbreitet, zu lange andauert oder schon bei der geringsten Provokation in Gang kommt: Dann führt sie zu Asthma, Arthritis und anderen entzündlichen Erkrankungen oder Autoimmunkrankheiten. Eine Entzündung muss also zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst und angemessen gesteuert werden. Ihre Unterdrückung ist ebenso wichtig wie ihre Aktivierung. Für beides sorgen Mikroorganismen. Manche Arten regen die Produktion kämpferischer, entzündungsfördernder Immunzellen an, andere lassen besänftigende, entzündungshemmende Zellen entstehen. 24Gemeinsam versetzen sie uns in die Lage, auf Gefahren zu reagieren, ohne aber die Reaktion zu weit zu treiben. Ohne sie geht dieses Gleichgewicht verloren; das ist der Grund, warum keimfreie Mäuse sowohl für Infektionen als auch für Autoimmunkrankheiten anfällig sind: Sie können weder eine angemessene Immunantwort aufbauen, wenn sie notwendig ist, noch in ruhigeren Zeiten eine unangemessene Antwort abwehren.
Halten wir hier einmal inne und überlegen wir, wie seltsam das alles ist. Die traditionelle Sicht auf das Immunsystem steckt voller militärischer Metaphern und feindseliger Formulierungen. Wir halten es für eine Abwehrstreitmacht, die das Selbst (unsere eigenen Zellen) vom Nichtselbst (Mikroorganismen und allem anderen) unterscheidet und Letzteres ausrottet. Und jetzt erfahren wir, dass Mikroorganismen unser Immunsystem überhaupt erst zusammenbauen und abstimmen!
Betrachten wir als Beispiel einmal das verbreitete Darmbakterium mit dem Namen Bacteroides fragilis oder »B-frag«. Wie Sarkis Mazmanian im Jahr 2002 zeigen konnte, beseitigt gerade dieser Mikroorganismus in keimfreien Mäusen einige Störungen des Immunsystems. Insbesondere stellt er eine ausgewogene Menge an T-Helferzellen wieder her, einer unentbehrlichen Klasse von Immunzellen, die den ganzen übrigen Apparat antreiben und koordinieren. 25Um das herauszufinden, brauchte Mazmanian nicht einmal den vollständigen Mikroorganismus. Er wies nach, dass eine einzige Zuckerverbindung auf seiner Außenhaut, das Polysaccharid A (PSA), ganz allein die Anzahl der T-Helferzellen erhöhen konnte. Damit hatte zum ersten Mal jemand gezeigt, dass ein einziger Mikroorganismus – nein, ein einziger von diesem Mikroorganismus produzierter Molekültyp – eine bestimmte Immunstörung beseitigen kann. Später wies Mazmanians Arbeitsgruppe nach, dass PSA zumindest bei Mäusen auch entzündliche Krankheiten wie Colitis (Darmentzündungen) und Multiple Sklerose (die Nervenzellen schädigt) verhindern und heilen kann. 26Diese Krankheiten sind auf eine Überreaktion des Immunsystems zurückzuführen; PSA sorgt für Ruhe und damit für Gesundheit.
Читать дальше