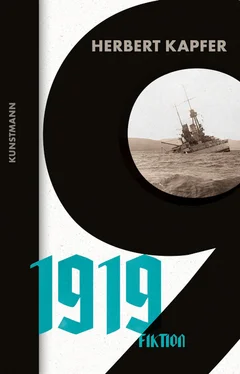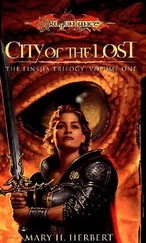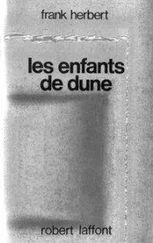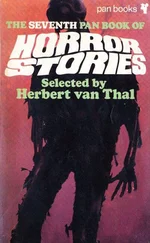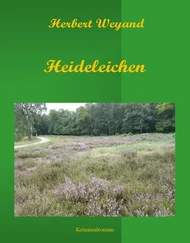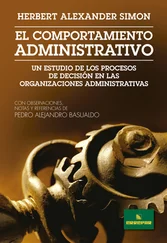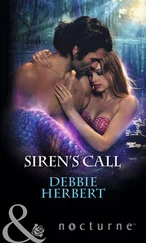Gegen 4 Uhr nachmittags traf der Funkspruch vom englischen Flottenchef ein: Die deutsche Flagge ist um 3,57 nachmittags niederzuholen und darf ohne Erlaubnis nicht wieder gehißt werden. Des Ansehens des Verbandes wegen und weil es nach den bisherigen internationalen Gepflogenheiten, z. B. im japanisch-russischen Krieg, nicht üblich gewesen war, internierten Schiffen die Flagge zu nehmen, wurde mündlicher und schriftlicher Protest gegen das Flaggenstreichen eingelegt. Wir beriefen uns in ihm auch auf das Ritterlichkeitsgefühl, daß zwischen sich achtenden Gegnern eine derartige Zumutung nicht üblich sei. Gleichzeitig wurde der deutsche Hochseechef mit Funkspruch in Kenntnis gesetzt: Englischer Flottenchef hat am 21. November angeordnet, daß die deutsche Kriegsflagge mit Flaggenparade niederzuholen und ohne Erlaubnis nicht wieder zu setzen sei. Ich habe hiergegen protestiert: es handle sich um eine Internierung. Englischer Flottenchef hat ablehnend geantwortet: Nur Feindseligkeiten seien eingestellt, Kriegszustand bestehe weiter.
Die Untersuchung auf Entwaffnung wurde gründlich durchgeführt. In den Bunkern wurden z.B. die Kohlen umgeschaufelt, in den Munitionskammern zufällig dort stehende Kisten und Kasten geöffnet. Die Soldatenräte hatten sich mit weißen Armbinden und roten Schleifen an den Fallreeps aufgestellt. Ihr Vordrängen fand seitens der englischen Offiziere und Mannschaften absolute Ablehnung. Während der Tage unseres Aufenthaltes auf dem Firth of Forth hüllte uns meist ein mehr oder weniger dicker Nebelschleier ein, der unsere Schiffe den Augen des englischen Publikums entzog. Es zeigten sich nur wenige Vergnügungsdampfer. Das englische Publikum verhielt sich, soweit wir es vom Flaggschiff aus beurteilen konnten, still und zurückhaltend; nur eine »Lady«, die an uns vorüberfuhr, erhob drohend die Faust.
wird von sieben größeren und kleineren Inseln der Orkney-Gruppe umschlossen. Das Becken ist geräumig. Mehrere enge Straßen verbinden es mit der See. Der außen herrschende außergewöhnlich starke Strom macht sich innerhalb der Bucht kaum bemerkbar. Die Inseln sind bergig und felsig. Die unteren Partien des Landes zeigten etwas kümmerlichen Ackerbau, Bäume und Sträucher waren nirgends wahrzunehmen; die mittleren waren mit Heidekraut bewachsen, über sie hinaus herrscht rauher Felsen. Mehrere Fischerdörfer waren an Land, in weiter Ferne von uns, sichtbar – sonst stand hier und da an der Küste ein aus grauen Feldsteinen erbautes, unfreundlich aussehendes Bauernhaus. Mehrere militärische Bauten, wie Baracken, Flugzeugschuppen oder Ballonhallen fristeten ein einsames Dasein. Eine Wetterwarte ziert die Koppe eines der vielen Hügel. Die deutschen Schiffe und Torpedoboote waren um die kleine Insel Cava im südwestlichen Teil der Bucht verankert oder an Bojen gelegt worden. Zu ihrer Bewachung lag ständig ein englisches Geschwader und eine Zerstörerflottille in der Bucht. Eine Anzahl armierter Drifter und Fischdampfer, die Tag und Nacht um unsere Schiffe herumfuhren, bildeten die engere Bewachung. Schon das stärkere Qualmen eines Schornsteins konnte ihren Argwohn erregen. Ohne viel Aufsehen nach außen war aus dem Überführungsverband nach dem Firth of Forth der Internierungsverband Scapa Flow geworden.
Den Post- und Personenverkehr erhielten kleine Kreuzer oder Torpedoboote aus der Heimat aufrecht. Sie sollten wöchentlich einmal zum Postaustausch Scapa Flow anlaufen. Zur Erhaltung der Fahrtbereitschaft der Schiffe wurden Kohlen, Wasser, Öl, Materialien und Inventarien aller Art benötigt. Kohlen und Wasser lieferte England gegen Bezahlung, alles übrige mußte von Deutschland herangeschafft werden. Den deutschen Besatzungen war englischerseits jeder persönliche Verkehr untereinander und mit den englischen Besatzungen sowie mit dem Lande verboten. Für den Verkehr mit dem Engländer bot sich wenig Gelegenheit: die den Postverkehr vermittelnden englischen Fahrzeuge legten nicht an den Schiffen an, sondern warfen die Postbeutel im Vorbeischeren an Bord, sofern sie nicht ins Wasser fielen; nur längsseits des Flaggschiffes lagen vormittags englische Verkehrsfahrzeuge. Hier hatte sich dann bald auf Grund eines üppig emporschießenden Tauschhandels ein gewisser Verkehr zwischen den Besatzungen der beiden feindlichen Länder angebahnt, und als im weiteren Verlauf der Internierung sich die strenge Ordnung englischerseits etwas abgeschliffen hatte, kam es nicht selten vor, daß einzelne Bewachungsfahrzeuge nachts an deutschen Schiffen längsseit gingen und mit den Besatzungen Handel trieben.
Die revolutionäre Propaganda, die von einem Teil der deutschen Schiffsbesatzungen betrieben wurde, insbesondere das Hetzen gegen die Offiziere, hatte die Verbandsleitung das Verbot des Verkehrs von deutschem Schiff zu deutschem Schiff nicht gerade drückend empfinden lassen, diente es doch zur Aufrechterhaltung einer, wenn auch bescheidenen, Zucht und Ordnung. Dagegen empfand ich mit jedem einzelnen der Besatzungen das herabwürdigende Gefühl, das im Versagen des Landganges lag.
Um die Schiffe in unserem Besitz zu erhalten, mußten die englischen Anordnungen befolgt werden. Dies war nur zu erreichen, wenn der Offizier wieder die Leitung der Besatzung voll zurückerhielt und seine Autorität wieder hergestellt wurde. Die Soldatenräte mit ihrem radikalen Anhang würden aber derartigen Bestrebungen nicht nur feindlich gegenüberstehen, sondern sie bis aufs Messer bekämpfen.
Briefpost unterlag der geheimen Überwachung radikaler Elemente. Diese Überwachung hat mich u. a. veranlaßt, von jeglicher Art schriftlicher Berichterstattung an die Heimatbehörde abzusehen. Unser Schriftverkehr nach außen und innerhalb des Verbandes wurde, dem Talleyrandschen Spruch folgend: »Ein geschriebenes Wort – und ich bringe den Mann an den Galgen!« auf das äußerste eingeschränkt und das Unvermeidliche auf etwaige politische Wirkung hin scharf nachgeprüft.
Ich nahm mir vor, bei allem Überlegen und Tun den Blick auf die englische Admiralität gerichtet zu halten – sie würde in letzter Linie doch immer den Ausschlag geben. Sie mußte in uns Offizieren das England feindliche und in den Radikalen das im Ententesinne arbeitende Element sehen. Auch mußte mich ein leidliches Verhältnis zum englischen Admiral in meiner Stellung stärken, während ein schlechtes die radikalen Elemente im Verband zu Herren über mich gemacht hätte. Vor die Wahl, welche Art von Verhältnis ich zum englischen Seebefehlshaber und zu dem Obersten Soldatenrat wählen wollte, war ich bereits gestellt worden. Der Obmann des letzteren hatte mir einige Tage nach dem Einlaufen in Scapa Flow gemeldet, daß die ersten Schritte zur Annäherung an ihn von englischen Unteroffizieren und Mannschaften getan seien, ob er nun zur Aufwiegelung der englischen Flotte die nötige Propaganda treiben sollte. Wir Offiziere hatten mit der Revolution nichts gemein, wir wollten auch mit ihren Machern, die unser Land in unabsehbares Unglück und in tiefste Schande gestürzt hatten, nichts gemein haben. So verbot ich die Propaganda.
So heißt der Titel einer Broschüre, die soeben aus München eintrifft. Sie enthält die Reden Kurt Eisners, Ministerpräsidenten des bayrischen Volksstaates, vom Ausbruch der Revolution, 8. November, bis zur Versammlung der bayrischen Soldatenräte am 30. November, und ist das erste authentische Programm einer größeren Gruppe Sozialisten und Demokraten, die die provisorische Regierung einer deutschen Provinz übernommen haben. Wo nichts zu sozialisieren da ist, da hört der Marxismus von selbst auf. Diese so einfache Wahrheit ist keineswegs Allgemeingut, und man braucht nur nach Berlin zu sehen, um keinen Augenblick darüber im Zweifel zu sein, daß man, wie Eisner sagt, in Berlin zwar radikaler redet, in München aber radikaler handelt. Eisner kennt keine Angst vor dem Bolschewismus. In Süddeutschland liegen ja wohl die Verhältnisse auch anders als in Berlin, dem eigentlichen Herde der Intelligenz. »Meine Herren«, sagt Eisner, »Bolschewismus! Ich will Ihnen sagen, worin der Gegensatz der äußersten Linken mit mir besteht. Wenn einmal die Not groß ist, und wenn Hunger ist, und Arbeitslosigkeit, dann nimmt sich eben jeder seinen Unterhalt, wo er glaubt, ihn zu finden. Der Verhungernde plündert die Bäckerläden. Das ist aber kein Bolschewismus, weder theoretisch, noch praktisch, das ist die Verzweiflung vor dem Untergang. Der theoretische Unterschied zwischen mir und den Bolschewisten besteht darin, daß ich mir gar kein Hehl daraus mache, daß es mir utopisch erscheint, wenn wir im gegenwärtigen Augenblick des Zusammenbruchs die Produktion, die Industrie und die Produktionsmittel zu vergesellschaften anfangen.«
Читать дальше