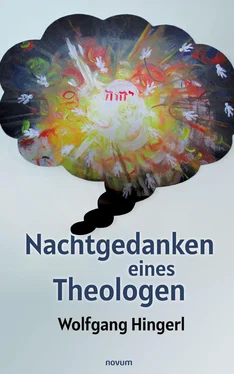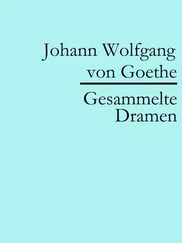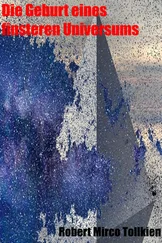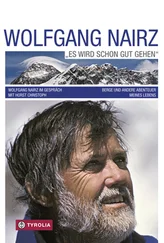Lässt Gott uns durch diese Ähnlichkeiten neue und tiefere Einblicke in seine größere Wirklichkeit tun, ohne uns die volle Wahrheit erkennen zu lassen, weil wir sie gar nicht fassen könnten? Vergleichen könnten wir diese Kommunikation Gottes mit uns vielleicht mit einer inneren „Stimme“, einem Gefühl der „Führung“, einer tiefen Ahnung, ähnlich der gefühlsmäßigen Wahrnehmung, die vielleicht ein Embryo im Mutterleib von seiner Mutter hat, der die Herztöne seiner Mutter wahrnimmt, ihre Stimme hört und auch den gemeinsamen Blutkreislauf mitbekommt, ohne aber eine wirkliche Vorstellung von seiner Mutter bekommen zu können. Ähnlich ist unser Suchen und Streben nach Gott nur ein Tasten im Finstern und begründet keinesfalls die Aversionen, die viele Religionen gegeneinander haben. Gemeinsam ist uns allen, dass wir über Gott nicht mehr wissen, als wir von ihm in unserem Dunkel erahnen.
Wichtige Anmerkung: Alle Namen und Begriffe, die in den Texten vorkommen und Details darüber, lassen sich bei Interesse leicht im Internet auffinden, um die Texte verständlicher zu machen. Nähere Erklärungen dazu sind hier absichtlich weggelassen.
Gott
Unbegreiflicher und unfassbarer Seins-Grund, Schreckgespenst der Völker seit Jahrtausenden, aber auch Inbegriff der Sehnsucht der Mystiker und Religionsstifter: gesucht und gefürchtet, verdrängt und geleugnet, ersehnt und geliebt, erahnt aber unerreichbar. Seine Offenbarung in der Geschichte der Menschheit ist eng mit der kulturellen Entwicklung derselben verbunden. Behutsam, nicht überfordernd lässt sich Gott immer besser und tiefer erkennen. Je weiter die Erkenntnisse über das Universum, die Materie, das Leben, die Gesetzmäßigkeiten selbst im scheinbaren Chaos voranschreiten, desto gewaltiger und zugleich unfassbarer und erschreckend, aber auch tröstend wird unsere Ahnung von Gott.
Am Beginn des Nachdenkens über Gott stehen die Vorstellungen, dass hinter allen nicht begreifbaren Naturphänomenen geheimnisvolle gute, neutrale oder böse gesinnte, nicht sichtbare Mächte oder Götter stehen, die man vielleicht durch Bitten oder Opfer geneigt stimmen könnte. Oft vermutete man auch verstorbene Ahnen dahinter. Manche dieser Mächte schienen nur lokal wirksam sein zu können. Sie wurden zu Lokal- und Stadtgottheiten. Andere schienen an Volksgruppen oder Stämme gebunden zu sein. Sie wurden zu Stammesgottheiten, die überall dort wirksam wurden, wo sich der Stamm gerade befand.
Ein wichtiger Schritt in der Gotteserkenntnis war sicher die Vorstellung, dass hinter der Vielzahl der Götter eine einzige Macht am Wirken ist, wie etwa der Glaube der Hindus, dass hinter allem das Brahman steht, aus dem alles hervorgehen und in das alles zurückkehren wird.
Ein weiterer wesentlicher Fortschritt war die Erkenntnis des Pharao Amemnophis III. (Echnaton), der die alten Göttervorstellungen der Ägypter verwarf und Aton als alleinige jenseitige und wohlwollende Himmelsmacht verehren ließ.
Auf derselben Ebene ist auch das Wirken Mose zu verstehen, der seinen Stammesgenossen, den Juden, an Stelle ihrer Nomadengottheiten den Gott JHWH (den Gott: ich bin) nahe zu bringen versuchte. Viele Jahrhunderte dauerte es, bis sich der Glaube an einen einzigen Gott durchsetzte. Aber noch war das Gottesbild (eifersüchtig, machtvoll, parteiisch, streng, Opfer fordernd, rachsüchtig …) allzu sehr vom Menschenbild beeinflusst. Auch die Vorstellung in der chinesischen Religion von Tao und den beiden sich ergänzenden Kräften Yang und Yin geht in dieselbe Richtung.
Eine weitere Zäsur im Gottesbild brachte die Erkenntnis Abrahams, dass Gott keine Menschenopfer will.
Weitergehend legt der Prophet Jesaia Gott die Worte in den Mund: „Was soll ich mit euren vielen Opfern?“ fragt der Herr. „Die Schafböcke, die ihr für mich verbrennt und das Fett eurer Masttiere habe ich satt, das Blut von Stieren, Lämmern und Böcken mag ich nicht. Wenn ihr zu meinem Tempel kommt, zertrampelt ihr nur seine Vorhöfe. Habe ich das verlangt? Lasst eure nutzlosen Opfer; ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen! Ihr feiert den Neumond, den Sabbat und andere Feste; ich kann sie nicht ausstehen, solange ihr nicht von euren Verbrechen lasst. … Wenn ihr mir eure Hände entgegenstreckt und zu mir betet, blicke ich weg. Und wenn ihr mich auch noch so sehr mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf, denn an euren Händen klebt Blut. Wascht euch, reinigt euch! Macht Schluss mit eurem üblen Treiben; hört auf, vor meinen Augen Unrecht zu tun! Lernt Gutes zu tun, sorgt für Gerechtigkeit, haltet die Gewalttätigen in Schranken, helft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht.“ (Jes. 1,11–17).
In ähnlicher Weise äußern sich auch der Prophet Jeremia in Kapitel 6 und 7 sowie eine Reihe anderer Propheten.
Endgültig beendet Jesus vor allem für die Christen deren Opfertätigkeit, indem er bei den Propheten anknüpft und Gott wie einen liebenden Vater verkündet, der nicht Opfer, sondern Barmherzigkeit will (Mt. 9,13).
Kurz vor Ende seines Lebens versucht er mit Gewalt die traditionellen Opferstrukturen im Tempel zu zerstören, indem er in einem demonstrativen Akt die Tische der Geldwechsler im Tempel umstößt und die Opfertier-Händler aus dem Tempel vertreibt. Er hat damit sein Leben verwirkt, weil ihm die jüdische Obrigkeit diese Tat nicht verzeihen kann.
Bei den Juden verschwinden die Opfer nach der Zerstörung ihres Tempels durch die Römer. Auch Mohammed und der Islam haben diese Einstellung übernommen. Im Islam wird Gott wie im Christentum als der Liebende und der Allbarmherzige verehrt. Aber auch über die Art und Weise dieser Liebe Gottes zu den Menschen oder gar zu seiner gesamten Schöpfung gab und gibt es die unterschiedlichsten Auffassungen, die einer evolutiven Veränderung unterliegen.
Zunächst spielt die Auserwählung eines Volkes oder einer bestimmten Gruppe eine entscheidende Rolle. Andere Gemeinschaften, aber vor allem Tiere oder gar Pflanzen werden von dieser Liebe Gottes ausgeklammert, sind dem Untergang geweiht. Bis in unsere Zeit spielte und spielt diese Ausgrenzung von Andersgläubigen, Sekten, ja sogar Gläubigen anderer christlicher Konfessionen eine Rolle.
Zu allen Zeiten und bei allen Völkern entstanden aber auch großartige Texte über die Liebe Gottes zu den Menschen, ja zu allen Geschöpfen. Gerade aus Hinduismus und Buddhismus kommt die Vorstellung von der Heiligkeit der Tiere und Pflanzen zu uns und wirkt sich bis in die vegane Lebensweise aus.
Wenn Gott wirklich vollkommen ist, wenn er die Liebe in Fülle ist, wenn er seine Schöpfung liebt, wie wir glauben, dann kann er nicht Teile seiner Schöpfung von seiner Zuwendung ausklammern, auch wenn Geschöpfe noch so sehr gegen seine Gebote und seinen Willen handeln. Sie können nicht aus seiner Liebe herausfallen. Eine Verurteilung und Verdammung scheinen unmöglich, da er diese Geschöpfe ja als fehlerhaft und unvollkommen geschaffen hat.
Wenn Gott die Liebe schlechthin ist, dann ist seine Liebe umfassend und unwiderruflich. Er ist die Liebe. Diese Liebe ist ein absolutes Ja und eine absolute Zuwendung zu seiner Schöpfung und zu seinen Geschöpfen. Sie ist unwiderruflich, das Wohl aller wollend. Sie unterscheidet sich grundsätzlich von der menschlichen Liebe, die sympathieabhängig, trieb- und gefühlsbetont, leicht verletzbar, oft enttäuschbar und subjektiv ist. Wenn Gott unser Heil, unser Glück und unsere Vollendung will, warum hat er uns dann ein Leben in Gottferne, ein Leben in Not, Leid, Katastrophen und die Konfrontation mit so viel Bösem und Schrecklichem, aber auch mit Erfahrung von Glück, Liebe und Schönheit zugemutet?
Vielleicht liegt es daran, dass es Gott um die Liebe geht, um die Liebe seiner Schöpfung und seiner Geschöpfe zu ihm, um eine Liebe aus der Freiheit heraus und nicht um eine Liebe aus Abhängigkeit, die gar nicht anders kann, als Gott wieder zu lieben.
Читать дальше