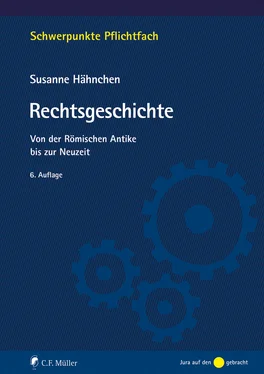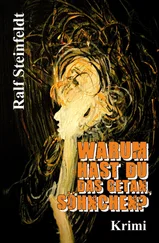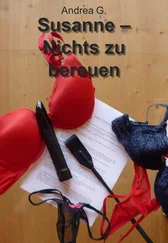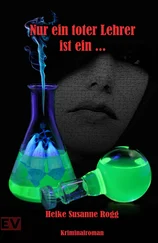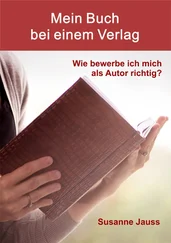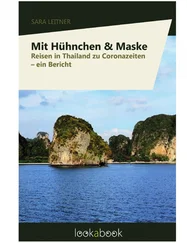45
Die Gestaltung der Herrschaftsverhältnisse nach der Vertreibung der Könige ist umstritten. Sicherlich lag der Schwerpunkt der Macht bei der Gesamtheit der adligen Sippenoberhäupter, der Keimzelle des späteren Senats ( Rn. 47). Für die einzelnen Amtsgeschäfte waren jedoch ein oder mehrere Oberbeamte (späterere Magistrate, Rn. 78 ff) erforderlich. Nach römischer Überlieferung traten an die Stelle der Könige sofort zwei Konsuln.[7] Die Quellen erwähnen jedoch auch andere Amtsträger für die Frühzeit der Republik, nämlich einen praetor maximus und 3-6 Konsulartribune, sodass heute eine allmähliche Herausbildung der 2-Konsul-Verfassung wahrscheinlicher erscheint.[8]
46
Schon die frühe Republik wurde erschüttert vom sog. Ständekampf, der zwischen Patriziern und Plebejern ( Rn. 41) lange anhielt. Hintergrund war die Weiterentwicklung der römischen Kriegstechnik. Während ursprünglich vor allem adlige Reiter aktiv waren, ging man zu der aus Griechenland übernommenen Hoplitentaktik ( hoplites = schwer bewaffneter Fußsoldat) über, die seit dem Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. für Rom archäologisch nachweisbar ist. Das Fußvolk, zu dem auch Plebejer gehörten, wurde also der Kern der Streitmacht. Dies führte zu veränderten politischen Zuständen aufgrund des beginnenden Kampfes um mehr Gleichberechtigung.
Im Jahr 494 v. Chr. soll die erste secessio plebis , also ein Auszug der Plebejer auf den mons sacer bei Rom stattgefunden haben.[9] Der Patrizier Menenius Agrippa bewog angeblich die Plebejer durch den Vergleich des Volksganzen mit einem körperlichen Organismus zur Rückkehr.
Damals sollen die ersten Volkstribune (tribuni plebis) von der plebs eingesetzt worden sein. Ab 471 v. Chr. sind concilia plebis , also Versammlungen der Plebs überliefert. Das Einberufungsrecht lag bei den Volkstribunen. Die Volkstribune konnten gegen Zwangs- und Strafmaßnahmen ( coercitio , Rn. 559) der zunächst ausschließlich adligen Oberbeamten interzedieren, also dazwischentreten, mittels Berufung (provocatio) an die Volksversammlung. Diese Befugnis zur Hilfe (ius auxilii) war anfangs nur durch den gemeinsamen Schwur der plebs sanktioniert, jede Verletzung eines Volkstribuns zu rächen. 449 v. Chr. wurde die Unverletzlichkeit (sacrosanctitas) durch Gesetze anerkannt (leges Valeriae Horatiae) .
Weitere Ergebnisse des Ständekampfes waren:
| - |
um 450 v. Chr. Erlass der XII Tafeln ( Rn. 51), |
| - |
wenig später wurden Ehen zwischen patrizischen und plebejischen Partnern gestattet, |
| - |
seit den leges Liciniae Sextiae von 367 v. Chr. ( Rn. 77) gab es (je einen) parallel amtierenden patrizischen und plebejischen Konsul, |
| - |
um 304 v. Chr. wurde das weitgehend von den patrizischen Priestern geheim gehaltene Recht (ius Flavianum) veröffentlicht ( Rn. 50, 111), |
| - |
Plebejer erhielten Zugang zu den Ämtern der Quästur und des Konsulats und wurden in den Senat aufgenommen. |
| - |
Als Abschluss des altrömischen Ständekampfes wird die lex Hortensia (287 v. Chr., Rn. 93) angesehen: Beschlüsse der concilia plebis , sog. Plebiszite, waren seither für das gesamte Volk, also auch die Patrizier, verbindlich. |
47
Bei allen Erfolgen der plebejischen Mehrheit lag das machtpolitische Zentrum der römischen Republik aber im Senat. Dieser war ursprünglich eine Versammlung der patrizischen Sippenoberhäupter. Später wurden auch verdiente Plebejer in den Senat aufgenommen ( Rn. 46). Die Anrede dort lautete „patres conscripti“ , zu übersetzen wohl als „Väter und Eingeschriebene“, also Patrizier und durch Zensur ( Rn. 81) Zugelassene. Aus den Patriziern und diesen wenigen Familien privilegierter Plebejer bildete sich der neue Adel der Republik, die nobilitas . Die Oberbeamten, die sogenannten Magistrate ( Rn. 78 ff) wurden zwar vom Volk in den Komitien gewählt, sie waren aufgrund ihrer gesellschaftlichen Herkunft und ihren politischen Verbindungen aber Vertreter der Senatsaristokratie. Ursache dafür waren Vorabsprachen und eine Wahlordnung, bei der nicht jede Stimme gleich zählte.
48
Dieses System der später sog. Republik (von res publica = die öffentliche, gemeinsame Sache) beruhte maßgeblich auf der ursprünglichen Bauerngemeinde der patres und den kriegstechnisch bedingten Weiterentwicklungen. Es ist kein Zufall, dass die militärische Organisation des Volkes und seine Versammlungen mit der Organisation des Staates zusammen fielen. Während der Zeit der Republik führte Rom viele Kriege und entwickelte sich vom kleinen Stadtstaat zur Großmacht am Mittelmeer.
Mit den drei Säulen Senat ( Rn. 46, 87), Magistrate ( Rn. 78 ff.) und Volksversammlungen ( Rn. 41, 43, 45) funktionierte die Republik ohne geschriebene Verfassung und ist als aristokratisch mit gewissen demokratischen Elementen zu charakterisieren. Das Säulensystem gewährleistete mit jeweils nur kleinen Justierungen über lange Zeit die Machtverhältnisse, die auch in der selbstgewählten Bezeichnung des Staates zum Ausdruck kamen: S.P.Q.R. = Senatus Populusque Romanus (Senat und Volk von Rom).
II. Rechtsbildung und Juristen
49
Die Anfänge des römischen Rechts verlieren sich im Dunkel der Vorgeschichte. Berühmt wurde dieses Recht später vor allem wegen der Leistungen seiner klassischen Juristen ( Rn. 160 ff) und es hatte enormen Einfluss bis heute ( Rn. 379 ff, 480 ff, 656 ff, 734). Es ist aber auch interessant, die Vorfahren dieser Juristen etwas näher zu betrachten.
Wesentliche Voraussetzung für den römischen Stadtstaat war die Trockenlegung des späteren Stadtgebietes und bereits hier begegnet man den pontifices . Priester[10] waren die „Intellektuellen“ der damaligen Zeit, also weitgehend freigestellt von Ackerbau und Viehzucht und stattdessen für andere Dinge zuständig.
Der Name (pontifex) kommt von pons facere (Weg bereiten, anlegen). Pons bedeutete ursprünglich nicht (große) Brücke, sondern Knüppelpfad oder Dammweg. Vermutlich stammen die pontifices schon aus der Zeit der Wanderschaft der Latiner und waren also zunächst Ingenieure und Fachleute für den Verkehr, auch mit den höheren Mächten und Göttern. Sie führten den Kalender, was insbesondere für die religiöse Unbedenklichkeit von Staatsakten, aber auch von anderen Rechtshandlungen wichtig war. Ihr Kollegium übernahm auch die Auslegung der XII Tafeln ( Rn. 51).
50
Es war eine für rechtlich frühe Gesellschaften typische Nähe von Recht und Religion,[11] die sich bei diesem Amt zeigt. Aber sicherlich ist es auch eine Frage politischer Macht gewesen. Noch Julius Caesar ( Rn. 101) war 73-63 v. Chr. oberster Priester des Kollegiums, also pontifex maximus – diese Bezeichnung trägt der Papst bis heute –, ebenso wie alle Kaiser bis Gratian (382 n. Chr., d.h. noch ca. 50 Jahre, nachdem das Christentum bereits Staatsreligion war). Lange konnten nur Patrizier in das Amt kommen. Tiberius Coruncanus wurde 254 v. Chr. der erste plebejische pontifex maximus .
In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist auch die älteste Bedeutung von lex (Regel, Gesetz), nämlich als religiöser Ritus. Der älteste Rechtsgang löste die Selbsthilfe des Einzelnen bzw. seiner Familie gegen erlittenes Unrecht ab. Eingesetzt wurde das älteste Gerichtsverfahren durch eine legis actio ( Rn. 56), also ein dem Ritus oder Gesetz (lex) entsprechendes Vorgehen ( actio = Handlung, Klage).
Die pontifices bewahrten die im alten ius civile vor Gericht notwendigen Spruchformeln der Legisaktionen als Geheimwissen, mindestens bis zum Ende des 4. Jh. v. Chr. ( Rn. 45, 111). Sie stellten ihr Wissen auf Anfrage zur Verfügung. Daraus entwickelte sich die sog. Kautelarjurisprudenz (von cavere = sich vorsehen, cautio = hieb- und stichfestes Rechtsgeschäft), dass also Private für Verträge und Testamente von Juristen beraten werden. Der Gegensatz dazu ist die judizielle Jurisprudenz, deren Gegenstand ein abgeschlossener Fall ist, über den entschieden wird. Die pontifices leisteten auch den Rechtsprechungsmagistraten Unterstützung. Dass eine solche Hilfe notwendig war, erschließt sich, wenn man weiß, dass die für die Zivilrechtspflege verantwortlichen Prätoren (ebenso wie andere Magistrate) in erster Linie Politiker waren, die nur für ein Jahr gewählt wurden ( Rn. 78 ff).
Читать дальше