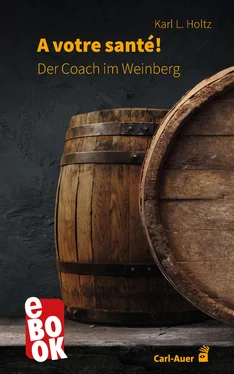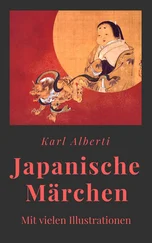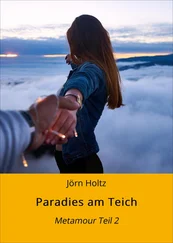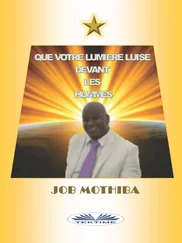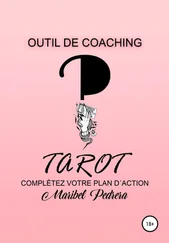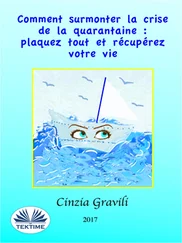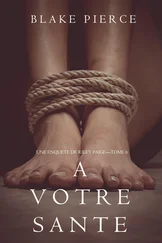Und so sind wir wieder bei der Verantwortung für uns und unsere Umwelt und natürlich auch beim verantwortlichen Umgang mit den Weiterentwicklungen der ersten, vergorenen Früchte von den Streuobstwiesen unserer Erkenntnis.
Es bliebe noch nachzutragen, dass es vermutlich keine Äpfel waren, sondern, so auch die Erkenntnis von McGovern, gärende Feigen. Auch das mit der Erkenntnismöglichkeit von Gut und Schlecht in Zusammenhang gebrachte Feigenblatt spricht dafür. Und natürlich sollten wir nachtragen, dass die Schlange wohl auch dazu beigetragen hat, mit den zunehmend komplexeren Entscheidungen der Menschen ein – wenn auch bis heute noch nicht präzise herausgearbeitetes – Berufsbild von Helfern und Unterstützern ins Gespräch zu bringen.
Aber: Wie sich alkoholische Getränke voneinander unterscheiden und zu unterscheiden haben, ist heutzutage präzise festgelegt. Wie diese für die Autonomie und Entscheidungsfreiheit, für die Unmündigkeit und Selbstzerstörung des Menschen verantwortlich sind, wird eingehend erforscht. Der Aufgabenbereich und die Funktion unterschiedlicher Hilfesysteme im Beratungskontext sind demgegenüber noch sehr vage und aufgrund häufig nicht nachvollziehbarer Kriterien definiert. Von daher können wir bisher von Wirksamkeitsstudien auch nicht viel erwarten. Wer sich Wein nennen darf, wissen wir inzwischen – wer sich Coach nennen sollte, nicht.
Was lässt sich über Wein und Coaching sagen?
Was ist denn Wein und was ist eigentlich ein Coach?
Eine überflüssige Frage? Der Weinliebhaber wird sagen: »Sicher nicht, denn ich möchte beim Kauf einer Flasche Wein Hinweise darauf haben, auf was ich mich einlasse.« Und in der Regel weiß er, welche Informationen für ihn wichtig sind. Er möchte sicher sein, dass in der Flasche, deren Etikett ihm Wein verspricht, auch tatsächlich Wein enthalten ist. Und wenn das Produkt einmal nicht den Vorschriften und den damit verbundenen Erwartungen entspricht, wird er sich zu Recht getäuscht fühlen und erwarten, dass ein bewusstes Abweichen von den wohldefinierten Kriterien auch entsprechend sanktioniert wird.
Es kommt weniger darauf an, wie kreativ das Etikett gestaltet ist, sondern eher darauf, wie der Wein ausgebaut wurde. Für die Geschmackserwartungen kommt es weniger darauf an, wie vollmundig oder blumig der Wein genannt wird, sondern darauf, welche Rebsorten oder auch welcher Alkoholgehalt enthalten sind. Es gibt viele Kriterien, nach denen sich ein Weinkenner richten kann, einige Informationen dazu sind auf der Flasche enthalten, andere kann man online erfragen, wieder andere kann er mit dem Weinhändler seines Vertrauens diskutieren.
Natürlich wird es Abweichungen geben: Weine müssen nicht immer sortentypisch sein, ein hoher Alkoholgehalt kann durch die anderen Inhaltsstoffe des Weines eingebunden sein. Ein kreativer Ausbau kann zu überraschend interessanten, wenn auch nicht erwartungskonformen Ausprägungen führen. Aber: Im Allgemeinen kann man sich auf die Auszeichnungen verlassen, wenn man sich ein wenig mit der Materie vertraut gemacht hat.
Das bedeutet nun nicht, dass eindeutig benannte Weine auch allen Kennern gleich schmecken müssten. Es gibt Vorlieben, Vorerfahrungen und Kontexte, welche die Beurteilung des Weins sehr stark beeinflussen. Und es gibt natürlich subjektive Voraussetzungen, die auch bei Weinkennern, etwa bei Blindverkostungen von Experten, zu sehr unterschiedlichen Aussagen hinsichtlich der Qualität führen. Dazu später mehr.
Die Frage danach, was denn eigentlich ein Coach ist, lässt sich demgegenüber viel schwerer beantworten. Wenn wir sagen, ein Coach ist jemand, der coacht, dann stimmt das zunächst, ist aber eine Tautologie. Und selbst, wenn wir jetzt wüssten, was Coaching ist, müssten wir uns darauf einigen, ob jeder, der coacht, ein Coach ist, oder ob wir unter dieser Bezeichnung für unsere Zwecke den professionellen Coach meinen, also jemanden, der zu dieser Tätigkeit eine spezielle – möglichst wissenschaftlich fundierte – Qualifikation mitbringt und diese auch in einem professionellen Rahmen umsetzt. Ein Coach wäre also jemand, der unter bestimmten Voraussetzungen in einem näher zu definierenden Kontext coacht.
Ansonsten könnten wir in freier Abwandlung der Aussage »Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst« zunächst einmal festhalten: Coaching ist das, was ein Coach tut. Und so, wie die Aussage zur Intelligenz darauf verweist, dass es unzählige Theorien und Definitionen von Intelligenz gibt, die jeweils in dem zugehörigen Intelligenztest erfasst werden, so könnten wir uns damit zufriedengeben, dass es eine Vielzahl von Coachinganlässen und -strategien gibt, die durch den jeweiligen Coach und seine Theorie von Coaching vorgegeben werden.
Aber ebenso, wie die obige Aussage zur Intelligenz hinterfragt werden muss, ist natürlich auch die Tätigkeitsbeschreibung eines Coachs nicht willkürlich. In der Intelligenzforschung hat man sich auf eine Reihe übereinstimmender Kernthesen einigen können, zur wissenschaftlichen Standortbestimmung des Berufsbildes Coach ist eine Zusammenschau wesentlicher Merkmale dringend erforderlich.
Die gegenwärtige Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens so viele Coachingkontexte wie Weinlagen zu geben scheint: Frisurencoachs, Tanzcoachs, Lerncoachs, natürlich den Sportcoach, den Gesundheitscoach, den Mentalcoach usw.
Jede Definition über das, was Coaching ist, ist ja nicht nur ein Streit über Worte, jede Definition ist als Aussage darüber zu verstehen, was zu dem Begriff gehört und was nicht, welche Merkmale unabdingbar und welche marginal sind. Definitionen sind also als Versuch zu verstehen, eine Theorie darüber zu formulieren, was denn eigentlich der Fall ist. Diese Definitionen sind per se nicht richtig oder falsch, sie sind als Einladungen von Definierern oder Theoretikern zu verstehen, empirische Sachverhalte mal unter einer bestimmten Fragestellung und in dieser Zusammenschau zu sehen. Manchmal – ja: häufiger, als man annehmen sollte – sind solche Einladungen auch werbewirksame Angebote, gewissermaßen zu einer (theoriegeleiteten, erkenntnisleitenden?) Tupperware-Veranstaltung. Die Wissenschaftstheoretiker nennen so etwas dann interessenbezogene, persuasive Definitionen (Gabriel 2004). Diese sind im Übrigen in der Definition von Weinen seit einiger Zeit untersagt (»Gesundheitswein«, »für Diabetiker geeignet« etc.).
Gesundheitsbezogene Angaben müssen bei alkoholischen Getränken mit Inkrafttreten der sog. Health-Claims-Verordnung (HCVO) entfallen. Für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent dürfen nach Art. 4 Abs. 3 der HCVO überhaupt keine gesundheitsbezogenen Hinweise angegeben werden.
Bei all der Vielfalt unterschiedlicher Sorten und Ausbaumethoden gibt es für Wein ein zentrales Definitionsmerkmal:
Wein ist ein Getränk, das von Früchten der Weinrebe stammt und laut EU-Gesetzgebung mindestens 8,5 Volumenprozent Alkohol enthält. Hierzu zählen auch Variationen wie Likörwein, Schaumwein und noch nicht ausgegorene Neue Weine (Federweißer), nicht aber per definitionem Obstweine (weinähnliche Getränke) oder weinhaltige Getränke (Weinschorle, Sangria). Getränke, die aus stärkehaltigen Grundstoffen vergoren werden (z. B. Reiswein), dürfen noch nicht einmal als weinähnlich bezeichnet werden.
Wenn man also von Wein spricht, weiß man auch, worüber man spricht. Und das Wissen um einen Sachverhalt soll förderlich für den tagtäglichen Diskurs sein.
Gibt es nun auch solche zentralen, unabdingbaren, für eine Definition des Coachings notwendigen Merkmale – möglichst solche, die auch von anderen Formen unterstützenden Handelns verschieden sind? Wie unterscheidet sich Coaching von Supervision, Beratung, Therapie oder Begleitung? Ist Coaching dasselbe wie Beratung und Supervision (als Beratung im beruflichen Kontext), nur teurer, weil u. a. Führungskräfte und Experten am Werk sind? Und wenn der Vater seinen Sohn als Lerncoach coacht, kann er das eigentlich nur tun, wenn er in seinem Zögling eine künftige Führungskraft sieht? Denkt das Bildungsministerium Baden-Württemberg daran, im Ländle eine künftige Führungselite und Experten zu bilden, wenn sie Lehrern die Funktion von Lerncoachs zuweist?
Читать дальше