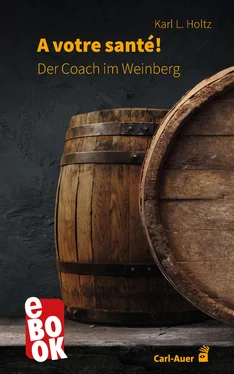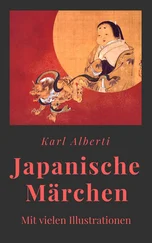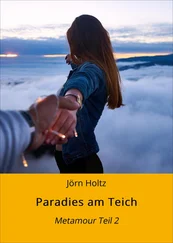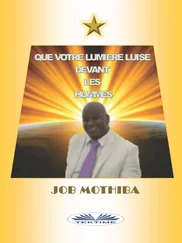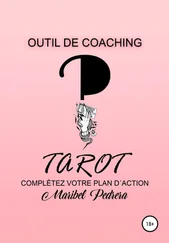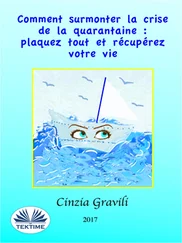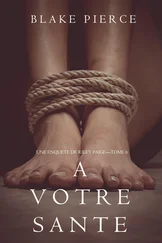Und wie die Merkmale des Business-Coaching (ausgehend von US-amerikanischen Tendenzen) nach und nach in das Life-Coaching übernommen werden, hat die Nachfrage nach Selbstoptimierung nun den gesamten Coachingbereich erreicht. Gesundheitscoaching entfernt sich von einer gesunden Lebensführung wie die Erfüllung im Beruf von der Selbstausbeutung. Lern- und Elterncoaching läuft Gefahr, die unendliche Selbstoptimierung so früh wie möglich zu implantieren. Tante Klaras mit reichlich Entbehrungsgeschichten begleitete Aussage: »Ihr sollt es später einmal besser haben« verändert sich in die implizite Grundannahme: »Es ist nie zu früh, aus unseren Kindern Spitzensportler mit Nobelpreishoffnungen zu machen.«
Nun hat Darwin ja nie behauptet, dass der allseitig Kompetenteste und Tüchtigste die besten Überlebenschancen hat. »Survival of the fittest« bedeutet bekanntermaßen, dass derjenige gute Zukunftschancen hat, der sich den sich ändernden Umweltbedingungen am ehesten anpassen ( to fit ) kann. Und hiermit ist nicht die wahnwitzige Anpassung an Modetrends gemeint. Und auch nicht das Sich-Versammeln in einer nivellierenden Mitte. Dies wird dankenswerterweise in den Präambeln und Menschenbildannahmen einiger Beratungs- und Coachingverbände reflektiert.
Die Deutsche Gesellschaft für Beratung (DGfB) beispielsweise betont auf ihrem Wege zur Qualitätsentwicklung die reflexive Funktion von Beratung, die nicht nur davon ausgeht, dass der Mensch ein rationales, reflektierendes Wesen ist, sondern dass eine angemessene Beratung auch immer Reflexion der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beinhalten sollte. Verhalten heißt immer, sich in ein Verhältnis setzen zu etwas, und diese Verhältnisse, zu denen auch der Coach und die expliziten und impliziten Auftraggeber gehören, sind naturgemäß Inhalte eines Beratungs- oder Coachinggesprächs.
Und es lohnt sich für den Coach auch, bereits im Vorfeld der Weiterbildung und in der professionellen Supervision die gegenwärtig bevorzugten Konzepte der lösungs-, kompetenz- und ressourcenorientierten Grundannahmen und Methoden zu reflektieren (Illouz 2019). Analytische, behavioristische, nondirektive, humanistische, systemische u. a. Therapiemodelle haben immer auch die jeweiligen gesellschaftlichen Produktionsbedingungen widergespiegelt und bis in pädagogische Konzepte ausgestrahlt. Man könnte vermuten, sie trafen auf eine entsprechend aufnahmebereite und aufgeklärte Gesellschaft. Nun könnte man aber auch darüber spekulieren, ob die Modelle nicht die psychologische Begleitung und Befriedung gesellschaftlicher Konflikte widerspiegelten. Ob Therapeuten wie Coachs nicht aufkommende gesellschaftlich bedingte Konflikte stromlinienförmig handhabbarer machen sollten.
Mainstreaming ist überschaubarer, schränkt aber die Vielfalt menschlicher Darstellungsmöglichkeiten und Ausdrucksformen ungemein ein. Führen die Beihilfen zur Selbstoptimierung mit ihren impliziten Annahmen von vorhersehbaren, optimal designten Persönlichkeiten nicht zu einer Verarmung sozialen Zusammenlebens und unbefriedigter Neugier auf die Vielfalt menschlicher und damit kulturell bedeutsamer Ausdrucksformen?
Wobei wir mit einem conferencemäßigen Übergang schon bei den Designerweinen wären.
Der Ausbau des Weins im Keller ist zumeist die Begleitung eines prinzipiell unvorhersagbaren Ergebnisses, ein nur mittelbar zu beeinflussender Prozess, um die Entwicklung eines lebenden Organismus in einigermaßen geregelten Bahnen zu halten.
Wie schon bei der Erziehung der Reben im Weinberg hat auch der Weinbauer in Analogie zum Pädagogen eine didaktische Struktur, die er – wie ein professioneller Lehrer – praxisorientiert gelernt hat und mit seinem persönlichen Stil und seinen Wahrnehmungen über die bisherige Entwicklung in Einklang bringen will. Wohl dem, der die Vielfalt seiner Zöglinge im Auge behält, er erspart sich viele Enttäuschungen – schon gar, wenn er zunehmend häufiger feststellt, dass seine Schüler im Wesentlichen doch nur das tun, was sie wollen.
Auch hier gilt: Der Wein ist – im Sinne systemischer Denkmodelle (z. B. Maturana und Varela) – ein autopoietisches Wesen, das Informationen von außen zwar aufnimmt, dann aber eigenständig entscheidet, was ihm angemessen erscheint.
Der Winzer sollte also Angebote machen – und das schon ab Beginn der Pflanzung – und den Wein so in seiner Entwicklung begleiten. Der Versuch, ihm über ein strenges Korsett eine bestimmte Entwicklung instruktiv zu verordnen, muss scheitern. Kein zufriedener Pädagoge möchte die Erfahrung mit den Schülern missen, die sich im Rahmen günstiger Lernbedingungen zu individuellen Persönlichkeiten – mit Ecken und Kanten – entwickeln. Und es wäre gut für die Gesellschaft, wenn sie diese Ergebnisse gegenüber einer uniformen Zurichtung auf Numerus-clausus-Kriterien angemessen honorieren würde.
Ohne die Analogie zu pädagogischen Bemühungen allzu sehr strapazieren zu wollen: Auch im Weinbau gibt es natürlich zusätzliche Hilfen bis hin zu »sonderpädagogischen« Maßnahmen, wenn Entwicklungsprozesse aus dem Ruder laufen oder die individuellen Entwicklungspotenziale und Vorschädigungen besondere Maßnahmen nahelegen.
Stets ist der Winzer Lernbegleiter, der Hilfen anbietet, wenn Entwicklungsprozesse nachhaltig gestört erscheinen. Aber auch hier gibt es Kellermeister, die sofort mit massiven Maßnahmen reagieren, um die allgemeinen Geschmackserwartungen zu bedienen, und andere, die Verhaltensstörungen als herausforderndes Verhalten oder als eigenständige Lösungsversuche zugrunde liegender Schwierigkeiten deuten, entsprechend moderat reagieren und neugierig auf den weiteren gemeinsamen Entwicklungsprozess sind.
Zu den besonderen Maßnahmen im Weinbau gehören etwa Kryoextraktion, Umkehr-Osmosen, Crossflow-Filtration oder Vakuumverdampfung, man kann die riskanten Eigenhefen durch Reinzuchthefen ersetzen, man kann auf die traditionelle Maischegärung verzichten. Kein Lehrer wird das Risiko eingehen, vor versammelter Elternschaft einzugestehen, dass er einen ganzen Jahrgang unzureichend auf das Leben vorbereitet hat. Kein Winzer kann es sich erlauben, einen ganzen Jahrgang aus dem Verkehr zu ziehen. Und doch merkt man: Ein solchermaßen geretteter Wein ist trinkbar – manchmal sogar ohne Fehl und Tadel –, wird von vielen aber als langweilig oder ausdrucksarm zurückgewiesen.
Kommen wir noch einmal auf die Optimierungsidee des amerikanischen Business-Coaching zu sprechen. Hier bewegt man sich ja nicht im »unteren« sonderpädagogischen Bereich, hier sollen ja nicht Lerndefizite ausgeglichen werden: Angestrebt wird vielmehr »Hochbegabung« in möglichst vielen Kompetenzbereichen und für möglichst viele. Auch hierzu muss man zunächst einmal eine Analyse der Kompetenzen machen, die dem Anforderungsprofil entsprechen, und dann werden diese verstärkt ausgebaut.
Was Anklänge an die Schöne neue Welt hat, findet sich wieder in der Tendenz, Designerweine zu produzieren. Ausgehend von einer Analyse des zahlungskräftigen Publikumsgeschmacks werden Weine in die einzelnen Bestandteile zerlegt, physikalisch und biochemisch bearbeitet und dann wieder optimiert zusammengesetzt. Es ist das Schicksal von Barbiepuppen und Erdbeerjoghurt: So sehen die perfektionierten Produkte aus, und verzweifelte Eltern stellen fest, dass weder andere handgemachte Spielzeuge noch richtige Erdbeeren im Joghurt die Kids von ihren Präferenzen abbringen.
Unter Designerweinen verstehen wir hier also nicht die begradigten, mit sonderpädagogischen Maßnahmen, evtl. sogar mit Holzspänen statt mit Fassreife ausgebauten Weine. Es sind besonders gestylte Weine, die sich vor allem deswegen als raffiniert bezeichnen lassen, weil sie wie das Rohöl in einer Raffinerie in ihre Bestandteile zerdampft und zerschleudert werden. Der komplexe Ausbauprozess in der Wechselwirkung aus Estern, Terpenen und Pyrazinen wird in die einzelnen Substanzen zerlegt und dann in einer optimalen Abstimmung wieder zusammengefügt. Hinzu kommt nur so viel Alkohol (bis zu 14 %), dass der Wein steuerlich günstig bleibt, nicht zu sehr nach Sprit schmeckt und mit der ebenfalls dosiert zugesetzten Säure optimal harmoniert. Die dazu benötigten Geräte, die »Schleuderkegel-Kolonnen« kosten ein paar Millionen, sie sollen einem Gerücht zufolge den Uran-Isotopen-Schleudern entlehnt worden sein, die man für den Bau von Wasserstoffbomben konzipiert hatte.
Читать дальше