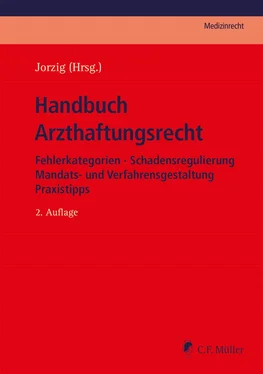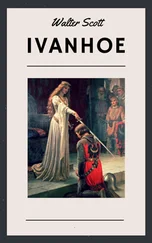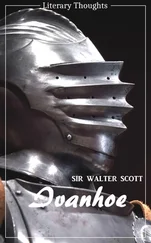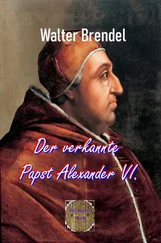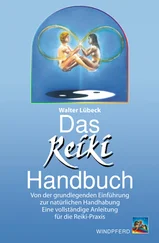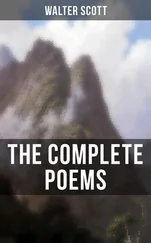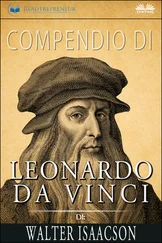123
Voraussetzung für die Haftung ist zunächst das Vorliegen einer Rechtsgutverletzung. Das fehlerhafte Produkt muss den Tod eines Menschen, eine Körper- oder Gesundheitsverletzungen oder eine Sachbeschädigung zur Folge gehabt haben. Für eine Sachbeschädigung als Rechtsgutverletzung ist nach § 1 Abs. 1 S. 2 ProdHaftG erforderlich, dass eine andere Sache als das fehlerhafte Produkt beschädigt wird und dass diese andere Sache ihrer Art nach gewöhnlich für den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt ist und hierzu von dem Geschädigten hauptsächlich verwendet worden ist.
124
Erforderlich ist weiterhin das Vorliegen eines haftungsbegründenden wie haftungsausfüllenden Zurechnungszusammenhangs. Das Schadensereignis muss sich daher gerade als die Realisierung des aus der Fehlerhaftigkeit des Produkts folgenden Risikos darstellen und der eingetretene Schaden muss kausal auf dem Produktfehler beruhen.[224]
125
Gemäß § 1 Abs. 4 S. 1 ProdHaftG trägt der Geschädigte die Beweislast für den Fehler, den Schaden und den Zurechnungszusammenhang. Der Hersteller trägt die Beweislast für die Ausschlusstatbestände nach § 1 Abs. 2 und Abs. 3 ProdHaftG.[225]
126
Ersatzfähig sind sowohl Vermögens- als auch Nichtvermögensschäden.[226] Aus den §§ 6–10 ProdHaftG ergeben sich Einzelheiten in Bezug auf Inhalt, Art und Umfang des zu leistenden Schadensersatzes.
127
Aktivlegitimiert sind der Patient, seine Angehörigen und Dritte, welche etwa beim Gebrauch eines Medizinprodukts verletzt wurden.[227] Sie haben ihre Ansprüche gegen den passivlegitimierten Hersteller auf dem Zivilrechtsweg zu verfolgen.[228]
IV. Haftung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)
128
Letztlich kann auch § 1 Abs. 1 S. 1 OEG zu einem Versorgungsanspruch im Zusammenhang mit einem Arzthaftungsfall führen. Dieser opferentschädigungsrechtliche Grundtatbestand gewährt demjenigen, der infolge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs gegen seine oder eine andere Person oder durch dessen rechtmäßige Abwehr eine gesundheitliche Schädigung erleidet, wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen auf Antrag eine Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des BVG.
129
Voraussetzung ist, dass eine durch einen schädigenden Vorgang[229] hervorgerufene gesundheitliche Schädigung rechtsrelevante Folgen hervorgerufen hat. Der schädigende Vorgang i.S. eines tätlichen Angriffs setzt nach der Rechtsprechung des BSG eine in strafbarer Weise unmittelbar auf den Körper eines Anderen abzielende Einwirkung voraus.[230] So stellt beispielsweise ein ärztlicher Eingriff einen vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriff dar, wenn dieser als vorsätzliche Körperverletzung strafbar ist.[231] Das ist bei nahezu allen Aufklärungspflichtverletzungen der Fall.
130
Eine unmittelbare Schädigung[232] liegt vor, wenn eine durch den schädigenden Vorgang bewirkte primäre gesundheitliche Beeinträchtigung erfolgt[233]. Reine Vermögensschäden oder Sachbeschädigungen sind, mit Ausnahme der gemäß Abs. 10 genannten Hilfsmittel, von einem Entschädigungsanspruch ausgeschlossen.
131
Beim Fehlen von Versagungsgründen nach § 2 OEG gewährt § 1 Abs. 1 S. 1 OEG einen Versorgungsanspruch in entsprechender Anwendung des BVG. Gemäß § 7 Abs. 1 OEG ist grundsätzlich der Rechtsweg zu den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit eröffnet.
132
Aktivlegitimiert sind unmittelbar oder mittelbar geschädigte natürliche Personen, aber auch der nasciturus. Zudem können nach Abs. 8 auch Hinterbliebene Ansprüche geltend machen.[234]
133
Die anspruchsbegründenden Voraussetzungen des § 1 Abs. 1–3 OEG hat der Antragssteller/Kläger zu beweisen. Der Versorgungsträger trägt dagegen die Beweislast für das Vorliegen von Versagungsgründen nach § 2 OEG.[235]
A. Einleitung 1 – 6
B. Kenntnis von einem schadenskausalen Behandlungsfehler 7 – 68
I. Grundsatzentscheidungen zur Kenntnis von einem schadenskausalen Behandlungsfehler 8 – 21
II. Feststellungen zum Zeitpunkt der Kenntnis, Fallgruppen 22 – 51
1. Beweislasten 25 – 28
2. Rückschluss auf Kenntnis aus Anspruchsanmeldung bzw. Anschuldigungen der Patientin/des Patienten 29 – 38
3. Verhältnis von Kenntnis und herabgesetzter Substantiierungslast 39
4. Rückschluss auf Kenntnis aus Behandlungsfehlervorwürfen im Klagverfahren 40 – 44
5. Erkenntnisse im Rahmen der Nachbehandlung 45 – 48
6. Kenntnis durch MDK-Gutachten oder Schlichtungsstellengutachten 49 – 51
III. Mehrere Fehlervorwürfe, Behandlungseinheit oder selbstständige Nachteile 52 – 57
IV. Kenntnis – Spannungsverhältnis von unklarer Kausalität und Beweiserleichterungen 58 – 63
V. Kenntnis der vom Patienten beauftragten Anwälte und Wissensvertretung 64 – 68
C. Kenntnis von unzureichender Risikoaufklärung oder Alternativaufklärung 69 – 79
D. Grob fahrlässige Unkenntnis des geschädigten Patienten 80 – 90
E. Besonderheiten bei der Kenntnis und grob fahrlässigen Unkenntnis von Sozialversicherungsträgern 91 – 114
I. Grundsatzentscheidungen zur Kenntnis des SVT im Behandlungsfehlerbereich 93 – 98
II. Kenntnis durch Hinweise des Versicherten 99 – 101
III. Zumutbare Bemühungen um Klärung eines schadenskausalen Behandlungsfehlers 102 – 109
IV. Keine Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis durch einen Behandlungsfehler verneinendes MDK-Gutachten 110 – 113
V. Kenntniszurechnung bei einem Wechsel des SVT 114
F. Hemmung der Verjährung 115 – 163
I. Verjährungshemmung durch außergerichtliche Verhandlungen, § 203 S. 1 BGB 115 – 143
1. Beginn der Verjährungshemmung 116 – 118
2. Erstreckung der Verjährungshemmung auf angestelltes medizinisches und nicht medizinisches Personal 119, 120
3. Ende der Verjährungshemmung: 121 – 143
a) Ausdrücklicher Abbruch der Verhandlungen 122 – 127
b) Einschlafen der Verhandlungen 128 – 143
II. Verjährungshemmung während eines Verfahrens vor einer von den Ärztekammern eingerichteten Schlichtungs- bzw. Gutachterstelle nach § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB 144 – 149
III. Arzthaftungsrechtliche Besonderheiten der gerichtlichen Verjährungshemmung 150 – 163
1. Klagezustellung an einen Krankenhausarzt 151
2. Fehlerhafte Trägerbezeichnung 152 – 155
3. Verjährungshemmung durch Zuständigkeitsbestimmungsantrag 156, 157
4. Keine Verjährungshemmung durch unzulässige Streitverkündung 158, 159
5. Streitgegenstand und Hemmung nach § 204 BGB 160 – 163
G. Das Gebot des sichersten Weges, Verjährungsdiskussionen und Einredeverzichte 164 – 175
1
Das zentrale Problem der Verjährung in Arzthaftungssachen lag schon vor der Schuldrechtsmodernisierung und liegt seither mit der Umstellung auch der Verjährung der vertraglichen Ansprüche auf die 3-jährige, kenntnisabhängige Verjährung der §§ 195, 199 BGB darin, dass auf Patientenseite in aller Regel zunächst die Kenntnis fehlt, ob der negative Ausgang einer Behandlung auf die Grunderkrankung oder Behandlungsrisiken zurück geht oder auf ein fehlerhaftes Vorgehen der behandelnden Ärzte. Würde man den schlechten Ausgang der Behandlung für den Verjährungsbeginn ausreichen lassen, würden etliche Ansprüche ohne hinreichende Kenntnis der Patientenseite der Verjährung unterliegen.
2
Der BGH hat mit breiter Zustimmung schon nach § 852 Abs. 1 BGB a.F. zu den subjektiven Voraussetzungen des Verjährungsbeginns die Kenntnis vom schadenskausalen Abweichen vom ärztlichen Standard gerechnet und daran auch nach der Schuldrechtsmodernisierung zum Jahresbeginn 2002 festgehalten.[1]
Читать дальше