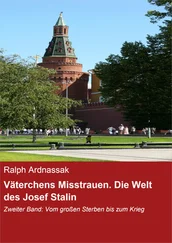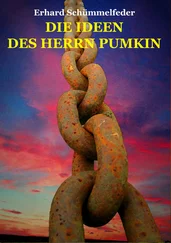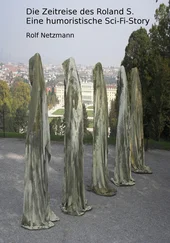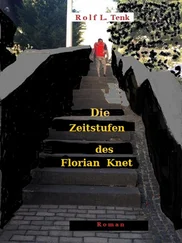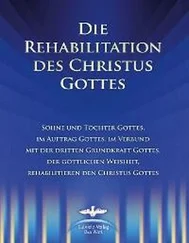Mit dem Ruf von F. A. Staudenmaier, einem Schüler Dreys, 1837 an die Freiburger Universität kommt Dieringer mit dessen theologischem Gedankengut in Kontakt. In der Folge veröffentlich er im Mainzer Katholik im Jahr 1838 einen Aufsatz „Über die Offenbarung als Vermittlung des höheren Lebens durch die Gottheit“ 26, in dem sein eigenes Theologieverständnis und sein Offenbarungsverständnis auf der Grundlage der Staudenmaierschen Schrift „Geist der göttlichen Offenbarung“ entwirft. Diese Schrift ist gleichsam die Grundlage des theologischen Konzepts Dieringers und ist ganz im Geiste der positiven Theologie gehalten. 27Die weiteren Werke und Arbeiten Dieringers werden diesen Ansatz einer Theologie, die sich ganz der positiven, geoffenbarten Wahrheit, wie sie in den Quellen von Schrift und (lehramtlicher) Tradition vorgefunden wird, verpflichtet fühlt, nicht mehr verlassen. Von genau diesem Geiste ist auch sein erstes größeres Werk geprägt, dessen ersten Band er noch in Freiburg als Repetitor schreibt und im Jahr 1840 vollendet. „Das System der göttlichen Thaten des Christenthums, oder: Selbstbegründung des Christenthums, vollzogen durch seine göttlichen Thaten.“ 28ist eine vehemente Verteidigung der Historizität der biblischen Wunderberichte als Ausdruck geschichtlicher Wirksamkeit Gottes in dieser Welt zur Stiftung der wahren Religion im Christentum. Der erste in Freiburg geschriebene Band wird von Dieringer auch „Polemik der göttlichen Thaten“ genannt, spricht sich deutlich gegen jede Form der Wunderkritik aus und beschreibt die Durchsetzung des Christentums gegenüber Juden- und Heidentum. 29Dieringer selbst schreibt im Vorwort des Werkes, dass das Buch seine Anregung in seiner Tätigkeit als „Lehrer der Kanzelberedsamkeit“ gefunden hat, als er den Seminaristen anhand der jeweiligen Schrift-Perikopen des Kirchenjahres auch die Vermittlung der Wunderberichte näher bringen wollte und kein geeignetes Kompendium in der Sache vorfand. 30Dieringer entschied sich dieses fehlende Buch selbst zu schreiben und dabei im Wesentlichen auf die Literatur der Kirchenväter zu rekurrieren. Vollenden konnte er den zweiten Band bereits als „Professor der Theologie am Bischöflichen Clerical-Seminar zu Speyer“ 31.
1.2.3 Professor in Speyer
War ihm die Einbürgerung in Baden und damit auch die Professur aufgrund seiner Schriften durch die badische Regierung verwährt worden, so hatten dieselben Schriften den Bischof von Speyer, Johannes von Geissel, dazu bewegt, Dieringer eine Professur für Dogmatik, Liturgik und Homiletik in seinem gerade gegründeten Priesterseminar anzubieten. 32Seinen Abschied von Freiburg hatte ihm die badische Landesregierung in einem Schreiben vom 8. März 1839 bereits nahe gelegt 33und dieser wird ihm auch wegen der innerkirchlichen Flügelkämpfe, die bis ins Seminar reichten, 34nicht schwergefallen sein. 35Da der Briefwechsel zwischen Dieringer und Bischof Geissel in dieser Sache erst im Sommer 1840 erfolgte 36, wird Dieringer wohl zum Herbst 1840 nach Speyer gegangen sein, wo er nur wenige Jahre bis 1843 wirkte. 37Im Jahr 1841 übernimmt Dieringer zusätzlich zu seiner Professur am Seminar noch eine Dozentur für Philosophie am Lyceum, einem Knabenseminar zur Vorbereitung auf das Theologiestudium. 38Im selben Jahr wird ihm durch die Universität München für das bereits erwähnte zweibändige Werk „System der göttlichen Thaten des Christenthums“ der Doktor der Theologie honoris causa verliehen. 39
1.2.3.1 Die Freundschaft zu Johannes von Geissel
Die kurze Zeit in Speyer ist für Dieringers weitere akademische Laufbahn als auch für sein kirchenpolitisches Engagement von nicht geringer Bedeutung. Mit der Annahme des Rufes nach Speyer zu Geissel beginnt eine bis zum Lebensende Geissels anhaltende enge berufliche Verbindung und persönliche Freundschaft zu diesem Bischof und späteren Kardinal. 40Seine Beziehung zu Geissel ist dabei von einem großen Vertrauen des Bischofs geprägt, das dieser ansonsten nur wenigen Menschen in seinem Umfeld schenkte. 41Geissel wird am 24. September 1841 von Papst Gregor XVI. zum Koadjutor-Erzbischof und Apostolischem Administrator von Köln ernannt. 42Erzbischof Clemens August Freiherr von Droste zu Vischering war infolge der sogenannten „Kölner Wirren“ (1837) zunächst verhaftet worden und lebte seit seiner Freilassung 1839 gleichsam exiliert in Münster. Geissel, der sein Koadjutoren-Amt erst 1842 antritt, 43wird sowohl innerkirchlich, als auch im Verhältnis zum Staat andere Wege als sein Vorgänger gehen. Dazu wird er auch in Köln erneut auf Dieringer zurückgreifen.
1.2.3.2 Chefredakteur der Mainzer Zeitschrift „Katholik“
Zunächst aber übernimmt Dieringer im Jahr 1842 zusätzlich zu seiner Lehrtätigkeit die redaktionelle Leitung der Zeitschrift „Katholik“, die zunächst 1821 in Mainz gegründet worden war, dann aber von der hessischen Regierung ins bayrische Speyer verdrängt wurde. 44Der Leiter und Gründungsredakteur des „Katholik“ Nikolaus von Weis wurde 1842 Nachfolger Geissels als Bischof von Speyer. 45Dieringer tritt damit an die Spitze eines der bedeutendsten katholischen Kirchenblätter im deutschsprachigen Raum. „Alles, was Rang und Namen im katholischen Deutschland besaß, beteiligte sich und verlieh diesem Blatte klassisches Profil.“ 46Dieringer befindet sich somit nur gut ein Jahr nach seinem Wechsel nach Speyer in der Position, gemeinsam mit renommierten Autoren, wie Möhler, Sailer, Döllinger, den Gebrüdern Brentano oder Görres 47zu veröffentlichen und sich so einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Der „Katholik“ zeichnet sich dabei als eher kirchpolitisches Blatt und weniger als theologische Fachzeitschrift aus. 48Alle Mitarbeiter des Blattes sind durch eine strengkirchliche, aufklärungsfeindliche und konservative Grundanschauung in kirchlichen und politischen Fragen geprägt und verbinden diese mit einer „schroffen Ablehnung jedes Staatskirchentums – unter Einforderung des eigenen Besitzstandes nach dem kanonischen Recht“. 49Diese Haltung war auch die Position Dieringers, wie sich in den Freiburger Auseinandersetzungen um seine Staatsbürgerschaft zeigt. Die Tatsache, dass Geissel, der sich ebenfalls unter den Autoren des „Katholik“ findet, und Weis, der einer der Gründungsredakteure des „Katholik“ war und nun neuer Bischof von Speyer ist, ihn in diese Position befördern, weist Dieringer eindeutig diesem ultramontanen Personenkreis zu. Dieringer sammelt somit in Speyer zunächst weitere Lehrerfahrung, erhält aber insbesondere in der einjährigen Leitung des „Katholik“ Einblick in die journalistische Arbeit der katholischen Kirchenblätter seiner Zeit und zudem Kontakt zu den führenden Köpfen des deutschen politischen Katholizismus. Mit Blick auf die gesamte Biographie Dieringers kann man wohl den Wechsel nach Speyer als die wesentliche Entscheidung im Lebensweg Dieringers bezeichnen. Es ist zum einen die dort beginnende Freundschaft mit Geissel, die von bestimmender Bedeutung werden wird für seinen weiteren Weg, aber auch der Einstieg in den Journalismus und die dazu nötige Fähigkeit der Reduktion und Vereinfachung theologischer Themen für die Rezeption in weiten Kreisen der (theologisch) ungebildeten katholischen Bevölkerung, die er nicht mehr wieder aufgeben wird. 50
1.2.4 Professor und Domkapitular im Erzbistum Köln
Geissel erwirkt noch vor Übernahme seines neuen Amtes gegenüber der Preußischen Regierung, dass ihm das Recht der missio canonica für die Theologieprofessoren und Religionslehrer zugestanden wird. Aufgrund seiner Kompromissbereitschaft in anderen Fragen kommt man ihm entgegen, um das zerrüttete Verhältnis zur Katholischen Kirche in Köln wieder zu normalisieren. 51Geissel stellt damit bereits im Vorfeld seines Amtsbeginns den formellen Frieden mit der Landesregierung her und erhält zugleich die Mittel in die Hand, um intern gegen die Anhänger der Lehren Georg Hermes’ vorzugehen, die 1835 durch Rom verurteilt worden waren.
Читать дальше