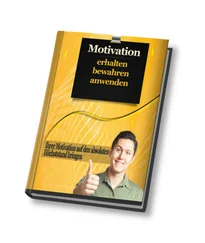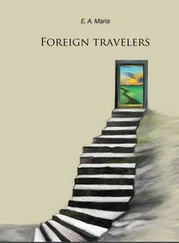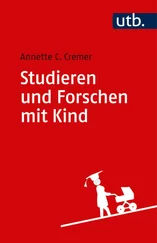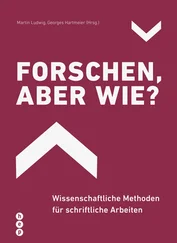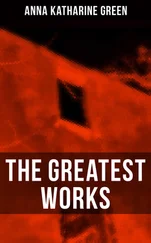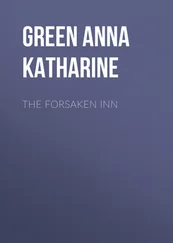Spätestens ab 1961, als die Ressortstruktur eingeführt worden war und damit den Konservatoren einzelne Sammlungsgebiete fest zugeteilt wurden, lag es im Ermessen der einzelnen Mitarbeitenden, welche Dokumentationen sie für ihre Arbeit für relevant hielten und in ihren Büroräumlichkeiten aufbewahren wollten. Sie erstellten teilweise eigene Karteien und Sachkataloge und führten eine gesonderte Dokumentation zu einzelnen Sammlungsobjekten. 97Manche Akten blieben aufgehoben, einige wurden auf den Fluren der Museumsverwaltung deponiert und andere der hausinternen Bibliothek übergeben. Das Museum verfügte zu keiner Zeit über ein zentrales, systematisch geführtes Institutionsarchiv. 98Viel wichtiger für die Museumsangestellten waren ihre Fachkataloge zu einzelnen Sammlungsstücken und Objektgruppen sowie ab Ende der 1970er-Jahre Ausstellungskataloge, die zu den Ausstellungen erschienen. 99
Die Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter berichten, dass viel Aktenmaterial in den 1970er- und 1980er-Jahren weggeworfen wurde, als die damalige Direktion anordnete, vorhandene Akten der Museumsarbeit zu sichten, zu sortieren und gegebenenfalls zu vernichten. 100Ich kann belegen, dass noch 1962 rund 80 Laufmeter ungeordnete Akten vorhanden waren. Die Rede ist von Protokollen, Urkunden, Verträgen, Gutachten, Gerichtsurteilen, Jahresrechnungen und Korrespondenz, die sich über Jahrzehnte wortwörtlich angesammelt hatten und die wegen der fehlenden Ordnung grossenteils als unbenutzbar galten. 101Es ist auch gegenwärtig sehr schwierig, sich in den Ordnungssystematiken und Notationssystemen der vorhandenen Dokumentationen und Akten zurechtzufinden. Kein Handbuch oder Ähnliches existiert, das Hilfestellung bieten könnte. Die Mitarbeitenden des Museums haben ihre je eigenen Such- und Orientierungsstrategien entwickelt.
Institutionsinterne Belange, die gegenüber dem Bund speziell ausgewiesen werden mussten, wurden dokumentiert und 1880 bis 1940 an das Bundesarchiv in Bern abgegeben. Anschliessend erfolgte eine ungeordnete Aktenabgabe. Im Bundesarchiv befinden sich hauptsächlich Personalakten der Museumsangestellten sowie Unterlagen zu einzelnen wichtigeren Entscheiden und Veränderungen, an denen die Departemente des Bundes und die Landesmuseumsbehörden beteiligt waren. 102Die Museumsdirektion und die Kommission des Landesmuseums hatten gegenüber der Exekutive die Pflicht, in Form von Jahresberichten über ihre Tätigkeiten Rechenschaft abzulegen. Zuhanden des eidgenössischen Departements des Innern wurde im Namen der Museumsdirektion und der Kommission des Landesmuseums Bericht erstattet. 103Die jährlichen Berichte informieren über personelle und administrative Veränderungen, publizieren die Jahresrechnung und, besonders interessant, berichten über die Arbeit der Kommission, der Direktion wie auch über die Tätigkeiten der Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Abgedruckte Fotografien geben zudem vereinzelt Einblick in die Arbeitsräume des Landesmuseums. 104Die Jahresberichte dienen als wichtige Quellen, um mehr über die Tätigkeiten im Museum und ihren jeweiligen Stellenwert zu erfahren. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Berichterstattung fast ausschliesslich die Perspektive der Direktion wiedergibt. Sie verfasste jeweils den grössten Teil eines Jahresberichts. 105
Es gibt noch einen zweiten wichtigen gedruckten Quellentyp, der im Gegensatz zu den Jahresberichten aber unveröffentlicht blieb: die Protokolle der Sitzung der Landesmuseumskommission. 106Die Kommission des Landesmuseums funktionierte als Bindeglied zwischen der Landesregierung und der Museumsdirektion. Sie traf sich mehrmals im Jahr, um über Objektankäufe und Finanzfragen sowie Zielsetzungen in der Sammlungs- und Museumspolitik zu beschliessen, welche die Kompetenz der Museumsdirektion überschritten. Die Protokolle der Sitzungen geben Einblick, welche Themen aus der Museumsarbeit jeweils politisch relevant waren. Doch sie sind keine «Handlungsprotokolle», 107aus denen Tätigkeiten und Meinungsbildungsprozesse genau nachvollzogen werden könnten. Die referierten Themen und Beschlüsse werden mehrheitlich zusammengefasst wiedergegeben.
Der beschränkten textlichen Basis und der unabgeschlossenen, in die Gegenwart hineinreichenden Quellenbestände werde ich mithilfe eines breiten Quellenbegriffs methodisch Rechnung tragen. Ich orientiere mich dafür an geschichtswissenschaftlichen Untersuchungen, die sich mit schriftlichen Quellen unterschiedlichster Gestalt und mit Themen befassten, welche nur indirekt über die traditionelle Schriftkultur erschliessbar sind. 108Ich orte und interpretiere die vielfältigen Zeichen(systeme) jenseits des Fliesstextes (Listen, Räume, Dinge), wobei die quellenkritischen Fragen nach dem Materialzustand, den Erhaltungsbemühungen, den Aufbewahrungsorten und der Zugänglichkeit der Quellen besonders gewichtet werden. Die Suche gilt den absichtslos(er)en Spuren und den Überresten. Der Quellenkontext «Museum» ist dafür besonders vielversprechend, weil hier der Archivierungsprozess und damit die Trennung von abgeschlossenen Dokumentationen der Vergangenheit und der gegenwärtigen Praxis fehlt. 109Demzufolge suchte ich die Spuren der Sammlungspraxis nicht nur in den Jahresberichten und den Protokollen der Museumskommission, sondern beispielsweise eben auch in den Objektinventaren. Weiter führte ich drei Leitfadeninterviews mit langjährigen Mitarbeitern wie auch weitere informelle Gespräche mit Mitarbeitenden. 110Zudem arbeitete ich phasenweise in verschiedenen Räumen der Museumsverwaltung, um den aktuellen Umgang mit den (historischen) Museumsakten kennenzulernen (Abb. 5).
Diese «Feldforschungen» 111im Museumsbetrieb ermöglichten den Zugang zu nicht aufgezeichneten Aspekten der Sammlungspraxis der letzten 30 Jahre. Auch manche Sammlungsstücke dienten als Quellen. Nicht anders als die anderen Quellentypen befragte ich sie quellenkritisch und setzte sie in Beziehung zu anderen (schriftlichen) Quellen. 112Das gilt es in Anbetracht des anhaltenden hype um die Dinge zu betonen, bei dem manchmal vergessen geht, dass die Dinge genauso wie Texte stumm sind. 113
Sammlungspraxis: anhäufen, forschen, erhalten
Um das heterogene Quellenmaterial, die Protokolle, Berichte, Inventare, Räume, Dinge und so weiter, in Text zu verwandeln und damit zu einer Geschichte zu machen, bietet sich eine qualitative Analyse an. Der grosse Untersuchungszeitraum – mehr als ein Jahrhundert Sammlungstätigkeit – verlangt nach punktuellen statt flächendeckenden Detailstudien. 114Sie bilden die Basis für eine Erzählung, welche die grossen Linien der Sammlungsgeschichte herausarbeitet. In einem induktiven Verfahren, ausgehend von der analytisch-deskriptiven Erschliessung der Quellen, habe ich drei Leitbegriffe entwickelt, welche die Geschichte thematisch und chronologisch strukturieren: Entlang der drei Begriffe anhäufen, forschen, erhalten gliedere ich die Arbeit in drei Kapitel. Als Klammerbegriffe der Kapitel zeigen die drei verschiedenen Verben, dass die Schwerpunkte in der Sammlungspraxis des Schweizerischen Nationalmuseums sich während des 20. Jahrhunderts wesentlich veränderten und dass aus der Untersuchung der Praktiken nicht eine übergreifende Erzählung resultiert. Anhäufen steht für die 1900er- bis 1920er-Jahre, forschen umfasst die anschliessende Zeitspanne bis in die 1960er-Jahre, während erhalten die 1970er- bis 2000er-Jahre betrifft. Die Begriffe funktionieren als thematische Rahmen, wobei bisweilen die Erzählbogen auch in andere Jahrzehnte gespannt werden. Sie markieren die jeweils wichtigsten Sammlungspraktiken eines bestimmten Zeitraums, was nicht bedeutet, dass damals nicht auch andere Praktiken ausgeübt wurden. Nur standen sie nicht derart im Zentrum.

Abb. 5: Katalogbüro nach dem Umbau mit K. Jaggi und A. Siegrist-Ronzani, Schweizerisches Landesmuseum, Raum 421, 1995, SNM Dig. 28836. Der Raum sah praktisch gleich aus zur Zeit der Recherche.
Читать дальше