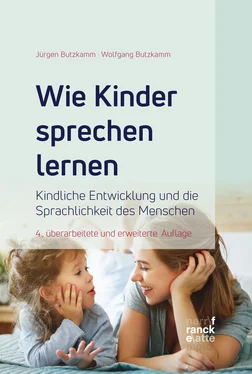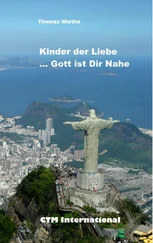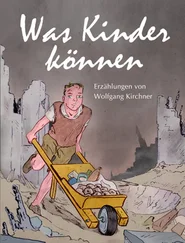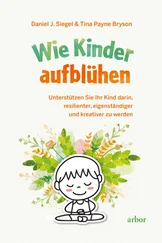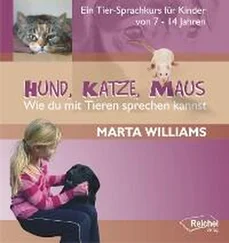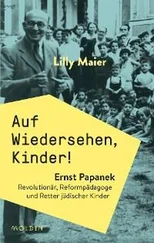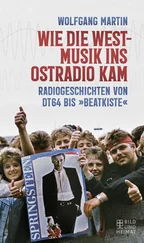Nie mehr in unserem Leben brauchen wir soviel Fürsorglichkeit und soviel Gegenwart der uns vertrauten Personen wie in den ersten drei Lebensjahren.
Die zahllosen, unverläßlich-flüchtigen, jederzeit aufkündbaren Beziehungen der Erwachsenen sind nicht Sache des Kindes. Kinder brauchen die Dauerbetreuung durch wenige Personen. Das ist schon aus sprachlicher Sicht einleuchtend und auch in Säuglingsheimen möglich. Die Kommunikation klappt am besten mit denen, die das Kind ständig betreuen und Stück für Stück miterleben, wie sich das Kind Welt und Sprache erobert. Nur durch ständiges Dabeisein kann man sein Ohr für die unvollkommenen Artikulationen des Kleinkinds schulen und sie auf Anhieb verstehen. So ist es gar nicht selten, daß Mütter die Dolmetscher selbst für diejenigen Väter spielen müssen, die ihr Kind täglich sehen.
Dennoch brauchen unter Dreijährige nicht ständig am Rockzipfel der Mutter hängen. Sie können durchaus auch feste Bindungen außerhalb ihrer Familie aufbauen. Wenn, ja wenn die öffentliche Kinderbetreuung dies im Auge behält und die Bedingungen dafür schafft, können auch Krippenkinder gedeihen. In traditionellen Kleingesellschaften wachsen Dreijährige oft in altersgemischten Gruppen auf und eine ganze Dorfgemeinschaft übernimmt die Erziehungsarbeit. Jahrtausende lang war eine breit abgestützte Betreuung in der Horde die Norm.
Die Verläßlichkeit der Welt ist auch eine Verläßlichkeit der Dinge. Das Kind drückt auf die Klinke, und die Tür gibt nach. Es greift nach dem Löffelchen, und das läßt sich widerstandslos fortnehmen. Von einem Malstift kann man die Kappe abnehmen und wieder aufstecken. Wieder andere Sachen sind fest und lassen sich gewöhnlich nicht von der Stelle bewegen. Es bläst in seine Kindertrompete hinein, und es gibt einen Ton. Es bläst in Seifenlauge hinein, und schon steigen schillernde Blasen auf, die zerplatzen, wenn man sie antupft. Papier kann man zerreißen und zerknüllen. Schlüssel passen in Schlüssellöcher, wenn man lange genug stochert. Ein bißchen Druck oder Zug an der richtigen Stelle genügt, und schon rauscht ein Wasserschwall daher und spült alles fort. Man drückt das Plastikentchen unter Wasser. Wenn man es dann losläßt, schießt es wieder an die Oberfläche. So lassen wir uns von den Dingen belehren, bilden Erwartungen, tragen sie wieder in die Welt hinein und werden nicht enttäuscht. Solche Urerfahrungen mit den Menschen und den Dingen werden nicht von der Sprache geschaffen, aber in sie aufgenommen. Das ist die Bodenhaftung der SpracheSpracheBodenhaftung der Sprache, ihre Erdung.3
Ein Vater beobachtet seinen Sohn:
Sein ganzes Interesse gilt dem Löffel. Nicht um damit zu essen. Um zu sehen, wie er reagiert, wenn man etwas zu ihm sagt. Oder wenn man ihn berührt. Er stößt ihn sachte an. Gibt ihm einen Schubs. Als möchte er sehen, was nun der Löffel tut. Ob er Antwort gibt. Oder ob er still liegen bleibt. Noch ein kleiner Schubs – und der Löffel fällt zu Boden. Pierre kann ihn nicht wieder aufheben. Er murrt. Nichts geschieht. Er beginnt zu schreien. Ich hebe den Löffel für ihn auf. Pierre lächelt. Gibt ihm einen kräftigen Schubs, so daß er wieder zu Boden fällt. Ich hebe ihn auf. Er wirft ihn weit weg und quietscht vor Vergnügen. Pierre und die ihn umgebende Welt. Er schaut. Er patscht. Er klopft. Er schreit. Er versucht. Er will herausfinden, wie das funktioniert. Was dahintersteckt. Er klapst hierhin. Nochmals. Sieh an. Und nochmals. Nun ist er überzeugt davon. Alles, was ihm einfällt, muß gleich ausprobiert werden. Ob das geht? Er versucht es. Er versucht, die Welt und die Kräfte, die in ihr wirken, zu verstehen.4
SpiegelbildSpiegelbild und EmpathieEinfühlungsvermögen (Empathie)
Ohne die Liebe zu sich selbst ist auch die Nächstenliebe unmöglich.
(Hermann HesseHesse, Hermann)
Bubi Scupin schien sich im Alter von einem Jahr im Spiegel zu erkennen. Haben sich die Eltern da getäuscht? Als Einjähriger und noch später drückte DarwinsDarwin, Charles Sohn sein Gesicht auf den Spiegel und küßte sein Ebenbild – gewiß kein Indiz dafür, daß er sich im Spiegel erkannte.1 Nach neueren systematischen Beobachtungen erkennen sich Kinder in Einzelfällen ab 15 Monaten. Die meisten brauchen bis zu zwei Jahren, bis sie merken, daß sie sich selbst gegenüberstehen. Dann sind Kinder auch in der Lage, das eigene Spiegelbild mit dem eigenen Namen bzw. mit »ich« zu bezeichnen, und können sich auch auf Fotos erkennen. In der geistigen Entwicklung stark zurückgebliebene Kinder erkennen ihr Spiegelbild spät oder gar nicht. Den klassischen Markierungstest bestehen aber auch Schimpansen, Zwergschimpansen (Bonobos), Orang-Utans, Elstern und andere Rabenvögel. Denn wenn sie sich im Spiegel sehen, wischen sie sich den von den Forschern aufgemalten roten Farbtupfer von der Stirn, anstatt ihn nur auf dem Spiegelbild zu bemerken.Darwin, Charles2 Andere Tierarten sehen gewöhnlich im Spiegelbild den Artgenossen, an dem sie bald das Interesse verlieren. Aber die Forschung zur Selbstwahrnehmung von Tieren geht weiter, z.T. mit modifizierten Tests, die den Eigenwelten der Tiere besser entsprechen als ein Sehtest.3
Setzen Sie einfach Ihr Töchterchen vor den Spiegel und schauen Sie zu, was es macht. Berührt es den Spiegel mit dem Gesicht? Will es seinem Bild etwas anbieten, wirft es ihm einen Ball zu? Versucht es, hinter den Spiegel zu schauen wie hinter eine Wand? Oder zeigt es ein scheues, verlegenes Lächeln und wirft verstohlene Seitenblicke auf sein Ebenbild? Befangenheit und Vermeidung könnten als Übergang zum Selbsterkennen gelten, als erstes Indiz dafür.
Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, malen Sie Ihrem Töchterchen, wie es die Forscher mit Kindern und Äffchen taten, unbemerkt einen dicken roten Farbklecks auf die Stirn. Faßt es sich jetzt verwundert an die eigene Stirn anstatt nur nach dem Fleck im Spiegel zu greifen? Will es sich den Fleck wegwischen? Schneidet es Grimassen, um zu sehen, wie das aussieht? Dann gibt es wohl keinen Zweifel, daß es sich erkannt hat.

Wie alle Affen reagieren Berberaffen beim ersten Anblick ihres Spiegelbildes mit einer Mischung aus Erstaunen und Vorsicht.
Die Münchener Verhaltensforscherin Doris Bischof-KöhlerBischof-Köhler, Doris hat eine Kindergruppe, die sie anhand des Spiegeltests in »Nichterkenner«, die ihr eigenes Spiegelbild für eine Fremdperson hielten, »Übergänger« und »Erkenner« einteilen konnte, vor folgende Situation gestellt: Eine erwachsene Spielpartnerin – nicht die Mutter, die im Hintergrund dabeisitzt – hatte ihren Teddybären mitgebracht. Sie verwickelt das Kind in ein Spiel, wobei nach etwa 20 Minuten dem Teddy beim Ausziehen eines Jäckchens »versehentlich« ein Arm abfällt. Die Spielpartnerin mimt Trauer, schluchzt und schneuzt sich: »Mein Teddy ist kaputt!« Wie reagieren die Kleinen?
Es gab »Helfer«, die ihre ganze Aufmerksamkeit der trauernden Partnerin und dem »armen« Teddy widmeten, sich ruhig und direkt neben sie setzten, ihr zum Trost ein anderes Spielzeugtier anboten, selbst den Teddy reparieren wollten oder zur Mutter liefen und sie zur Reparatur aufforderten. Es gab zweitens verwirrte, ratlose Kinder, die nichts unternahmen, und drittens deutlich »Unbeteiligte«, die das Ereignis nicht weiter zu berühren schien.4
Vergleicht man nun »Farbtupfer-Test« und »Empathietest«, so ergibt sich ein hochinteressanter Befund: Ausnahmslos alle »Helfer« waren zugleich Kinder, die sich selbst erkannt hatten; umgekehrt gehörte keiner der »Nichterkenner« zu denen, die sich in die Betrübnis der Partnerin einfühlen konnten und sie zu trösten versuchten. Folgerung: Sich selbst erkennen ist eine Voraussetzung für die Fähigkeit, sich mitfühlend in die Lage des anderen hineinzuversetzen und Anteil an seinem Glück oder Unglück zu nehmen. Ähnlich ist die bewußte Verfügung über eigenen Besitz Voraussetzung dafür, daß das Kind auch Achtung vor fremdem Eigentum entwickelt. Wer sich seiner selbst bewußt wird, sieht auch das »Du«. Und umgekehrt: Indem wir uns auf ein »Du« zubewegen, werden wir zum »Ich«. Im anderen erfaßt der Mensch den anderen als ein zweites »Ich«. Später wird klar: Nur wer sich selbst annimmt, kann auch andere annehmen.
Читать дальше