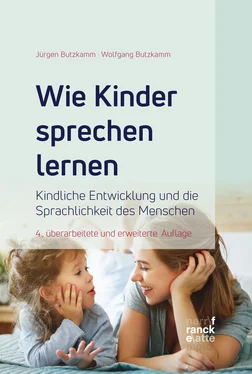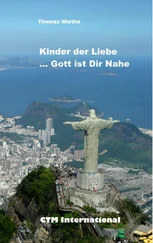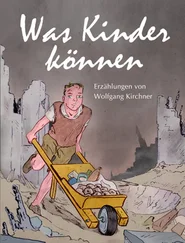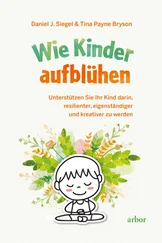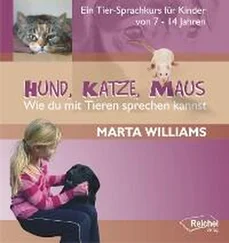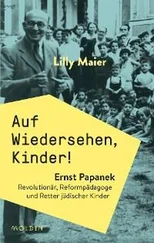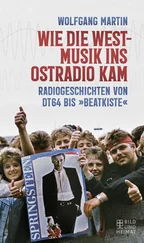1 ...6 7 8 10 11 12 ...31 Eines Morgens erklärte uns Gisa, sie gehe nun auf Besuch, und machte, ungebeten, ihre Runde bei den Nachbarsfrauen, egal, ob es da Spielgenossen gab oder nicht. Geborgenheit befreit. Wer sich im Schutz der Familie aufgehoben weiß, ist schneller selbständig und bereit, es mit der Welt aufzunehmen und Erfahrungen zu sammeln. Eine Gruppe von Babys im Alter von sechs bis vierzehn Wochen wurde beim freien Spiel in der Gegenwart ihrer Mütter beobachtet. Dabei wurde festgehalten, wie oft und wie lange sie jeweils den Blickkontakt mit ihrer Mutter suchten. Es gab »Viel-Schauer«, die also immer wieder die BindungBindung, personale B. zur Mutter suchten und fanden, »Wenig-Schauer« und »Blickvermeider«. Dieselben Kinder wurden zwei Jahre später noch einmal gefilmt, wie sie sich an einem neuen, dafür extra konstruierten Spielzeug zu schaffen machten, an dem es viel auszuprobieren gab. Bei den Viel-Schauern, die schon früh und intensiv Bindung gesucht und gefunden hatten, war die Bereitschaft, den neuen Gegenstand zu begucken, zu betasten und auszukundschaften – mit anderen Worten: die Lernbereitschaft – am stärksten ausgeprägt! Das Kleinkind muss zwei Bedürfnisse, die miteinander in Widerstreit geraten können, austarieren: das Bedürfnis nach Sicherheit and das Verlangen, Neues zu unternehmen und hinzuzulernen.
Freuen Sie sich also, wenn Ihr Krabbelkind alle Schubladen ausräumt, an die es herankommt. Es folgt einem Lerntrieb, durch den es später auch die Sprache meistern wird. Und es wagt sich nur an das Unbekannte heran, weil es sich bei Ihnen behütet fühlt, weil es ihm momentan gut geht. Ist es hungrig, müde, ängstlich oder gar krank, dann sucht es Trost und klammert sich an die Mutter. Das ExplorierenExplorieren – und damit das Lernen – hört schlagartig auf. Hier zeigen sich schon früh Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Mädchen waren gegenüber neuen Spielsachen zurückhaltender, Jungen erkundeten länger, wagten sich weiter weg, riskierten einfach mehr, weinten aber auch häufiger und heftiger, wenn etwas schiefging und ihre Sicherheit zusammenbrach.2
»Der sich entwickelnde Mensch braucht nicht motiviert zu werden«, schreibt Leo Montada, Mitherausgeber des führenden Lehrbuchs zur Entwicklungspsychologie, »seine Erkenntnismöglichkeiten drängen nach Erprobung und Anwendung. Ein Kleinkind, das gerade werfen gelernt hat, wirft, was immer ihm in die Hände kommt.«
Nur Menschen ist es zugedacht, diesen Zauber des Anfangs durch die Zeit zu retten – bis ins Alter hinein.
Kinder brauchen die Nestwärme einer beständigen Kleingruppe. Zu dieser Nestwärme gehört die Vertrautheit, die durch fortwährende Kommunikation von der Stunde der Geburt an entsteht und in die – zunächst nur auf Seiten der Eltern – Sprache untrennbar verwoben ist.
Der Bettelmönch und Geschichtsschreiber Salimbene von ParmaSalimbene von Parma berichtet über ein Experiment seines Kaisers, des Hohenstaufen Friedrich II.Friedrich II (der Staufer):
Und deshalb befahl er den Ammen und Pflegerinnen, sie sollten den Kindern Milch geben, daß sie an den Brüsten saugen möchten, sie baden und waschen, aber in keiner Weise mit ihnen schön tun und zu ihnen sprechen. Er wollte nämlich erforschen, ob sie die hebräische Sprache sprächen, als die älteste, oder griechisch oder latein oder arabisch, oder aber die Sprache ihrer Eltern, die sie geboren hatten. Aber er mühte sich vergebens, weil die Knaben und (andern) Kinder alle starben. Denn sie vermöchten nicht zu leben ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen und Näherinnen.Salimbene von Parma1
Der Mensch lebt eben nicht von Brot allein. Die auf kaiserliches Geheiß gewiß gut umsorgten Babys starben, wie Salimbene wohl richtig vermutet, weil es ihnen an liebevollem Zuspruch fehlte. Seelische Leiden – so wissen wir heute – können das Immunsystem schwächen, und auf diese Weise könnten die Kinder für allerlei Infektionen anfällig geworden sein. So zeigen uns die Kleinkinder, was wir auch später noch brauchen, wenn wir an Körper und Psyche gesund bleiben wollen. Wir brauchen Beständigkeit. Häufiger Wechsel kann uns auf die Dauer nicht zufriedenstellen. Wir brauchen einige wenige, aber echte Freunde. In der Not sorgen wir für sie und sie für uns. Unmittelbarer Ausdruck solcher Freundschaft und Fürsorge ist – ähnlich wie beim Baby – der Körperkontakt: Händedruck und Umarmungen, aus Freude oder um zu trösten. Erst die Geborgenheit der Kleingruppe macht weitere wechselnde Kontakte, die auch der geistigen Erneuerung dienen, lohnend und sinnvoll.
Nach BowlbyBowlby, John, dem Londoner Kinderarzt und Senior der Bindungsforschung, sind enge BindungenBindung, personale B. an andere Menschen der Angelpunkt unseres Lebens bis ins Greisenalter.2 Aus ihnen gewinnen wir die Stärke, das Leben zu meistern und zu genießen.
Harry und Margaret HarlowHarlow, Harry und Margaret unterscheiden fünf Arten von Liebe bei Affen und Menschen: die Liebe der Mutter zum Kind (1), die Anhänglichkeit des Kindes an die Mutter (2), die Zuneigung des Vaters zum Kind (3) und umgekehrt (4), und, nicht zu vergessen, die Freundschaft der Geschwister und Spielkumpane untereinander (5). Fehlt in der Kindheit eine von ihnen, so ist mit Entwicklungsstörungen zu rechnen.3
Später ermöglichen diese frühen Liebeserfahrungen auch die geschlechtliche Liebe.4 In kulturvergleichendenKulturvergleich Untersuchungen hat sich herausgestellt, daß es vor allem auf die Responsivität der Mutter ankommt.5 Wenn wir geliebt werden, halten wir uns auch für wert, geliebt zu werden. Daraus fließt unser Selbstwertgefühl und die Sicherheit, die uns befähigt, die Welt zu erkunden.
TrotzenTrotz ist natürlich
Verena holt ihre Tochter bei der Tagesmutter ab. Statt wie immer freudig auf sie zuzulaufen, blickt sie kurz auf, sagt »nein« (eines ihrer ersten Wörter) und wendet sich wieder ihrer Beschäftigung zu. Nein – aus heiterem Himmel. Das schmerzt, braucht es aber nicht. Die 14 Monate alte Olivia ist einfach dabei, ihren eigenen Willen zu entdecken und probiert ihn aus: sie will eben jetzt noch nicht abgeholt werden. In diesem Alter beginnt das Kind sehr deutlich Wut und Ärger zu äußern, wenn es etwas nicht soll oder nicht bekommt, was es haben will. Aber Verbote müssen sein, und Regeln müssen eingehalten werden. Sie werden umso wichtiger, je selbständiger das Kind in die Welt ausgreifen und sich auch selbst in Gefahr bringen kann. Ziel jeder Erziehung muß sein, die Einhaltung von Regeln und Verboten einsichtig zu machen. Die folgenden Episoden vom 16 Monate alten Bubi zeigen, wie Sprache hier mitwirkt:
Er hat eine besondere Vorliebe für Nippessachen, Blumentöpfe und Aquariengläser und versucht trotz vieler Verbote immer wieder danach zu greifen. Doch bewies er schon sehr niedlich, daß er das Verbot begriffen hat, indem er beim Vorbeigehen an den verbotenen Gegenständen die Hände fest an sein Kleid legte, den Kopf schüttelte und »nein, nein!« sagte, wobei er uns so recht verständig und brav ansah.
Heute kratzte er die Mutter und schüttelte, als sie ihn zürnend ansah, schnell den Kopf und sagte: »Nein, nein!« Als wolle er dadurch seine Missetat zurücknehmen.
Wird der Knabe wegen einer Unart gescholten, versucht er recht schlau unsere Aufmerksamkeit von sich abzulenken, indem er plötzlich auf etwas zeigt: »Da, tickta. Da, bau!«
Hat man den Jungen durch einen leichten Schlag auf die Finger oder ein unfreundliches Wort oder durch Wegnahme eines als Spielzeug erwählten Gegenstandes beleidigt, so steht er erst mürrisch da, auf alle Fragen antwortet er nur finster: »nein!« Dann ignoriert er unsere Anwesenheit vollständig, tut, als wären wir Luft und beginnt allein für sich zu spielen; begegnen sich zufällig unsere Blicke mit denen des Knaben, so dreht er uns sofort den Rücken zu: »Nein!«1
Читать дальше