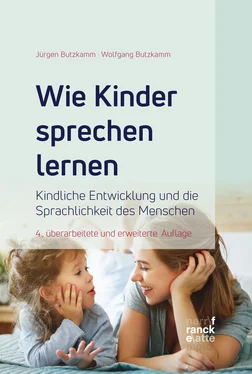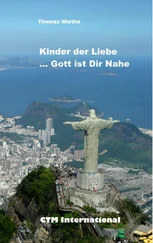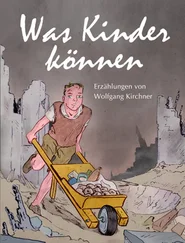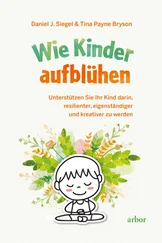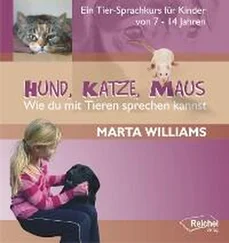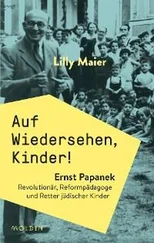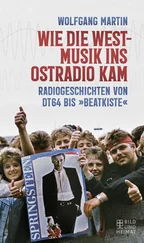BrunerBruner, Jerome S. hat detailgenau dokumentiert, wie Mütter ihren Kindern zunehmend mehr Spiel- und später Sprechanteile überlassen und bereit sind, die Dirigentenrolle an sie abzutreten.1 Er spricht vom hand-over-principle hand-over-principle. Etwa so:
die Mutter führt ein Spielchen ein
das Kind macht nach
das Kind macht mit
das Kind ergreift selbst die Initiative und führt Regie
Der Drang der Kinder zur Selbständigkeit, dem die Mütter so klug nachgeben, ist natürlich nicht auf das Sprechenlernen beschränkt. Ich erinnere mich, wie Gisa über eine Mauerkrone lief und irgendwann meine helfende Hand fortstieß: »Gis leine« (Gisa kann das alleine). Ebenso Bubi: Als die Mutter ihn füttern wollte, nahm er ihr den Löffel aus der Hand: »Nein, Bubi leine«, und versuchte wirklich leidlich geschickt, allein zu essen.2
Andere Kinder gebrauchen ähnliche Formeln:
Kann helber! (= selber)
Helber machen! Auch machen wollen!
Nein, ich!
Can manage!
Mareike (1;11) sagt in einem besonderen Tonfall Mama!, um auszudrücken: Laß das; ich mach das.3
Bubi (3;2):
Beim Blättern im Bilderbuch wünscht Bubi jetzt meistens ungestört zu sein und fragt nur noch selten nach der Bedeutung der Bilder; er legt sich ihren Sinn lieber selber aus, die Gestalten werden lebendig, er füttert die abgebildeten Tiere und unterhält sich drollig mit Personen und Tieren; dabei schlägt er zu unserem Ergötzen immer einen recht gönnerhaften Ton an.4
Wie eng gehen soziales und sprachliches Lernen zusammen! Bubi weiß, daß es ganz bei ihm liegt, ob oder wieviel er seine Tiere »füttert«, und er beherrscht auch schon den passenden »gönnerhaften« Ton.
Das Prinzip der RollenübergabeRollenübergabe, Prinzip der R. ist in der Pädagogik als das Prinzip des selbsttätigen, eigenverantwortlichen Lernens hinlänglich bekannt, verwandt auch mit dem Grundsatz des learning by doing . Von einem amerikanischen Sprachpädagogen stammt der Ratschlag: Teach, then test, then get out of the way . Zeig, wie’s geht; schau, ob du verstanden worden bist; danach nimm dich zurück. Ein Zyklus, der stets mit dem Rückzug des Lehrers endet. Dann heißt es: Now it’s up to you! – Du bist jetzt dran! Auf dich kommt’s jetzt an!
So kann die Schule der Natur manches abgucken. Jedenfalls ist jede Sprachlehrmethode auch daran zu messen, ob und wie sie diesen Rollenwechsel regelmäßig einplant und herbeiführt. »Übrigens ist mir alles verhaßt, was mich bloß belehrt, ohne meine Tätigkeit zu vermehren oder unmittelbar zu beleben«, bekannte GoetheGoethe, Johann Wolfgang von. Führen und Wachsenlassen gehören zusammen. So bekommen wir Kinder, die sich ihr Können selbst erschließen, sich aktiv Ziele setzen und später bereit und fähig sind, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen.
Ein folgenreicher Befreiungsschritt
Wenn die Sprache auf den Plan tritt, kann die Kommunikation zwischen Eltern und Kind in ganz neue Dimensionen vorstoßen. Sprache ist dann nicht nur Verständigungsmittel, sondern darüber hinaus ErkenntnismittelSpracheErkenntnismittel. Sie wird in der Folge immer weniger an das unmittelbare Vor-Augen-Sein von Personen, Ereignissen und Gegenständen gebunden sein. Die gemeinsame Situation und der aushelfende, verständige Partner können wegfallen. Diese Lösung von der konkreten Sprechsituation feierte Karl BühlerBühler, Karl als »die Erlösung der Sprache aus dem Zeigfeld«, für ihn ein entscheidender »BefreiungsschrittDenkenFreiheit des Denkens (durch Sprache) … im Werdegang der Menschensprache«.1 Einer mit noch unabsehbaren Folgen. Denn das Nicht-Hier und Nicht-Jetzt werden mitteilbar, dann auch das Fiktive, bloß Ausgedachte und Fantasierte. Die Dinge, die Ereignisse, die anderen – kurz die ganze Welt – können wir jetzt im Kopf ordnen, uns zurecht legen und zurecht rücken; im Geiste können wir damit umspringen, wie wir wollen, auch mit uns selbst. Lesen wir ein Buch, so werden wir allein durch Sprache in die abenteuerlichsten Ereignisse verstrickt. Wenn wir es ihm gestatten, kann sich ein Stück fremdes Bewußtsein – das des Schreibers – über Abgründe von Zeit und Raum hinweg in unserem eigenen einnisten. Wie alle anderen Geschöpfe hat auch der Mensch nur ein Leben. Aber nur ihm ist es geschenkt, durch Wort und Schrift zugleich tausend andere Leben mitzuleben.
Zur weltabbildenden Funktion der Sprache kommt die welterzeugende. Damit ist der Mensch nicht bloß das Tier, das schlicht eine weitere Nische, eben die kognitive, besetzt. Mit seiner Sprache ist er mehr als nur Tier unter TierenMensch-Tier-Vergleich.
Weltbemächtigung durch Wörter
Die Worte der Kindheit – diese unsre frühen Gespielen in der Morgenröte des Lebens, mit denen sich unsre ganze Seele zusammen bildete…
(Johann Gottfried HerderHerder, Johann Gottfried)
Die Sprache gleicht dem im Stein schlummernden Feuerfunken. Ehe man gelernt hatte, ihn hervorzulocken, schien sein Dasein nur durch ein Wunder erklärlich. Einmal entzündet, pflanzte er sich mit unglaublicher Leichtigkeit fort.
(Wilhelm von HumboldtHumboldt, Wilhelm von)
ArtikulationsproblemeArtikulation
Mit Spannung erwarten wir das erste Wort aus dem Mund unseres Kindes. Wird es Mama oder Papa sein? Solche Silbenverdoppelungen, in denen die zweite Silbe die erste wie ein Echo verstärkt, begegnen uns ja schon in den Lallmonologen der Babys und ziehen uns vielleicht deshalb auch später noch magisch an: Lolo, Dodo, Joujou … Noch ein anderes, besonders wichtiges Wort entnehmen wir dem SilbenplappernSilbenplappern des Babys: ba für alles, was das Baby nicht an den Mund führen oder tun soll, oder verdoppelt als baba – vielleicht weil wir ganz sicher sein wollen, daß das Baby uns gut versteht.1
Was darf als erstes selbständig gebrauchtes Wort gelten? Eigentlich nicht das, was nur direkt nachgeplappert wird. Es sollte spontan gebraucht werden, mit klarer Bedeutungszuordnung. Mama und Papa haben gute Chancen, es sind die anatomisch wahrscheinlichsten Erstsilben: bei /p/ und /m/ sind die Lippen fest geschlossen und öffnen sich voll zum /a/-Vokal. Es gilt das Prinzip des maximalen Kontrasts: der ganz geschlossene, dann der ganz geöffnete Mund. In vielen Sprachen der Welt fungieren diese Silben denn auch als Namen für Vater und Mutter, zusammen mit der Silbe /ta/, wo der Verschluß statt von den Lippen von den Zähnen gebildet wird. Die »weichen« Varianten /ba/ und /da/ gehören ebenfalls dazu, ja, sind anfangs von /pa/ und /ta/ kaum zu unterscheiden. /k/ und /g/ bilden den Verschluß im hinteren Mundraum, kommen meist später und werden zunächst in typischer Weise durch schon beherrschte Laute ersetzt, also »tomm« statt »komm«. Noch länger lassen l und r auf sich warten, also kann man oft »Tampe« statt »Lampe« und »hot« statt »rot« hören. Viel später kommen die schwierigen Laute, die man auch aus dem Fremdsprachenunterricht kennt, wie die französischen Nasalvokale, bei denen die Luft durch Mund und Nase gleichzeitig entweichen muß, und das englische »th«, bei dem die Zungenspitze die oberen Schneidezähne nur ganz leicht touchieren darf. Alec Guinness erinnert sich, daß es ihm noch als Zehnjährigem gelegentlich passierte, das »th« durch /f/ zu ersetzen, was ihm einmal eine gehörige Abreibung einbrachte: er hatte beim Vorlesen einen Bibelvers verhunzt. Bleiben noch hintereinander hängende Konsonanten, die zunächst auf einen Konsonanten reduziert werden, also »Neemann« statt »Schneemann«, »Piegel« statt »Spiegel« oder auch »neifen« statt »kneifen«. Man denke auch hier ans Englische, wo das k vor n überall gefallen ist wie in know und knife : Waren die Kinder das Vorbild?
Читать дальше