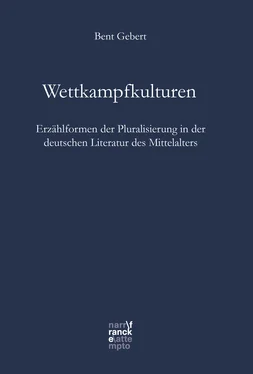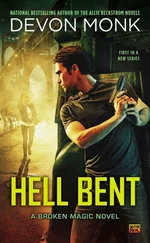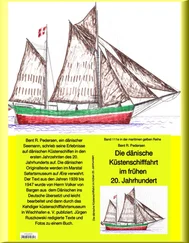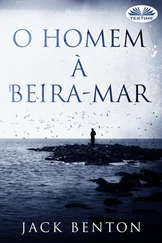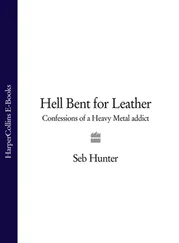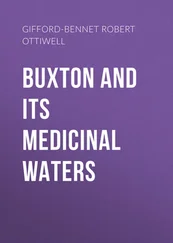Bent Gebert - Wettkampfkulturen
Здесь есть возможность читать онлайн «Bent Gebert - Wettkampfkulturen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Wettkampfkulturen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Wettkampfkulturen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Wettkampfkulturen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Wettkampfkulturen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Wettkampfkulturen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Zwar wird also der Kampf als unbeobachtbar im Innern postuliert (V. 31: verswigen ungemach ), doch verschreibt sich der Dialog genau dieser Beobachtung des Unbeobachtbaren. Als »Ort einer intellektuellen Auseinandersetzung« schlechthin trägt der Begriff des muot diese paradoxe Einschachtelung.74 Er bezeichnet einerseits die gesamte Form, indem er den gesamten Gesprächsraum konstituiert (V. 25). Andererseits bezeichnet er die uneinsehbaren Grenzen, die Herz und Körper fortlaufend ziehen, unterlaufen und nachziehen; indem Hartmann vom muot im muot erzählt (V. 140, 208, 662, 916 u.ö.), bringt er somit die mentale Einheit von Opposition und Zusammengehörigkeit auf den paradoxen Begriff.
In formalem Sinne wird damit das Selbst als Kulturierungsraum entworfen – als Serie ineinander gestaffelter Räume, die einander bedingen, aber sich kommunikativ zugleich autark abgrenzen (bis hin zu Rückzugsphantasien, V. 380f., oder zur Komik unmöglicher Tötungswünsche), die füreinander intransparent sind, obgleich sie sich als interdependent begreifen. Angesichts solcher paradoxen Innengrenzen überrascht es nicht, dass auch der für die Latenzarchitektur zentrale Begriff des muot ebenfalls ambivalent konnotiert ist. Einerseits betrachtet das Herz den muot ganz allgemein als eigene Domäne, über die es herrsche (V. 916); andererseits muss es anerkennen, dass dem Körper nicht einfach rehte[r] muot (V. 580) aufzudiktieren ist, sondern dieser sich auch selbst orientiert (wenn auch zum Schlechten, V. 243: bœser muot ), dass der Körper unbeweglich in Bequemlichkeit verharren (V. 860) oder unbelehrbar bleiben kann (V. 815: vil lêre ich an dir verlôs ). Auch das Herz konstatiert daher: Uns dienet niht gelîcher muot (V. 945). In verwirrend dichter Abfolge reiht der Dialog somit muot als Gesamtmedium, als rationales Vermögen des Menschen und als variabel auszuprägende Haltungen (vgl. insbes. V. 1130–1144). Während der Begriff der Seele nur sporadisch fällt und keinen nennenswerten Beitrag zur Organisation von Latenz leistet, setzen Bezugnahmen auf den muot umso größere Unterscheidungsleistungen in Gang; den muot aufrecht zu erhalten, erfordert Mühen (vgl. V. 781–800 u.ö.) – dâ hœret arbeit zuo (V. 613) – und dies gilt auch für den Rezipienten. Gemessen an diesem Anspruch wird verständlich, dass ein vergleichsweise differenzarmes Modell der Selbsthaltung, wie es der Kräuterzauber âne haz im Herzen anbietet (V. 1322), letztlich folgenlos verworfen wird.
Sofern sie nicht blockieren, erzeugen Paradoxien Bewegung – »Kippkalküle« prägen daher besonders die Argumentationsstruktur des Streitdialogs.75 Trotzdem vertieft Hartmann diese Dynamik nicht grenzenlos, sondern nimmt schließlich auch Differenzen zurück; wie jeder Dialog einmal enden muss,76 schließt auch der Streitdialog von Herz und Körper. Ab der stichomythischen Mittelachse beginnt die Klage , ihre Paradoxien zu restabilisieren. Äußerlich weist darauf schon der Verfahrenswechsel hin, der die Autokommunikation zwischen Herz und Körper zu einem äußeren Kommunikationsakt vereinfacht, der sich an die Dame richtet. Die Gelenkstelle bezeichnet der Streitdialog explizit mit einem letzten stichomythischen Wechsel: [›]nû solt dû, lîp, hin ze ir [= der Dame] / unser fürspreche sîn.‹ / daz tuon ich gerne, herze mîn. (V. 1642–1644). Aber wer spricht nun? Ohne Frage der Körper, der somit die Latenzform zu einer Stimme verdichtet.77 Und doch ist nicht so einfach anzugeben, wer spricht.78 Denn die Rede speichert zugleich Metaphern und Differenzen, die aus dem Streit mit dem Herzen gewonnen wurden bzw. direkt auf diesen zurückgehen. Betont werden innere Haltungen und Intentionen (V. 1729), das Herz als ›brennender Abgrund‹ des Begehrens (V. 1656, 1809), als Innenraum der Klage (V. 1740), der Sorge (V. 1787) und der Zweifel (V. 1829). Aufgerufen werden ebenso jene Bilder der Latenz, mit denen Herz und Körper den Streitdialog vertieft hatten. Das Ich schwimme gleichsam tief im Meer, weit vom Ufer entfernt, und wolle wegen seiner Sorgen tief in die Fluten gehen:
jâ lebe ich sam ich swande
über tiefen sê dan man hât
verre unz ze sande
(V. 1762–1764)
wan des tiefen meres fluot
mit sîner breiten flüete,
swie in vil selten ieman wuot,
für disen kumber ich in wüete.
(V. 1803–1806)
Die Preisstrophen zitieren den Bildbereich der Tiefe und variieren gleichzeitig seine Aussagerichtung – Latenz wird nun programmatisch bejaht. Gleiches gilt für den Jahreszeitentopos der Blüte: Klagte das Herz im Streitdialog, wie eine Blume unter einer Schneedecke zu leiden, die vor der sumerzît (V. 825) aufgehe, so behauptet das Ich im Frauenpreis ungleich selbstbewusster, nichts auf des sumers bluot zu geben (V. 1789), wenn sich die Dame nicht ihm zuwenden wolle. Die Schlussstrophen kondensieren somit ein »Gesamt-Ich«79 im Rückgriff auf Bezeichnungen und Bilder der Latenz, die neu akzentuiert werden. Auch den Wettstreit im Innern bezieht dieses Ich als ganzes auf sich (V. 1655).
Damit lässt sich die funktionale Leistung des Streitdialogs genauer ermessen. Um es deutlich zu sagen: Hartmann bietet keinerlei Lösung an für die thematische Aporie,80 die der strophische Schluss nochmals in Erinnerung ruft: Weshalb sollte die Dame gelouben mînem munde , der beteuert, von grunde des Herzens zu lieben (V. 1657–1660)? Obwohl sich Herz und Körper explizit auf gemeinsame Lösungsstrategien zu annehmbarer Minnekommunikation einigen, setzen die Schlussstrophen davon nichts um – sondern fallen im Gegenteil auf jene Werbungsrhetorik zurück, deren Glaubwürdigkeitsdefizite eingangs entlarvt wurden.81 Auch der erklärte Eid verschafft dem Frauenpreis keinen neuen Rückhalt, sondern die Dynamik eines latenten Wettkampfs, der zunächst eingefaltet, d.h. potenziert wird, bevor er wieder ausgefaltet, d.h. in seiner Differenzordnung zurückgenommen wird. Negativ gesagt zielt die Latenzstrategie der Klage darauf, ein Kommunikationsproblem temporär zu blockieren, indem es internalisiert wird; das Streitgespräch liefert dafür seit der Antike ein etabliertes ›kryptisches‹ Verfahren, das empfiehlt, Absichten und Ziele zeitweise zu verbergen.82 Der strophische Schluss bietet in dieser Sicht umso weniger eine inhaltlich überzeugende Lösung, als er lediglich nach innen gestaute, vervielfältigte Differenzen nach außen wendet und vereinfacht.83
Positiv betrachtet aber bietet der Text eine Transformationsdynamik an, die zwei Bewegungsrichtungen einschlägt: Beginnt die Klage damit, den muot der Modellperson als Differenzordnung aufzudecken, so verbergen die Schlussstrophen diese Differenz, ohne sie zu löschen. Als Wechselform erhöht Latenz somit die Komplexität der Stimme gerade dadurch, dass Innen- und Außenkommunikation der Klage nur als labile Transformationsdynamik, nicht aber als Bestimmungsverhältnis aufeinander bezogen sind. Dies könnte erklären, weshalb Forschungsversuche letztlich erfolglos blieben, die Problemlösung des Binnendialogs oder die Sprecherinstanz des Dialograhmens zu identifizieren. Verleiht dies den Preisstrophen etwas Unentscheidbares, so ist ihre Stimme keineswegs nebulös: Der, der am Ende spricht, erweist sich anschließend als komplexer;84 auf dieses Wahrnehmungsangebot zielt die Vervielfältigung durch inneren Streit.
Dazu ist nötig, Differenz zu verdecken, ohne sie zu annullieren. Deshalb führt der Weg der Schlussstrophen nicht über Negationen, um etwa die Unterscheidung von Herz und Körper zu widerrufen, sondern führt zu ihrer Externalisierung. Dies leisten insbesondere religiöse Diskurszitate, die in der ersten Hälfte des Streitdialogs den Konflikt von Herz und Körper als Orientierungsproblem zwischen Gott und Teufel einordnen: Betrügerische Männer wünscht der Körper zum Teufel (V. 250), denn Frauen zu verführen, sei eine werltwünne , die Gott bestrafen möge (V. 277f.); formelhaft bittet der Körper das Herz um Nachsicht durch got (V. 407, 413); umgekehrt mahnt auch das Herz zu Gottvertrauen und warnt vor Gottes Strafen und der Verführungskraft des Teufels (V. 807–820);85 Gott habe beiden eine gemeinsame Seele verliehen, die zum Heil zu bewahren sei, um nicht dem Teufel überantwortet zu werden (V. 1034–1060). Je tiefer sich der Streitdialog eingräbt, desto seltener fallen derartige Bezüge. Nach dem stichomythischen Wortgefecht sind sie nahezu verschwunden.86 Die Schlussstrophen jedoch greifen wieder verstärkt auf solche Referenzen zurück, die sie auf geringem Versumfang verdichten: Während der Teufel nach Schaden trachte, halte sich das Ich in seiner Rede an Gott (V. 1683–1687) und bittet die Dame um ihres Schöpfers willen um Zärtlichkeiten (V. 1721–1725) – Verweigerung aber wäre Sünde (V. 1783, so auch V. 1875f.); Gott möge das Ich vor Sorgen behüten (V. 1788). Mit der Schlussformel unterstellt das Ich seine Seele und seinen Körper ganz der Verfügung der Dame (V. 1911f.). All dies verbindet die Klage mit prominenten Modellen von Seelenkämpfen – von Tugendkatalogen ( Psychomachia ) über Anklage- bzw. Gerichtsordnungen zwischen Gott und Teufel ( Vorauer Sündenklage ) bis zu Spaltungsphantasmen, die wieder auf die traditionelle Doppelformel von anima und corpus zurückgreifen ( Visio Philiberti ). Doch tragen derartige Bezüge kaum so weit, den gesamten Text in einen moraltheologischen Kontext zu transportieren,87 so punktuell und unverbunden bleiben sie gegenüber der Diskussionsstruktur des Wettkampfdialogs. Auch untereinander scheinen Verweise auf die Seele – vom gotteslästerlichen Schwur bis zur orthodoxen Ermahnung – auffällig unabgestimmt: »Die Seele ist daher ohne weiteres ambivalent einsetzbar, als ironieverdächtige Hyperbel ebenso wie als theologisch gewichtiges Argument«.88
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Wettkampfkulturen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Wettkampfkulturen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Wettkampfkulturen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.