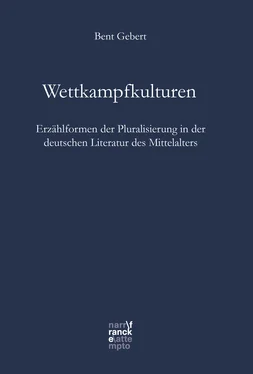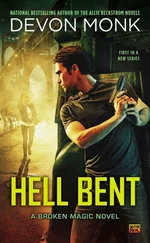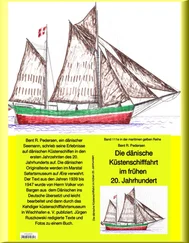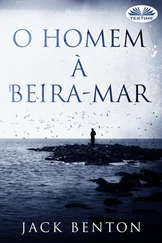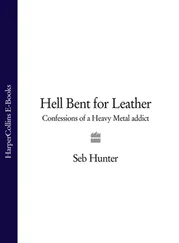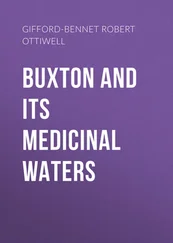wære ich gewaltic über dich
sô dû bist über mich,
daz ich hende hæte,
dîn leben wære unstæte;
ich tæte dir vil schiere schîn
daz ich unschuldic welle sîn
des kumbers den ich von dir hân.
der müese dir ze leide ergân.
(V. 527–534)
Hartmann verstärkt Anreden und Appelle, bis ihr phatischer Konsens auf die propositionale Ebene durchzugreifen beginnt: Überraschend erinnert der Körper an das Band der Seele als gottgeschaffenem Grund unauflöslicher Einheit (V. 1025–1060, wiederum gipfelnd in einer Zueignungsformel: wan mîn dinc ist daz dîn ), wofür das Herz im Gegenzug die vil guote wandelunge (V. 1154) des zuvor als unbelehrbar Gescholtenen lobt. Herz und Körper, Richter und Vollstrecker, scheinen sich damit »auf einen Konsens einzupendeln«,42 der den Wettkampf beendet.43
Bei diesem Einverständnis über wechselseitige funktionale Angewiesenheit von Körper und Herz bleibt die Klage indes nicht stehen. Vielmehr »entzündet sich die Diskussion aufs Neue«.44 Wurde der thematische Dissens der Auftaktreden von Kooperations- und Konsenssignalen getragen, so stülpt das stichomythische Wechselspiel von Frage und Antwort nun Aussage- und Äußerungsbeziehung um. Statt eines harmonischen Musterdialogs replizieren Herz und Körper einander bissig, z.B.
[Körper:] herze, waz gap dir den gewalt?
[Herz:] ›lîp, dîn üppic frâge tuot mich alt.‹
(V. 1175f.)
[Herz:] ›waz ist daz dir unsanfte tuot?‹
[Körper:] dû maht wol selbe wizzen waz.
(V. 1178f.)
[Herz:] ›kunde ich, lîp, ich hulfe dir.‹
[Körper:] dû solt âne dige helfen mir.
(V. 1185f.)
Konsens im Sachproblem – körperlichem Liebesleiden ist durch Rat des Herzens abzuhelfen – wird also in einer Redeform verhandelt, die wiederum ihren phatischen Dissens bewusst inszeniert. In chiastischer Umkehrung von propositionalem Zusammenspiel und kommunikativem Gegenspiel bildet der Dialog neuerlich Streitkonsistenz.
Umgekehrt zur früheren Umschlagsbewegung verstärkt sich auch dieser kommunikative Dissens wieder und durchdringt Konsenssignale (V. 1264–1268), bis das zuvor Erreichte aufgelöst wird. Dies veranschaulicht die allegorische zouberlist (V. 1275), zu der das Herz unmittelbar im Anschluss ermuntert.45 Beliebt bei Gott und der ganzen Welt (V. 1346) könne sich der Körper machen, wenn er acht Kräuterarten in einem Gefäß mische – nämlich die Tugenden der Freigebigkeit, Beherrschung, Bescheidenheit, Treue und Beständigkeit, Sanftmut und Zurückhaltung sowie Tapferkeit, die ohne jeden Vorbehalt oder Zwietracht (V. 1322: âne haz ) ›innen‹ im Herzen zu tragen seien.46 Gezielt greift der Kräuterzauber des Herzens also zu jenem vaz , das auch Hartmanns Iwein zum zentralen metaphorischen Modell latenter Differenz erhebt. Doch in der Klage scheitert eine Latenz-Metapher, die jegliche Differenz auszuräumen sucht. Kaum ausgesprochen, wird sie sogleich kassiert. Da sie Seelenheil und Leben gefährdeten, seien Zauber grundsätzlich abzulehnen –
durch daz suln wir in lâzen;
daz er sî verwâzen!
und sül dir gelingen,
daz erwirp mit rehten dingen.
(V. 1367–1370)
Zurecht hat die Forschung über den Sinn eines Tugendrezepts gerätselt, das mit großem ernest (V. 1263) vorgetragen, doch in seiner semiotischen Konstruktion entwertet wird.47 Entscheidend scheint mir, dass die ›revocatio‹ nicht bei der vermeintlichen Zauberempfehlung Halt macht. An den Grenzen des Sagbaren lässt sie nämlich selbst den beredten Ratgeber verstummen: ich enweiz waz ich dir sagen sol , schließt das Herz, wan dû tuo rehte unde wol (V. 1372). An keiner anderen Stelle wendet sich der sonst so selbstbezügliche Text vom Dialog zur »Ethisierung«: Wo der Streit zu enden scheint, verweist er, in ehrwürdigem Vokabular, doch angesichts seines anfänglichen Problembewusstseins fast naiv, auf tugendgeleitete Praxis. Will man darin keine Ironie hören, sondern diese Schlusswendung ernst nehmen, kann man darin eine potenzierte, nun positivierte Stufe des Schweigens erkennen, die den gesamten Streitdialog auf das Anfangsproblem zurückführt: Was kann man nach einer solchen Tugendempfehlung noch sagen? Negativ zeichnet sich mit dem Kräuterzauber jedoch auch ab: Die Form der Latenz gräbt sich so tief in ihre Problemverhandlung ein, bis sie an die Grenzen auch der latenten Kommunikationsform stößt. Wie mit Blick auf die strophischen Schlusspassagen zu zeigen sein wird, bereitet die Klage gerade damit ihren Ausstieg aus der Form der Latenz vor.
Der Dialog von Herz und Körper hält sich vorerst in der Form des Wettkampfs. Ausführlich bekräftigt das Herz seine Empfehlung, den muot durch Zurückhaltung und beständigen Abstand gegenüber der Dame zu beherten (V. 1543). Jede Übereilung schade: Wer allzu rasch Neues begehre, den strecke der Beständige im ritterlichen Zweikampf mit bluotigen sporn nieder (V. 1564). Vertieft sich das Lob der stæte in einem Wettkampfvergleich, so verfängt sich das Herz erneut in der Klage über das, was von Anfang an durch Argumente nicht zu überwältigen war – die Zurückhaltung der Damen gegenüber Latenz:48 Ohne ersichtlichen Grund zögerten Frauen oft gegenüber denjenigen, die sie zu Liebhabern wählten, so lange, bis nicht mehr zweifelsfrei zu erkennen sei, was tatsächlich geschehen oder nicht geschehen sei.49 Während das Herz also im Anschluss an das Tugendrezept wortreich über der wîbe muot (V. 1572) aufzuklären versucht, demonstriert es doch nur, wie vergeblich alle Ratschläge bleiben. Verfolgt man allein die propositionale Struktur des Dialogs, so steht das Ausgangsproblem doppelter Kontingenz, dass der muot des Anderen nicht einsehbar sei, so offen wie zu Beginn – allen anthropologischen Grenzziehungen und Aufgabenverteilungen zum Trotz. Entsprechend kontert auch der Körper wie eingangs mit antagonistischen Signalen: Herze, ich hœre dich klagen / daz dû wol möhtest verdagen (V. 1593f.) – si [= die Frauen, B.G.] ennement dich niht ze râtgeben, / jâ bist dû ze rihtære / in vil unmære (V. 1606–1608). Ein letztes Mal vertieft sich der Streitdialog, der mit guoter lêre (V. 1612) allein nicht auszuräumen ist: wis stæte, daz der beste list (V. 1615). Den letzten Anlauf, den die Klage zur Verfestigung von stæte unternimmt, fällt daher nicht argumentativ, sondern performativ aus.
Für den Streitdialog bedeutet dies, dass Wettkampf zwar als Lösungsverfahren für ein Problem latenter Differenz anläuft, ja sogar auf ethische Lösungsempfehlungen zuläuft, sich jedoch sogleich wieder perpetuiert, sobald diese argumentativ ausgeräumt scheint. Wettkampf bildet dadurch Konsistenz, dass Propositionen und phatische Akte sich chiastisch überkreuzen. Insgesamt vertieft die Klage damit eine Paradoxierungsstruktur. Auf konzeptueller Ebene entwirft sie Herz und Körper als »problematisch differenzierte Einheit«, die das Leitmodell des anthropologischen Dualismus weit hinter sich lässt;50 das Selbst als Streitordnung wird ungleich komplexer entfaltet als die Allegorie der Psychomachia . Zu dieser Überkreuzung trägt bei, dass Herz und Körper in ihrem Redeverhalten insbesondere jene Eigenschaften in Anspruch nehmen, die sie ihrem Gegenüber als distinktiv zuschreiben – das Herz argumentiert hoch affektiv, der Körper denkt und geht mit sich selbst zu Rate (z.B. V. 140–142, 1490),51 beide reklamieren für sich die Besinnungsinstanz des muotes .52
Читать дальше