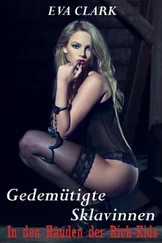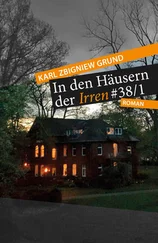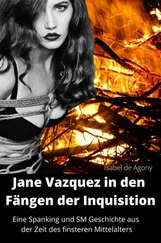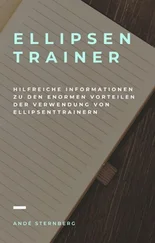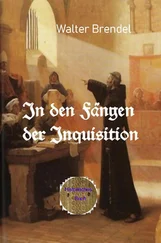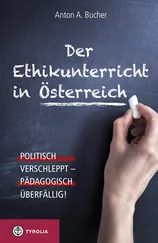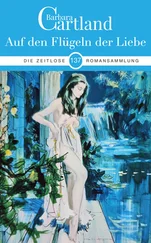Was folgt daraus für die migrationsethische Debatte? Webers Überlegungen zum Ethos des Berufspolitikers nehmen ernst, dass Politiker in einem Betrieb sich zu behaupten versuchen, der seinen eigenen Gesetzen folgt und sich wesentlich um den Zugang zu, den Einsatz und den Erhalt von zwangsbewehrter Macht dreht. Sein Beharren auf der – wie gezeigt recht differenzierten – Verantwortungsethik sucht gerade das Spezifikum eines politischen Ethos zu erfassen, das als Rollenethos des Politikers selbst politischen Charakter hat. Dem gegenüber ist zu unterstreichen, dass der gewöhnliche Intellektuelle oder der akademische Ethiker, der nicht in den politischen Betrieb und in eine Parteiorganisation eingebunden ist, nicht in der Rolle des Politikers spricht, sondern – obzwar nicht unpolitisch – an einem öffentlichen Diskurs teilnimmt, vor dessen Hintergrund erst das politische Kompromissfinden und Entscheidungsfinden stattfindet. Dieser Diskursprozess findet seinerseits nur dann in ethisch verantwortbarer Weise statt, wenn alle ethischen Dimensionen der Problematik vertreten und erörtert werden. Den politischen Kompromiss kann eine ethische Diskussion nicht vorwegnehmen; sie muss Sorge tragen, dass alle relevanten Argumente – auch jene, die in der Politik unbeliebt sind, weil sie politischen Mehraufwand verursachen – vorkommen und so weit als möglich Gehör finden. Dafür muss Ethik aber Ethik bleiben und darf sich nicht in die Rolle des Politikers hineinphantasieren. Es ist gar nicht zu erkennen, wieso es unpolitisch wäre oder unverantwortlich sein sollte, menschenrechtliche Ansprüche oder ethische Begrenzungen nationalstaatlicher Souveränitätsansprüche zu vertreten, wie jene Autoren zu denken scheinen, die ihre Position als „verantwortungsethisch“ charakterisieren. Viel eher wird eine Diskussion benötigt, die in einem übergreifenden Sinne verantwortungsethisch ist – wie sie bei Weber wenigstens als Problembewusstsein zu erkennen ist – und die „gesinnungsethische“ Aspekte einschließt. Dazu gehört wesentlich die Frage nach der Verantwortungsinstanz, die bei der Migrationsproblematik ja offenkundig nicht primär im einzelstaatlichen Gemeinwohlhorizont zu lokalisieren ist. Das Bestehen von Staaten, denen gegenüber Individuen mit ihren Wünschen und Interessen auftreten, ist ja gerade Teil der Problembeschreibung und kann nicht einseitig die Perspektive der Beurteilung formulieren. Anders gesagt: Die migrationsethische Debatte muss sich einerseits davor hüten, unreflektiert eine Position einzunehmen, die sich mit dem „Wir“ der Aufnahmegesellschaft identifiziert und in der Torhüter-Rolle überlegt, was (und wer) „uns“ zuzumuten ist. Dieses prinzipielle Machtgefälle zwischen dem Staat und den ankommenden Individuen wird andererseits zwar korrigiert, aber nicht überwunden, wenn die migrationsethische Positionierung anwaltschaftlich zugunsten der Migrierenden erfolgt. Advokatorisches Eintreten für die wenig artikulationsfähigen Rechte der Flüchtenden und Zukunftsuchenden ist in der Migrationsdebatte bitter nötig (und darin zutiefst politisch), aber ändert nichts daran, dass das grundlegende Setting – hier der mächtige Staat, dort das ohnmächtige Individuum – nicht in Frage gestellt wird. Christoph Menke weist darauf hin, dass mit dem Konflikt zwischen dem Individuum als Inhaber subjektiver Rechte und dem Staat als Machtkollektiv die Problemstruktur perpetuiert wird – das Verhältnis „zwischen einem Wir und einem Du (oder einem Ihr und einem Ich), das nicht ein Mitglied ist“ (Menke 2016). Die ethische Debatte müsste sich darauf konzentrieren zu erörtern, wie eine gerechte Anerkennung von Menschen als politischen Wesen zu denken und zu realisieren ist, ohne am menschenrechtlichen Dilemma stecken zu bleiben, dass Migranten „eigentlich“ Teilhaberechte haben, diese zu ihrer Realisierung aber das erfordern, was ihnen gerade abgeht, nämlich Teil zu sein. Die Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik ist für eine solche umfassendere Wahrnehmung der ethischen Problematik nicht geeignet; da sie auch diesseits davon irreführend ist, sollte auch auf ihren bloß rhetorischen Gebrauch verzichtet werden.
Anselm, Reiner (2016). Ethik ohne Grenzen? Zeitschrift für evangelische Ethik 60:3, 163–167.
Collier, Paul (2014). Exodus. Warum wir Einwanderung neu regeln müssen. München: Siedler.
Körtner, Ulrich H.J. (2016). Gesinnungs- und Verantwortungsethik in der Flüchtlingspolitik. In: Heimbach-Steins, Marianne (Hrsg.) Begrenzt verantwortlich? Sozialethische Positionen in der Flüchtlingskrise. Freiburg i. Br.: Herder, 66–81.
Menke, Christoph (2016). Zurück zu Hannah Arendt – die Flüchtlinge und die Krise der Menschenrechte. Merkur 70:7, Heft 806, 49–58.
Ott, Konrad (2016). Zuwanderung und Moral. Stuttgart: Reclam.
Weber, Max (1992). Politik als Beruf [1919]. Mit einem Nachwort von Rolf Dahrendorf. Stuttgart: Reclam.
Werner, Micha H. (2011). Verantwortung. In: Düwell, Marcus/Hübenthal, Christoph/Werner, Micha H. (Hrsg.) Handbuch Ethik. 3. Aufl. Stuttgart/Weimar: Metzler, 541–548.
Recht- und Weltlosigkeit auf dem Mittelmeer?
Zur Aktualität von Hannah Arendts Analyse der Staatenlosigkeit
Alexander Hauschild
Ein kleines sozio-politisches bzw. ethisches ‘Rätsel’ zu Beginn: Am 8. März 2014 verschwindet eine Maschine der Malaysia Airlines, Flugnummer MH370, mit 239 Menschen an Bord über dem indischen Ozean vom Radar; die mediale Berichterstattung über diese Tragödie ist immens und die Suche nach dem verschollenen Flugzeug, an der sich 26 Nationalstaaten beteiligen – entweder da sich ‘ihre’ Staatsbürger_innen unter o.g. Menschen befanden, oder da ‘ihr’ Staatsgebiet von der Suchaktion betroffen ist –, avanciert zur teuersten der Luftfahrgeschichte (siehe Reidy 2015b). Knappe vier Monate später, am 28. Juni 2014, verschwindet ein Schiff mit 243 Menschen an Bord im Mittelmeer; mediale Berichterstattung über diese Tragödie ist nahezu nicht existent – die erste Meldung bezüglich der angenommenen Havarie dieses Schiffes lässt einen Monat auf sich warten – und an der Suche nach dem verschollenen Schiff beteiligen sich ganze null Nationalstaaten (ebd.). Zwei, zumindest auf den ersten Blick, hinreichend ähnliche Fälle, die doch derart divergierende internationale Reaktionen hervorrufen: was also unterscheidet sie?
Eric Reidy (2015b), Mitbegründer eines Teams aus Journalist_innen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, das tatsächliche ‘Schicksal’ dieses „Ghost Boat“ sowie der Menschen an Bord zu ermitteln1, hat diesbezüglich eine eigene, erste Antwort:
The people who fly in airplanes are affluent – rich enough to afford a plane ticket, at least – and have the legal status to board flights and cross international borders. They are not running, desperate for their lives because of oppression, war, or violence.
Letzteres war allerdings bezüglich der Passagier_innen des „Ghoast Boat“ der Fall: Die Mehrheit von ihnen stammte aus Eritrea und floh vor dem dortigen Regime quer durch die sudanesische Sahara nach Libyen, um dort ein Schiff nach Italien zu besteigen (ebd.). Vor diesem Hintergrund hat Steve Saint Amour, geschäftsführender Direktor der Eclipse Group, eines Unternehmens, das sich auf Such- und Bergungsmissionen in Tiefwasser – z.B. nach verungückten Flugzeugen oder Schiffen – spezialisiert hat, eine noch triftigere Anwort auf oben stehende Frage: „In the case of the Ghost Boat, you only have stateless people […]. Which country has a national interest to find out what happened?“ (ebd.)
Für Staatenlose interessieren sich (inter-)nationale politische Entscheidungsträger_innen schlichtweg nicht; zumindest nicht genug, als dass es von Interesse wäre, was mit ihnen geschieht. Hauptsache, sie bleiben ‘anderswo’. Wo (und wie) ist unerheblich. Insbesondere aber müssen sich EUropäische Entscheidungsträger_innen diesen Vorwurf gefallen lassen: Das Mittelmeer ist seit (spätestens) 2014 zur tödlichsten Flucht-/Migrationsroute der Welt geworden – mit respektablem Abstand: 69 Prozent aller weltweit während der Flucht/Migration erfassten Todesfälle ereignen sich im Mittelmeer (IOM 2016a: 4). Angesichts dessen hat es den Anschein, als sei Hannah Arendts Analyse der Staatenlosigkeit, obschon sie sich eigentlich auf die historische Periode von 1918 bis in die frühen 50er-Jahre bezieht, auch heute noch hochaktuell sowie bezüglich der von ihr identifizierten Effekte der Staatenlosigkeit radikal verwirklicht.
Читать дальше