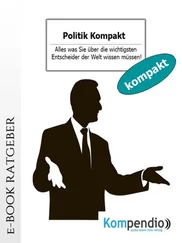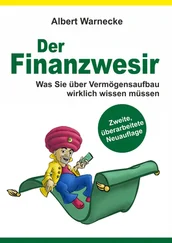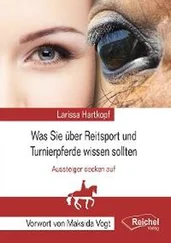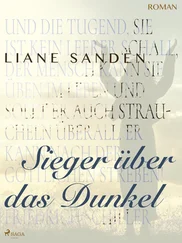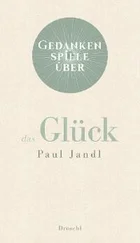3.2. Zweite Konzentration: Monolineare Kommunikation
Eine zweite Konzentration wird innerhalb des neutestamentlichen Kanons vorgenommen.
Es bietet sich nicht an, die Frage der Schriftautorität in erster Linie im Hinblick auf die Briefliteratur des Neuen Testaments zu stellen. Diese Einsicht verdankt sich zunächst einer formalen Abgrenzung hinsichtlich der Gattung. Briefe stellen eine andere Kommunikationsform als die Evangelien und die Offenbarung des Johannes dar und setzen eine andere Kommunikationssituation voraus.1 Während Briefe eine „dialogstiftende und kommunikationsstabilisierende Funktion“2 aufweisen und den abwesenden Dialogpartner ersetzen,3 also ein Ersatz für die mündliche Rede darstellen,4 sind Evangelien und Offenbarung eher als eine „lineare Kommunikationsform“5 aufzufassen. Das heißt nicht, dass Evangelien und Offenbarung keine kommunikative Funktion haben, sondern lediglich, dass ihre Kommunikationssituation eine andere ist. Sie richten sich nicht nur an die Adressaten, die bei der Abfassung des Briefs vor Augen stehen, sondern haben einen grundlegend weiteren Horizont.6
Evangelien und Offenbarung sind bereits von Anfang darauf angelegt, als eigenständiges Werk, als Buch gelesen und gehört zu werden.7 Um das zu erreichen, brauchen sie eine andere Autorität als ein Brief. Denn Briefe funktionieren anders. Sie sind Teil einer beabsichtigten Kommunikationssituation, die entweder bereits vorher auf anderem Wege initialisiert wurde oder durch den ersten Brief begründet werden soll. „Die kommunikative Korrespondenzfunktion macht den Brief zum Brief.“8 Seine Situation bedingt, dass sein Autor in Erscheinung tritt. Dies ist bei den anonym überlieferten Evangelien nicht der Fall. Damit der Brief gelesen wird, muss beim Leser der Wunsch nach der Lektüre des Briefes geweckt werden. Dies erklärt, warum ein Brief eine gewisse Autorität für sich beanspruchen muss: damit der Leser ihn lesen will. Briefe, die darüber hinaus den Anspruch erheben, als autoritative Texte Anerkennung zu finden, sind deshalb direkt damit beschäftigt, auch die Autorität ihres Autors zu sichern, wobei der Autor dann wiederum die Autorität des Textes verbürgt. Ganz deutlich ist dies zu sehen, wenn z.B. Paulus in seinen Briefen die Legitimität seines Apostolats herausstellen muss (Gal 1,1; 2.Kor 10–12), um so Gehör für seine Texte zu schaffen.9 In diesem Sinn erhebt Paulus „fraglos kanonische, d.h. Norm setzen wollende Autorität“10 und bindet damit die Sache des Evangeliums auch an seine Person.11
Bei den pseudepigraphen Briefen12 des NT ist die Schaffung der Autorität des Autors durch Übernahme einer fremden Autorität ein wesentlicher Grundzug der angestrebten Kommunikation.13 Gleiches gilt grundsätzlich für einen weiten Teil der apokalyptischen Literatur.14 Eine Ausnahme stellt hierbei wahrscheinlich die Offenbarung des Johannes dar, die wahrscheinlich wirklich von einem Menschen namens Johannes verfasst wurde.15
Da sich die vorliegende Untersuchung vor allem aber für die Rolle der Schrift im Kontext der christlichen Theoriebildung und Lebensdeutung interessiert, sind eher Texte zu beachten, die einen narrativen Zusammenhang entfalten, in dem sich die Leser und Hörer selbst verstehen sollen. Die Evangelien und die Apk „als Spezialfall der autobiographischen Erzählung“16 bieten sich daher an.17 Sie bilden in dieser Hinsicht den Gründungsmythos des christlichen Selbst- und Weltverständnisses ab und begründen ihn damit.18 Briefe setzen diesen Zusammenhang aber bereits voraus und argumentieren in dessen Horizont. Insbesondere die Evangelien und in abgestufter Weise auch die Offenbarung stellen ihren Lesern demnach einen Horizont vor Augen, in dem sie sich selbst verstehen sollen. Von daher entwerfen sie einen Verstehenszusammenhang, der die Grundlage christlicher Lebensdeutung herstellt. Dies entspricht dem Zielpunkt dieser Arbeit, weshalb es neben den pragmatischen Erwägungen gerechtfertigt erscheint, die Briefliteratur für diese Untersuchung auszublenden.
3.3. Dritte Konzentration: Sie über sich!
In dieser Arbeit sollen Texte untersucht werden, die sich mit sich selbst beschäftigen.1 Sie sollen Auskunft darüber geben, warum oder mit welchem Zweck sie geschrieben wurden. Sie stehen mit dem Korpus des Werkes in engem Kontakt, kommentieren es, weisen aus, warum es geschrieben wurde und weshalb es verdient, Gehör zu finden.
Entscheidend ist im Rahmen der vorliegenden Untersuchung dabei, dass sie sich „an der Selbstbeschreibung des Textes orientiert“.2 Ein zu beobachtendes und zu beschreibendes „ Textoberflächenphänomen “3 steht damit im Fokus des Interesses. Fragen nach der Erlebnisechtheit von Offenbarungen werden folglich genauso außen vor gelassen wie solche nach der Historizität des Erzählten.4 Mit dieser Konzentration werden alle Aspekte ausgeblendet, die sich auf außersprachliche Wirklichkeit beziehen. Beschrieben werden soll nur der Anspruch der Texte auf Autorität, nicht aber ob dieser Anspruch bei den Adressaten wirklich verfangen hat.5
Gleichfalls werden die Behauptungen der Texte nicht auf ihren Wirklichkeitsbezug untersucht und damit wird kein Urteil darüber abgegeben, ob die Texte gerade im Hinblick auf Apk 1,1–3 „wirklich“ von Gott gegeben sind. An diesem Punkt kann diese Untersuchung deshalb auch in keiner Weise methodisch ansetzen.6
Gemäß den Bestimmungen von Gérard Genette können die Texte, die zu untersuchen sein werden, auch als Paratexte bestimmt werden.1 Lk 1,1–4 müsste dann als Vorwort angesehen werden, das dazu dient, den Leser „durch einen typisch rhetorischen Überredungsapparat festzuhalten.“2 Joh 20,30–31 dürfte als Nachwort anzusprechen sein3 und Apk 1,1–3 wäre in seinem Sinn als thematischer Titel der Apk zu bestimmen.4
Die Untersuchung wird allerdings zeigen, dass die untersuchten Texte zwar wie Paratexte dem Werk beigeordnet (z.B. als Überschrift oder Vorwort5) sind, oft also die Schwelle markieren,6 die es zu übertreten gilt, um in das Werk hineinzugelangen (Lk 1,1–4; Joh 20,30–31) oder aus ihm herauszukommen (Joh 20,30–31), dies aber immer so vornehmen, dass auf das jeweilige Werk in kommentierender Absicht Bezug genommen wird, was wiederum einem Metatext entspricht.7 Gegen die Verwendung der Bezeichnung Paratext spricht im vorliegenden Fall, dass die zu besprechenden Texte nicht wie bei anderen Literaturwerken, die Genette vor allem zur Bestimmung seiner Kriterien heranzieht, deutlich als deren Rahmen abgegrenzt sind (eben deutlich als Titel oder Vor- und Nachwort), sondern bei den biblischen Texten „ins Kontinuum eines grösseren Zusammenhangs eingelassen sind.“8
Außerdem trifft auf diese kanonisch gewordenen Texte nicht zu, was bei Paratexten zu erwarten wäre. Im Gegensatz zum eigentlichen Text, der nach Genette „unwandelbar und als solcher außerstande [ist], sich an die Veränderungen seines Publikums in Raum und Zeit anzupassen“,9 leisten Paratexte genau das: „Der flexiblere, wendigere, immer überleitende, weil transitive Paratext ist gewissermaßen ein Instrument der Anpassung.“10 Deshalb kann und soll er sich in der Überlieferung des Werkes immer wieder wandeln, um dem Werk zu jeder Zeit dienlich sein zu können. Diese Flexibilität, die dafür sorgt, „dass der wesentlich stabilere Haupttext mit dem diachronen Wandel Schritt hält“,11 fehlt den biblischen Texten. Vielleicht ist im Zuge ihrer eigenen Kanonisierung ihr ursprünglich paratextueller Charakter, der aber vor allem für Apk 1,1–3 behauptet werden kann, verloren gegangen, sodass sie letztlich als Metatext angesehen werden müssen. In jedem Fall geht es also um die metakommunikative Funktion der Texte.12
Um nun drittens eine einheitliche und in der Exegese verbreitete Begrifflichkeit zu verwenden,13 sollen die Texte, die die beschriebenen Voraussetzungen aufweisen, daher als „Metatexte“ bezeichnet werden, da es der Untersuchung darauf ankommt, die kommentierenden, also selbstexplikativen Aussagen zu beschreiben.
Читать дальше