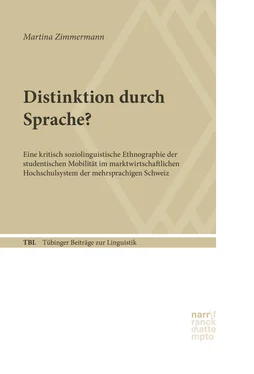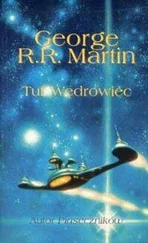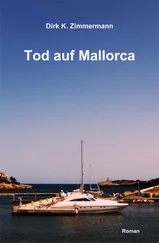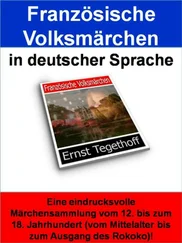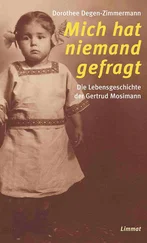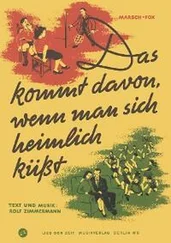2 Seit jeher der Bildung wegen in die Ferne
Paternitati vestre innotescat quod nos, sani et incolumes in civitate Aurelianensi, divina dispensante misericordia, conumorantes, operam nostram cum affectu studio totaliter adhibemus, considerantes quia dicit Cato: „scire aliquid laus est, etc.“ Nos enim domus habemus bonam et pulcram, que sola domo distat a scolis et a foro et sic pedibus siccis scolas cotidie possumus introire. Habemus etiam bonos socios nobiscum, hospicio vitaque et moribus comendatos; et in hoc nimium congratulamur, notantes quia dicit Psalmista: „Cum sancto sanctus eris, etc.“1
(Auszug aus einem an die Eltern adressierten Brief, verfasst von den zwei in Orléans studierenden Söhnen, 13. Jahrhundert2)
Several advantages we should find there, such as … better opportunities of growing perfect in the French, better masters for mathematics (which he has a mind to apply himself to for some time) and for any exercise of accomplishment that any of us might have a mind to advance or perfect ourselves in such as dancing, fencing, drawing, architecture, fortification, music, the knowledge of medals, painting, sculpture, antiquity […]
(Auszug aus einem Brief, der von Tutor Fish aus Paris nach England gesendet wird, anfangs 18. Jahrhundert, Black 2011: 162)
Ho sempre avuto la ferma intenzione di studiare in un’università germanofona fin da quando ho ottenuto la maturità in Ticino, poiché considero la lingua tedesca come valore aggiunto nel mio CV. Sono finito a Lucerna. Impiego due ore e mezzo, proprio pochissimo per noi Ticinesi. È la più vicina università per noi. Torno giovedì sera in Ticino, e domenica sera torno a Lucerna. Sono spesso sul treno. Però sono contenta con la mia scelta, mi sono trovato benissimo soprattutto grazie a una struttura accademica fatta a misura di studente, dove i professori ti conoscono personalmente e non è necessario ricorrere alla mediazione degli assistenti per comunicare con loro.3
(Auszug aus einem Interview mit Stefania4, Frühling 2012, Luzern)
Die drei Belege sind unterschiedlicher Natur. Sie stammen aus verschiedenen zeitlichen und räumlichen Kontexten. Zwei davon sind Auszüge aus Briefen, einer geht auf eine Tonaufnahme zurück. Während die Quelle in Latein wie auch diejenige von Stefania auf ein Studium an einer Universität Bezug nehmen, verweist diejenige aus Paris auf die „Grand Tour“, die v.a. im 17., aber auch im frühen 18. Jahrhundert unter Privilegierten verbreitet war und Aufenthalte in Kultur- und Universitätsstädten Europas beinhaltete.
Trotz dieser Unterschiede haben die Zeitzeugnisse auch Gemeinsamkeiten. Sie handeln von drei jungen Menschen, die der geeigneten Bildung zuliebe zum Teil weite und unbequeme Wege auf sich genommen haben. Die Entscheidung, sich fern der Heimat in Orléans, Paris oder Luzern aufzuhalten, scheint je nach Epoche die „richtige“ zu sein; die Ausbildung in der sprachlich-kulturellen Fremde ist die zeitgemässe Vorbereitung auf die Zukunft.
Bildungsmobilität geht weit zurück und ist eng mit Institutionen/Orten verbunden, die entsprechende Bildung versprechen. Aber wie sind diese Bildungszentren entstanden? Wie sind sie zu dem geworden, was sie heute sind? Wie kam es dazu, dass einige Städte zu universitären Stätten wurden? Und weshalb wird die an den Universitäten angebotene Bildung als „geeignet“ erachtet und mit ihr seit Jahrhunderten sozialer Aufstieg assoziiert? Um solchen Fragen auf den Grund zu gehen und zu verstehen, weshalb Bildung Studierende seit jeher in die Ferne zieht, scheint es fruchtbar, im Folgenden einen Blick auf die Entstehung und Entwicklung der Bildungsinstitutionen zu werfen (2.1.1). Danach ist ein Unterkapitel der Bildungsmobilität in der Geschichte der Schweiz gewidmet (2.1.2). Schliesslich wird die aktuelle Mobilität beschrieben, die im Fokus dieser Arbeit steht (2.1.3).
2.1 Die Hochschullandschaft – damals und heute
Seit um etwa 1200 die Uruniversitäten Bologna und Paris entstanden1, zählt gemäss Weber „die Universität zu den wichtigsten soziokulturellen Kräften, welche die Formierung, den Aufstieg und die hochrangige Positionierung Europas in der Welt ermöglichten“ (Weber 2002: 9). Seither hat sich einiges verändert, eine Elitenbildungsanstalt ist die Universität jedoch geblieben. Sie vermittelt und schafft höheres Fakten-, Methoden- und Orientierungswissen und nimmt qualifizierte Lernende auf, die mit und dank diesem Wissen später in der Regel bestimmte gesellschaftliche Positionen einnehmen.
Die aktuelle Schweizer Hochschullandschaft besteht aus 12 tertiären Institutionen2, welche vorwiegend in urbanen Zentren zu finden sind. Dazu zählen zehn kantonale und zwei eidgenössische Universitäten. Diese blicken auf eine 800-jährige Geschichte zurück, wobei freilich die Mehrheit von ihnen erst im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert gegründet wurde, aber meist auf bereits bestehenden Institutionen aufbauen konnte3. Um das aktuelle tertiäre Bildungswesen und die darin vorherrschenden hochschulpolitischen Beziehungen zu verstehen, ist vorgängig ein historischer Abriss hilfreich. Das jeweilige Zeitgeschehen spiegelt sich nämlich in der Universität, ihrer Struktur und Ausstrahlung wider. Diese Retrospektive soll dazu beitragen, das Aufkommen der Universität im europäischen Kontext zu situieren, wobei auch auf die Schweiz und die dortigen Gründungen verwiesen wird. Weiter soll dieser Rückblick verdeutlichen, vor welchem Hintergrund die studentische Mobilität entstanden ist.
2.1.1 Die Entstehung und Entwicklung der Universitäten in Europa – ein Längsschnitt in Kürze
Der Blick in die Vergangenheit soll knapp sein; er dient der Kontextualisierung und wird ohne Details1 auskommen müssen. Den grossen Epochen Mittelalter, frühe Neuzeit und Moderne entlang werden zentrale Aspekte aufgeführt2. Ein letzter Abschnitt ist der Gegenwart gewidmet. Sofern es aus Schweizer Perspektive etwas vorzubringen gibt, wird dies im finalen Abschnitt der Darstellung der jeweiligen Epoche getan.
Die ersten Universitates im christlichen Europa: 1180–1400
Ihren Anfang nahm die Universität in Bologna und Paris. Die Universität Bologna (offizielles Gründungsjahr 1088) fasste die bereits bestehenden Rechtsschulen zusammen, die aufgrund von immerwährenden Konflikten zwischen Papsttum (Kirchenrecht), Bürgertum (kommunales Recht) und Kaisertum (Herrscherrecht) entstanden waren. In Paris hingegen wurden um 1200 verschiedene theologische Schulen organisatorisch zusammengefasst; der Papst erachtete Paris als künftiges universitäres Zentrum der europäischen Theologie und trug mit der „licentia ubique docendi“ dazu bei, dass alle Studenten, die den Magister erlangt hatten, an jeder europäischen Universität lehren konnten. Er animierte somit den Lehrkörper bereits in den universitären Anfängen zur Mobilität, erhoffte er sich dadurch doch eine Verbreitung seiner theologischen Lehre. Gemeinsam war den frühen Universitäten, dass sie aus einer bestimmten geistigen und sozialen Situation entstanden, als nämlich „herkömmliche Kloster- und Domschulen den fortschreitenden Erkenntnis- und Lehrmethoden der Scholastik und den Ansprüchen der wissenschaftstreibenden Bevölkerungsgruppen, vornehmlich Kleriker und in zunehmendem Masse auch Laien, nicht mehr genügten“ (Boehm & Müller 1983: 12). Lehrer und Scholaren schlossen sich zu Korporationen, also zu einer Art von Berufsgenossenschaften, zusammen. Daher kommt auch die Bezeichnung „universitas“, die für Kommunität steht. Auch wenn in Bologna und Paris Konflikte zwischen Hauptakteuren wie Papst, Bischof, Stadt oder Kaiser ausgetragen wurden, war das Modell der Universität rasch erfolgreich. Beide Universitäten hatten bald Ableger (z.B. in Padua, Siena), und es dauerte nicht lange, bis in Oxford die erste selbständige Gründung erfolgte. Im 13. und 14. Jahrhundert – es gab dann bereits über 30 Universitäten – festigte sich die Organisationsform, und mit der Gründung in Prag (1348) und später in Heidelberg und in Köln erreichte die Universität auch das „jüngere Europa“ (vgl. Moraw 1985). Zwar unterscheiden sich die lokalen Geschichten der einzelnen Institutionen voneinander, jedoch sind alle Gründungen mithilfe der Kirche entstanden. Zu dieser Zeit stand nämlich die Wissenssicherung und -verbreitung im Vordergrund, wobei es darum ging, die „doctrina sacra“ in ihrer Gesamtheit zu erfassen.
Читать дальше