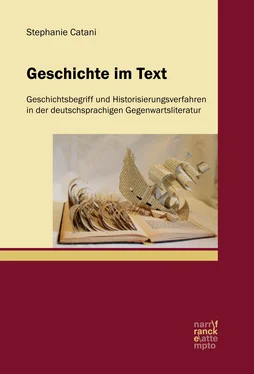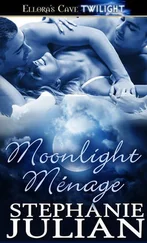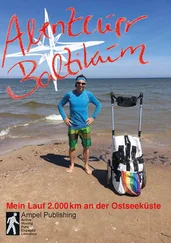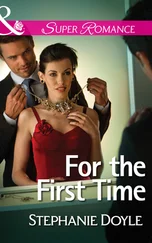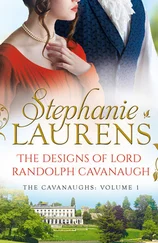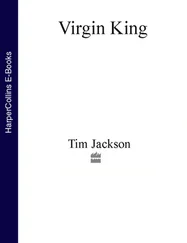1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Von einer prominenten, gar glaubwürdigen Erzählinstanz kann nicht die Rede sein, ebenso wenig von einer im Zeichen des Fiktionalen gründenden endgültigen Überwindung des Hiatus zwischen Historie und Fiktion. 1.2 Epochenzäsur 1989: Zum Begriff der Gegenwartsliteratur Unter dem Begriff der deutschsprachigen ›Gegenwartsliteratur‹ fasst die vorliegende Untersuchung historisch-fiktionale Texte, die nach 1989 erschienen sind. Zum einen legitimiert sich diese Grenzziehung durch die nach 1989 veröffentlichten und von der Geschichte erzählenden Texte selbst. Diese erlauben es, von einem anhaltenden Trend in der Gegenwartsliteratur zu sprechen, der in den 1990er Jahren und erst recht mit Beginn des 3. Jahrtausends seine Wirkungsmacht zeigt. Zum anderen ergibt sich diese zeitliche Fokussierung aus der historischen wie literaturhistorischen Bewertung der politischen Ereignisse in den Jahren 1989/90. Diese sind inzwischen nicht nur als Wendepunkt der deutschen Geschichte, sondern als eine »ganz offensichtliche Zäsur auch in der Literatur«1 erkannt worden – wenngleich als Zäsur, die kontrovers sowohl als Abgesang auf die deutsche Literatur wie als Aufbruch in ein neues literarisches Zeitalter bewertet wird. Die Wiedervereinigung: Ringen um Identität und Versuche der Revision Das Annus mirabilis 1989 markiert einen Epochenbruch. Der Atem der Geschichte weht durchs kollektive Bewusstsein, der frohe, aber ungläubige Ausruf »Wahnsinn!« ertönte aus aller Munde. […] 1989 ist Ausgangspunkt und Schlüsseljahr der Ausstellung, die aber keine sozialhistorische oder mentalitätsgeschichtliche Einordnung jener Jahre seit dem Ende der bipolaren Weltordnung trifft, sondern den Chiffren, Metaphern, Atmosphären und Gefühlslagen nachspürt, die mit dem Verfall eines Systems und einem politischen Umbruch verbunden sind, und die in ihrer Folgewirkung bis heute ungebrochene Aktualität besitzen.2 Die einleitenden Worte Gerald Matts, Direktor der Kunsthalle Wien, zur Ausstellung »1989. Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft« aus dem Jahr 2009 vergegenwärtigen programmatisch die annähernd emphatische Verkündigung eines mit der Wende von 1989/90 einhergehenden Epochenbruchs in der Kunst, hier der bildenden Kunst. Die Wiener Ausstellung ist eine von vielen, die im Anschluss an die deutsche Wiedervereinigung Auswirkungen des Zusammenbruchs des osteuropäischen Kommunismus, den Fall des ›Eisernen Vorhangs‹, auf zeitgenössische künstlerische Entwürfe untersuchen.3 Eine der zentralen Beobachtungen ist dabei jene, dass die Kunst nach 1989 Abschied von postmodernen Konzepten, insbesondere der von Lyotard postulierten Auflösung der ›großen Erzählungen‹, nimmt und mit den realgeschichtlichen Veränderungen, allen voran der deutschen Vereinigung, der Begriff einer historisch fassbaren Wirklichkeit erneut Eingang in die Kunst gefunden habe.4 Tatsächlich ist es auch im literarischen Feld gerade der Wirklichkeitsbegriff, an dem sich unmittelbar nach 1989 literaturkritische wie -wissenschaftliche Diskussionen entzünden – wie der deutsche Literaturstreit um Christa Wolfs Erzählung Was bleibtexemplarisch zeigt. Ralf Schnell pointiert in seinem literaturgeschichtlichen Überblick über die Literatur nach 1945 den zentralen Vorwurf, dem sich insbesondere die Schriftsteller der DDR stellen müssen: »Wohl nie zuvor haben so viele prominente Schriftsteller in so konzentrierter Form ein so hohes Maß an Wirklichkeitsindifferenz unter Beweis gestellt wie zum Zeitpunkt des Umbruchs in der DDR.«5 Ähnliche Vorwürfe werden zugleich auch mit Blick auf die Literatur der Bundesrepublik geltend gemacht. Heinz Ludwig Arnold klagt mit Blick auf die Literatur der 1980er Jahre den Wirklichkeitsverlust in der Gegenwartsliteratur an und konfrontiert in seiner Abrechnung mit der postmodernen Literatur gerade Autoren historisch-fiktionaler Literatur (Christoph Ransmayr, Patrick Süskind, Hanns-Josef Ortheil, Umberto Eco) mit dem Eskapismus-Vorwurf: Geschichtlich fundiert, aus Realität, ihrer Anschauung und Erfahrung gewonnen ist solche Literatur nicht; sie gibt auch keine Verweise auf die Wirklichkeit, in der sie entstanden ist – im Gegenteil, sie meidet sie, flieht in eine Metarealität und will von einer Bindung der Literatur an die Realität bewußt nichts wissen. […] Sie dient bloß noch der Ablenkung von erdenschwerer Besorgtheit, ist eklektisch und spielerisch, ihr Genuß wird von der momentanen Laune des rezipierenden Individuums bestimmt, sie ist also weniger subjektiv als individuell im extremsten Maß – in ihr bildet sich ab die große Bewegung unserer Zeit: der Sprung aus der Verantwortlichkeit für unser Dasein, das wir schon längst nicht mehr in der Hand haben, die Flucht aus der Gegenwart ins Leere, der Sprung aus der Last in die scheinbare Lust.6 Arnold, so wird unmissverständlich deutlich, verhandelt einen Literaturbegriff, der nicht mehr vorrangig ästhetischen als nunmehr moralischen wie gesellschaftspolitischen Anforderungen unterliegt. Mit Blick auf die Wende und »angesichts einer so grundstürzend veränderten Welt«7 idealisiert Arnold eine Literatur, die sich einmischt, und fordert von Autoren »Lust auf politische Gegenrede und kritisches Engagement«8. Dieser politischen Inanspruchnahme der Literatur widersprechen jene Stimmen, die, wie etwa Frank Schirrmacher in der FAZ, den endgültigen »Abschied von der Literatur der Bundesrepublik« und eine Gegenwartsliteratur einfordern, die zu jenen politisch-moralischen Kategorien, wie Arnold sie vermisst, gerade kritisch auf Distanz geht.9 Ästhetik, so lautet der vielzitierte Vorwurf Schirrmachers, sei in den der Wende vorausgegangenen Jahrzehnten in beiden Teilen Deutschlands durch »Gesinnung« ersetzt worden – eben das müsse sich nun grundlegend ändern. Auch Ulrich Greiner erkennt in dieser vermeintlich typisch »deutschen Gesinnungsästhetik« das »gemeinsame Dritte« zwischen den Literaturen von BRD und DDR: Mit der deutschen Einheit hofft er den Aufbruch in eine neue literarische Epoche begrüßen zu können, die nicht nur die nationale Identität, sondern mit ihr die Aufgaben der Literatur, mithin den seines Erachtens moralisch wie politisch instrumentalisierten Literaturbegriff neu entwerfen könne.10 Bemerkenswert bleibt, mit welcher Vehemenz der gesamte Literaturbetrieb unmittelbar nach der Wende einen literarischen Epochenumbruch ausruft und diesen gleichzeitig für die Abrechnung mit der Literatur bis 1989 nutzt. Literarische Reaktionen auf diese vermeintlich neue Zeitrechnung bleiben nicht lange aus, sondern zeigen sich beispielhaft in Texten, die, wie Frank Thomas mit Blick auf die Erzählliteratur der 1990er Jahre konstatiert, den Fall der Mauer literarisch geradezu »zum ›unerhörten Ereignis‹ im Goetheschen Sinne« überhöhen und als Beginn einer »neuen Zeit« oder als »neues Jahr Null« ausweisen.11 Jenseits dieser emotional und mitunter polemisch geführten Diskussion hat sich in der retrospektiven literaturwissenschaftlichen wie -historischen Wertung die Einsicht, dass die Jahre 1989/90 einen Epochenumbruch innerhalb der literarischen Historiografie markieren, als wissenschaftlicher ›common sense‹ etabliert, gegen den nur vereinzelt Einspruch erhoben wird.12 Daraus resultierende Forderungen an die Literaturgeschichtsschreibung fallen heterogen aus und spiegeln sich insbesondere im nach wie vor kontrovers diskutierten Umgang mit den Literatursystemen der getrennten deutschen Staaten wider. Roswitha Skare verweist in ihrer Untersuchung der jüngsten deutschen, nach 1990 erschienenen Literaturgeschichten auf die beiden Tendenzen, die sich abzeichnen: Während die einen zwar eine kritische Revision sowohl der DDR- wie auch der westdeutschen Literaturgeschichte einfordern, jedoch an deren Trennung festhalten,13 plädieren andere dafür, die DDR-Literatur in die Geschichte der westdeutschen Literatur zu integrieren.14 Ungeachtet bestehender Kontroversen schlussfolgert Skare in ihrer Untersuchung, dass der ›Blick der Einheit‹ sich in der Literaturgeschichtsschreibung durchgesetzt habe, was nicht zuletzt auf ein neues Geschichtsbewusstsein nach dem Fall der Mauer und dem Auseinanderfallen des Ostblocks zurückzuführen sei: Außerdem entspricht man einer Tendenz in der deutschen Gesellschaft nach 1989/90 nach erneutem Geschichtsinteresse, nach Aufklärung über die Vergangenheit und historische Zusammenhänge, zumal die meisten dieser Informationen für den ostdeutschen Teil der Bevölkerung über viele Jahre kaum oder nur sehr schwierig zugängig waren.
Читать дальше