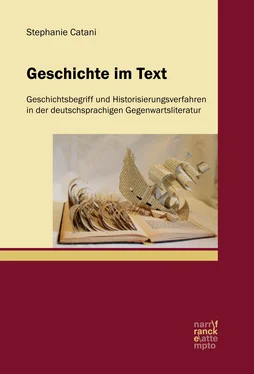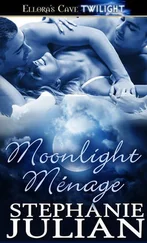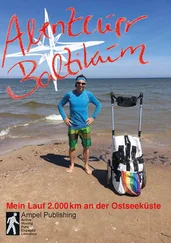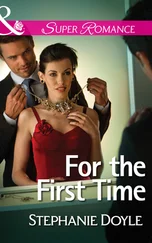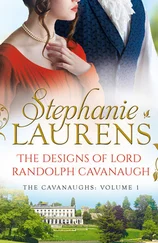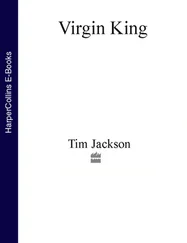1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 An der Schwelle zum 21. Jahrhundert hat sich der historische Roman weit entfernt von den Anfängen der Gattung, den Romanen Walter Scotts oder den geschichtsvermittelnden historisch-fiktionalen Texten des 19. Jahrhunderts. Entsprechend konstatiert Hugo Aust in seinem 2004 erschienenen Beitrag zum historischen Roman im 20. Jahrhundert noch einmal die grundlegend veränderte Erscheinungsform der Gattung und stellt fest, dass der historische Roman »zur (produktiven) Infragestellung seiner eigenen Voraussetzungen« geworden sei.72 Nünnings Thesen aufnehmend unterstreicht Aust die metafiktionalen und selbstreflexiven Implikationen des Genres, die im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu konstitutiven Gattungsmerkmalen avancieren, wobei die Gattungsdefinition mit Aust grundsätzlich erschwert sei, da zum einen nicht jeder historische Roman als solcher angekündigt werde und zum anderen »Romane, die durchaus historische Romane sind, sich ausdrücklich von diesem Gattungstitel distanzieren«.73 Tatsächlich wird an späterer Stelle auf das auffällige Unbehagen zahlreicher Gegenwartsautoren angesichts einer Kategorisierung ihrer eigenen Texte als »historische Romane« eingegangen. (Vgl. Kap. 5.2) Diese Angst fällt umso mehr auf, als sie von einer Konjunktur historischer Themen in der Literatur des ausgehenden 20., insbesondere des beginnenden 21. Jahrhunderts begleitet wird. Mit Aust bleibt es eine besondere Leistung des historischen Romans im Verlauf des 20. Jahrhunderts, Instrumente der Geschichtskonstruktion, des historischen Wissenserwerbs und nicht zuletzt der Erinnerungsarbeit offenzulegen: »Erinnerung und Vergessen – sie durchziehen den Geschichtsroman des zwanzigsten Jahrhunderts von Anfang bis Ende.«74 Mit dem von Aust aufgeworfenen Erinnerungsdiskurs ist eines der Leittopoi historisch-fiktionaler Texte um die Jahrtausendwende angesprochen: Es wird sich im Verlauf der literarischen Analysen zeigen, dass historische Romane der unmittelbaren Gegenwart nicht nur unterschiedlichste Formen von Erinnerung und Gedächtnis thematisieren, sondern dabei zugleich das mitunter problematische Verwandtschaftsverhältnis von Geschichte und Erinnerung diskutieren. Dass sich der historische Roman der Gegenwart entscheidend von seinen Vorläufern im 19. Jahrhundert abgrenzt, dokumentiert die 2007 erschienene komparatistische Untersuchung Barbara Potthasts zum historischen Roman des 19. Jahrhunderts.75 Potthast zeigt, wie in Romanen des 19. Jahrhunderts ein Geschichtsbegriff verhandelt wird, der die Fakten der Vergangenheit sowie den Auftrag des literarischen Textes, diese authentisch abzubilden, ernst nimmt. Die Gattung sei, so stellt Potthast heraus, hier noch einer unbedingten »Wirklichkeitsnähe« verpflichtet, welche sich etwa in den Romanen Wilhelm Hauffs im dort entwickelten Ideal des »treu poetische[n] Bild des Lebens« stellvertretend wiederfindet.76 Ziel der Gattung im 19. Jahrhundert ist es mit Potthast aber dennoch, Geschichte und Leben miteinander zu verbinden und zugleich eine genuine Verwandtschaft von Historiografie und Literatur zu behaupten – eine Verwandtschaft, die Potthast als Antizipation der Thesen Hayden Whites versteht.77 Mit Martin Neubauers Studie zu Geschichte und Geschichtsbewusstsein im Roman der Jahrtausendwendeerscheint 2007 schließlich die bislang aktuellste Monografie zum deutschsprachigen Roman der jüngsten Gegenwart.78 Dass im Titel der Gattungsbegriff nicht auftaucht, verweist auf das gegenwärtige Unbehagen eindeutiger Kategorisierungen und vorbelasteter Genrezuschreibungen, das von den Autoren historisch-fiktionaler Texte und literaturwissenschaftlicher Positionen gleichermaßen ausgetragen wird. Neubauer seinerseits verweigert sich einer Gattungsdefinition ganz und lässt darüber hinaus die inzwischen fast kanonische Ausdifferenzierung zwischen traditionellem und ›anderem‹ historischem Roman unberücksichtigt. Gerade diese Unterscheidung hätte sich jedoch angeboten, um den mit Neubauer »trivialen historischen Roman«, den er einer »breiter rezipierten Unterhaltungsliteratur« zuordnet, von den durch Kritik und Wissenschaft gleichermaßen kanonisierten Texten abzugrenzen.79 Neubauer hingegen bezieht bewusst Beispiele aus der unterhaltenden Literatur in seine weit über dreißig Textanalysen mit ein und kommt entsprechend zu wenig homogenen Schlussfolgerungen, die Fragen der Metafiktionalität und Selbstreflexivität der Texte nur randständig behandeln. Für die Gegenwart lässt sich mit Blick auf den historischen Roman bzw. historisch-fiktionale Texte festhalten: Dort, wo diese Texte nicht voreingenommen der Trivialliteratur zugerechnet werden, vermitteln sie das Bild einer Gattung, die gerade explizit mit dem literarischen Diskurs verknüpfte Begriffe reflektiert (Narrativität – Selbstreflexivität – Fiktionalität) und damit grundlegende Aussagen zum Literaturbegriff der Gegenwart formuliert. Zugleich ist die Frage nach dem ›historischen Gehalt‹ im Allgemeinen wie der Authentizität literarisch vermittelter historischer Ereignisse im Besonderen in den Hintergrund gerückt. Entsprechend vage müssen Definitionsansätze der Literaturwissenschaft ausfallen, wenn sie das, was einen Roman zum historischen macht, zu bestimmen suchen. Bezeichnenderweise stößt man in der unlängst erschienenen Dissertation Erik Schillings zum historischen Roman seit der Postmoderne ausgehend von Texten Umberto Ecos auf eine nur noch weit gefasste Definition, die auf eine zeitliche Grenzziehung im Sinne der Scott’schen sixty years sinceganz verzichtet und solche Texte als historische Romane auffasst, »die in wenigstens einem für die Handlung fundamentalen Erzählkern auf einem historischen Ereignis, einer historischen Persönlichkeit oder einem historischen Text beruhen.«80 Das Attribut »historisch« kennzeichnet mit Schilling keine temporale Einordnung, sondern meint ein Ereignis, das »keine unmittelbaren und kollektiv wahrzunehmenden Konsequenzen mehr für die Gegenwart hat.«81 An dieser Stelle aber wird es schwierig mit dem Definitionsvorschlag Schillings, insbesondere sichtbar gemacht durch seine kurze Analyse von Ulrike Draesners Roman Spiele, einem Text über die Geiselnahme bei den Olympischen Spielen in München 1972. Draesners Roman, der 2005 erscheint, fällt einerseits mit einem reduzierten Erzählabstand zum dargestellten historischen Sujet auf, welches damit eher der Zeitgeschichte als der Historie zugerechnet würde. Zum anderen bleibt fraglich, ob Olympia ’72 tatsächlich keine unmittelbaren und kollektiv wahrzunehmenden Konsequenzen nach sich zieht – zumindest der Roman selbst, dem es gerade um die Verwebung von Mikrohistorie und Makrohistorie geht, stellt dies in Frage. Darüber hinaus bestimmt eine andauernde, sowohl individuelle wie auch kollektive Wirkungskraft ein historisches Ereignis in seiner Geschichtlichkeit: Gerade der historische Roman der Gegenwart, soviel wird noch zu zeigen sein, macht das unmittelbare Fortwirken der Vergangenheit in der Gegenwart sichtbar, indem er die zeitlichen Ebenen konsequent miteinander verschränkt. (Vgl. Kap. 6.1.2) Schilling behauptet in seiner Studie einen Paradigmenwechsel der Gattung nach der Postmoderne, der die ausgestellte Pluralität und Multiperspektivität historischen Wissens durch die Suche nach Identität ersetze, der »offene[n] Trias von Autor, Leser und Text« mit einer prominenten Erzählerfigur begegne und das Spannungsverhältnis von Historie und Fiktion »zugunsten einer Präferenz des Fiktionalen« auflöse.82 Die vorliegende Untersuchung stimmt einer Verortung der Gattung jenseits des Postmoderne-Begriffes zu, ohne dabei die von Schilling vorgenommene Differenzierung zwischen einem postmodernen und post-postmodernen historischen Roman sowie den soeben skizzierten Befund zu teilen: Im historischen Roman der unmittelbaren Gegenwart verbinden sich, so die hier verfolgte These, identitätsstiftende Themen mit der Problematik einer ausschließlich über polyvalente Wahrnehmungsprozesse zu erfassenden Wirklichkeit.
Читать дальше