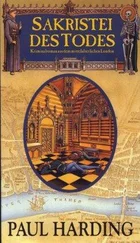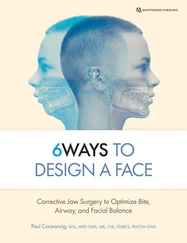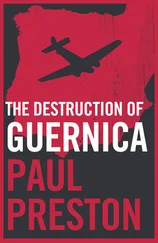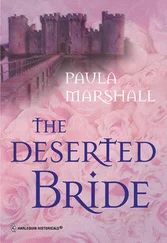Bismarck erklärte später, weder er noch sein Sohn sei der Verfasser dieses und der darauf folgenden Artikel in der Norddeutschen Allgemeinen gewesen 114). Aber wie ernst er die intime Zusammenkunft des Prinzen mit Waldersee und Stoecker nahm, zeigen seine Memoiren. Im dritten Band seiner »Gedanken und Erinnerungen«, in dem er seine Beziehungen zu Prinz Wilhelm beschreibt, befaßt sich das erste Kapitel fast nur mit der Waldersee-Angelegenheit und dem daraus entstandenen Briefwechsel mit dem Prinzen über Stoecker. Er riet dem Prinzen dringend ab, die Schirmherrschaft über die Mission zu übernehmen, und »sich vor der Thronbesteigung schon die Fessel irgendwelcher politischen oder kirchlichen Vereinsbeziehungen aufzuerlegen« 115). Diese Auseinandersetzung legte den Keim für die Entfremdung zwischen dem Kanzler und dem künftigen Herrscher.
Hinter jener dringenden Warnung Bismarcks lag mehr als persönliche Rivalität mit Waldersee. Zwar sollte der Hieb auf Stoecker gewiß Waldersee als möglichen Kanzler des Prinzen Wilhelm ausschalten; es ist bekannt, wie eifersüchtig und mißtrauisch Bismarck gegen Persönlichkeiten war, in denen er potentielle Nachfolger argwöhnte, wie schonungslos er sie aus dem Wege räumte. Aber hier ging es um ernstere Fragen. Der alternde Staatsmann beobachtete mit steigender Besorgnis und Gereiztheit jede neue Entwicklung, von der die noch ungefestigte Struktur des Reiches bedroht werden könnte. Würde sie dem wachsenden Druck innerer Konflikte standhalten? Würde sein Regierungssystem, das zwar nicht parlamentarisch, aber auch nicht gegen solche Konflikte geschützt war, allen Gefahren widerstehen? Bismarcks Vertrauen in seine eigene Fähigkeit, die Zukunft des Reiches zu sichern, mag unbegrenzt gewesen sein, aber seine Macht war es nicht.
Die Stellung des Reichskanzlers war entscheidend geschwächt durch ihre strikte Abhängigkeit vom Kaiser. Da Bismarck die Parteien von oben herab zu behandeln pflegte, konnte er sich auf keine von ihnen unbedingt verlassen. Er war auch nicht der anerkannte Wortführer irgendeiner bestimmten sozialen Gruppe. Die besonders im Ausland verbreitete Annahme, er sei vor allem der Vertreter seiner eigenen Kaste, der Junker, gewesen, ist völlig abwegig. Selbst die preußische Armee blieb nur so lange ein williges Werkzeug in seiner Hand, als er das uneingeschränkte Vertrauen des Königs besaß. Wilhelm I. war allerdings völlig auf seinen Kanzler angewiesen. Solange der Kaiser lebte, durfte Bismarck hoffen, durch geschicktes Manövrieren oder, falls nötig, durch Verfassungsbruch die undemokratische Struktur des Reiches bewahren zu können. Aber sobald einmal der ehrgeizige junge Wilhelm II. Kaiser sein würde, bestand die Gefahr eines tiefen Konflikts zwischen Regierung und Reichstag, der dem jungen Staat zum Verhängnis werden könnte. Im Kartell wollte Bismarck eine repräsentative und dauernde Verbindung aller staatstreuen Kräfte schmieden, auf denen sein Reich beruhte: Aristokratie, Armee, Beamtenschaft und gemäßigt liberales, aber nationalgesinntes Bürgertum. Vereinigt sollten sie stark genug sein, die Sozialdemokraten in Schach zu halten und die Schritte des jungen Kaisers zu lenken. Das Kartell war die Voraussetzung für eine stabile Regierung. Als Bismarck es durch Stoeckers Oppositionsgruppe innerhalb der Konservativen gefährdet sah, schlug er mit aller Macht zurück. Er warnte den Prinzen:
»Es gibt Zeiten des Liberalismus und Zeiten der Reaktion, auch der Gewaltherrschaft. Um darin die nötige freie Hand zu behalten, muß verhütet werden, daß Ew. Hoheit schon als Thronfolger von der öffentlichen Meinung zu einer Parteirichtung gerechnet werden. Das würde nicht ausbleiben, wenn Höchstdieselben zur inneren Mission in eine organische Verbindung treten, als Protector.« 116)
Bismarcks Autorität und die Erregung, die Waldersees Schachzüge allenthalben hervorgerufen hatten, veranlaßten den Prinzen, die Mission fallen zu lassen. Mit Sorge sah Stoeckers Kreis, wie der Kanzler den künftigen Kaiser für seine Kartellpolitik gewann. »Es hat seitdem jede persönliche Berührung des Hofes mit der Stadtmission und ihrem Leiter aufgehört. Beide sind seitdem in gewissen hohen Kreisen vervehmt«, klagte Stoeckers ergebener Biograph 117).
Im März 1888 starb Wilhelm I. Friedrich III., sein schwerkranker Sohn, auf dessen liberale Gesinnung die Freisinnigen so große Hoffnungen gesetzt hatten, und dem der Ausspruch zugeschrieben wird, die antisemitische Bewegung sei »die Schmach des Jahrhunderts«, regierte nur drei Monate lang. Er war entschlossen, der antisemitischen Agitation ein Ende zu bereiten, und stellte den Fall Stoecker gleich bei der ersten Zusammenkunft seines Kronrates zur Debatte. Da Kaiser und Kanzler sich einig waren, schien Stoeckers Schicksal besiegelt. Aber wiederum kamen politische Erwägungen dazwischen. Bismarck gelang es, den Kaiser davon abzubringen, Stoecker ohne weiteres aus seinem Amt als Hofprediger zu entfernen. Zum dritten Male wurde entschieden, Stoecker bedingungslos zwischen seinem Amt und seiner politischen Tätigkeit wählen zu lassen.
Bismarcks Intervention für Stoecker kam nicht etwa aus einer plötzlichen Sympathie für seinen bisherigen Widersacher. Er wollte Stoecker beseitigen, aber nicht durch einen aufsehenerregenden Gewaltstreich, aus dem die Freisinnigen, seine alten Gegner, die schon seit langem die Entlassung des Hofpredigers verlangt hatten, Nutzen ziehen könnten. Für Bismarcks Zwecke war es ausreichend, Stoecker von der Politik fernzuhalten. Die Entscheidung des Kronrates wurde Stoecker erst im Frühjahr 1889 mitgeteilt, als Wilhelm II. schon den Thron bestiegen hatte. Stoecker entschied sich für sein Hofpredigeramt.
Das Abkommen, das er nach einer Unterredung mit einem Vertreter des Kaiserlichen Hofes selbst entwarf, hatte folgenden Wortlaut:
»Da Se. Majestät eine Tätigkeit, wie ich sie bisher im politischen Leben Berlins ausgeübt habe, mit dem Amte eines Hofpredigers für unvereinbar halten, ist es selbstverständlich, daß ich dieselbe aufgebe, so lange Se. Majestät mir dies Amt anvertrauen. Nach den gemachten Erfahrungen habe ich auch zunächst jede Freudigkeit verloren, den öffentlichen Kampf gegen den Umsturz auf politischem, sozialem und religösem Gebiete in der bisherigen Weise fortzusetzen. Es hat deshalb für mich unter den gegenwärtigen Verhältnissen keine Schwierigkeit, sondern entspricht meiner Neigung, den politischen Parteikampf überhaupt für mich wie für die christlich-soziale Partei einzustellen. Ich werde diesen Teil meiner Tätigkeit anderen überlassen und meine Vorträge nach Thema, Inhalt und Ton so einrichten, daß sie Seiner Majestät keinen Anstoß geben können. Ich werde, wenn ich öffentlich zu reden habe, nur religiöse, patriotische und soziale Gegenstände besprechen, und die letzteren nur so weit behandeln, als sie unter den Gesichtspunkt des Christentums, der Kirche und der Inneren Mission fallen. Sollte ich später von Gewissens wegen mich veranlaßt sehen, im Interesse des Vaterlandes oder der Kirche den Kampf wieder aufzunehmen, so werde ich Sr. Majestät davon pflichtmäßige Mitteilung machen und Allerhöchstderselben alles weitere untertänigst anheimstellen.« 118)
Stoecker ließ sich in seiner Entscheidung von mehreren Gründen leiten. Das Kartell, glaubte er, habe bald abgewirtschaftet, ein offener Konflikt mit dem Kaiser aber könne auf seine Freunde und Förderer rückschlagen und ihre Kräfte brachlegen.
»Ein erfolgreicher agitatorischer Kampf gegen den Umsturz ist in Deutschland nicht möglich ohne die freudige Mithilfe der christlich-sozialen und starkkonservativen Kreise, die jetzt zurückgestoßen sind.« 119)
Von nun an wurden Stoeckers Schritte scharf überwacht. Seine kirchlichen Vorgesetzten verweigerten ihm die Erlaubnis, im Ausland Vorträge zu halten. Bei verschiedenen Gelegenheiten wurde er verwarnt wegen Äußerungen, die nach kirchlicher Ansicht dem Geiste des Abkommens zuwiderliefen. Aber trotz der Spannungen mit Kirche und Regierung waren seine politischen Aussichten durchaus nicht hoffnungslos. Die Zeit schien für ihn zu arbeiten. Seine Warnung, die »Umstürzler« könnten nicht durch die einzige Waffe, die den Mittelparteien zur Verfügung stand, die nationale Idee, besiegt werden, begann sich zu bewahrheiten. Im Februar 1890 wurde das Kartell in den Reichstagswahlen vernichtend geschlagen. Nur ein gutes Drittel der Reichstagssitze verblieb den drei Kartellparteien; die Nationalliberalen gingen von 99 auf 42 Mandate zurück, die Deutschkonservativen von 80 auf 73, die Frei-Konservativen von 41 auf 21. Die Freisinnigen aber gewannen mehr als das Doppelte, 67 statt 32 Mandate, und die Sozialdemokraten verdreifachten ihre Sitze, von 11 auf 35. Das Zentrum war mit 106 statt 98 Mandaten zur stärksten Fraktion geworden. Die Angstpropaganda hatte ihre Zugkraft verloren. In den Großstädten hatten die Industriearbeiter ihren Protest gegen die steigenden Lebenshaltungskosten, eine Folge der Schutzzollpolitik, zum Ausdruck gebracht. In Berlin übertraf die Zahl der sozialdemokratischen Wahlstimmen die jeder anderen Partei. Ein weiteres Ansteigen der Sozialdemokratie schien unvermeidlich, denn am 1. Oktober 1890 lief das Sozialistengesetz ab, dessen Verlängerung die neue Reichstagsmehrheit – Zentrum, Freisinnige, Sozialdemokraten, 208 von 397 Abgeordneten – abgelehnt hatte 120).
Читать дальше