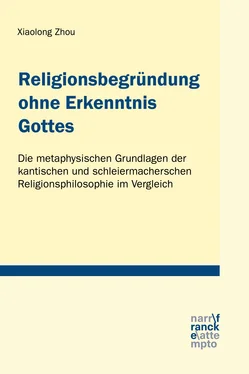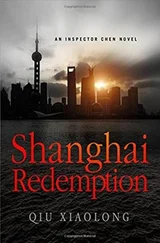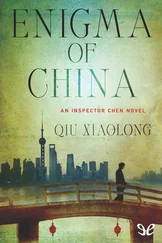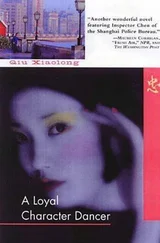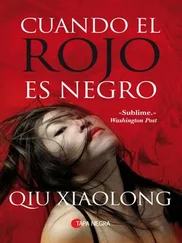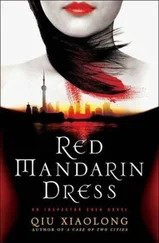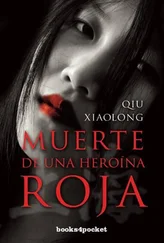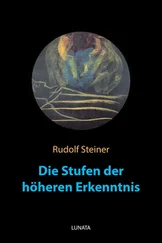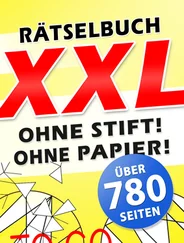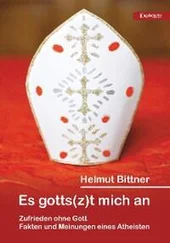2.1.2 Der Gottesbeweis im „Beweisgrund“ und das transzendentale Ideal
Der Leitfaden des Gottesbeweises im Beweisgrund kann so formuliert werden: Ausgehend von der Möglichkeit der Dinge überhaupt wird auf das ens realissimum geschlossen. Obwohl Kant im 2. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes den gesamten Ableitungsprozess mit der vollständigen Erkenntnis der Dinge beginnt,1 hat er sich an die Grenzen der Erkenntnistheorie nicht streng gehalten. Peter Rohs behauptet, dass der Inbegriff aller möglichen Prädikate nicht zum enti realissimo führt, da das vollständige Erkennen der Dinge nichts mit dem Begriff der Theologie (dem enti realissimo ) zu tun hat: „zur Idee vollständiger Erkenntnis gehört die Idee einer vollständigen Menge möglicher Prädikate, aber nicht die eines ens realissimum .“2 Dies ist tatsächlich das Ergebnis einer irrtümlichen Begrenzung des Ableitungsprozesses des allerrealsten Wesens im epistemologischen Kontext. Peter Rohs ist einer der wenigen Forscher, die die Wichtigkeit des Prinzips der durchgängigen Bestimmung bemerken. Rohs begrenzt sich allerdings auf den epistemologischen Zweck des vollständigen Erkennens der Dinge. Außerdem ignoriert er die enge Beziehung zwischen dem enti realissimo und dem Gottesbeweis im Beweisgrund . Um die Kritik an der Vorstellung eines allerrealsten Wesens (eines entis realissimi ) in den Paragraphen 1–15 zu verstehen, ist es notwendig, dass wir den Gottesbeweis im Beweisgrund zuerst genau betrachten.
Der Beweisgrund beginnt mit der Möglichkeit der Dinge. Kant teilt die Möglichkeit der Dinge nach Form und Materie ein: Die Möglichkeit hinsichtlich der Form unterwirft sich dem Gesetz des Widerspruchs, und die Möglichkeit in Bezug auf die Materie hängt von der Realität ab. Kants nächstes Argument befasst sich hauptsächlich mit der Möglichkeit der Dinge auf Seiten der Materie, die auf einem Realen (einem realiae ) basiert. Da es sich beim Realen eigentlich um Materie der Möglichkeit der Dinge handelt, würden alle Möglichkeiten aufgehoben, wenn das Reale aufgehoben würde:
„Nun geschieht dieses durch die Aufhebung alles Daseins, also wenn alles Dasein verneint wird, so wird auch alle Möglichkeit aufgehoben. Mithin ist schlechterdings unmöglich, daß gar nichts existire.“3
D.h. solange es irgendeine Möglichkeit gibt, gibt es ein Reales. Daraus ergibt sich, dass es irgendein Reales gibt. Anschließend legt Kant die Beziehung zwischen der Möglichkeit der Dinge und der realen Sache fest: „diese Beziehung aller Möglichkeit auf irgendein Dasein kann nun zwiefach sein. Entweder das Mögliche ist nur gedanklich, in so fern es selber wirklich ist, und dann ist die Möglichkeit in dem Wirklichen als eine Bestimmung gegeben; oder es ist möglich darum, weil etwas anders wirklich ist, d.i. seine innere Möglichkeit ist als eine Folge durch ein ander Dasein gegeben.“4 Das erste bezieht sich auf die Beziehung zwischen der Möglichkeit und einem konkreten Ding, wie das Denken die Bestimmung des Subjekts ist; das zweite bezieht sich auf das Verhältnis der Möglichkeit der Dinge zu einem Wesen, das alle Realitäten enthält. Offensichtlich konzentriert sich Kant auf das letztere. Kant zufolge gibt es ein Wesen, das der Realgrund aller Möglichkeiten ist. In der anschließenden Untersuchung definiert Kant dieses Wesen als ein schlechterdings notwendiges Wesen (das ens necessarium ). Der Grund für diese Definition liegt darin, dass es als Realgrund aller Möglichkeiten absolut notwendig ist: „schlechterdings nothwendig ist, dessen Gegentheil an sich selbst unmöglich ist.“5 Kant fasst diesen Prozeß folgendermaßen zusammen:
„Alle Möglichkeit setzt etwas Wirkliches voraus, worin und wodurch alles Denkliche gegeben ist. Demnach ist eine gewisse Wirklichkeit, deren Aufhebung selbst alle innere Möglichkeit überhaupt aufheben würde. Dasjenige aber, dessen Aufhebung oder Verneinung alle Möglichkeit vertilgt, ist schlechterdings nothwendig.“6
Das heißt, alle Möglichkeiten beruhen auf der Existenz eines entis necessarii , das also nicht ohne Existenz sein kann, sonst würden alle Möglichkeiten verneint. Deshalb muss es notwendig existieren. Danach weist Kant darauf hin, dass dieses ens necessarium einig, einfach, unveränderlich und ewig ist, und dass es die höchste Realität enthält. Es besteht kein Zweifel, dass es Gott ist. Das ist Kants letzte Schlussfolgerung.7
Wir bemerken, dass hier auf das ens necessarium geschlossen wird, zu welchem die höchste Realität als seine Eigenschaft gehört. Umgekehrt wird aber im 2. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes auf das ens realissimum geschlossen, als dessen Prädikat die Notwendigkeit betrachtet wird. Aus diesem Grund gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen beiden. Allerdings erinnert der Gottesbeweis im Beweisgrund uns an den kosmologischen Beweis im 3. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes:
„Der kosmologische Beweis, den wir jetzt untersuchen wollen, behält die Verknüpfung der absoluten Nothwendigkeit mit der höchsten Realität bei; aber anstatt wie der vorige von der höchsten Realität auf die Nothwendigkeit im Dasein zu schließen, schließt er vielmehr von der zum voraus gegebenen unbedingten Nothwendigkeit irgend eines Wesens auf dessen unbegränzte Realität […]“8
D.h. der 2. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes deckt die Illusion auf, „von der höchsten Realität auf die Nothwendigkeit im Dasein zu schließen“. Im Vergleich dazu ist der Denkprozess im Beweisgrund dem kosmologischen Beweis ähnlich, welcher von der absoluten Notwendigkeit auf die höchste Realität schließt. Daher hat Dieter Henrich mit Nachdruck darauf hingewiesen: „der einzig mögliche Beweisgrund ist ursprünglich ein Beweis vom Dasein des notwendigen Wesens. Seiner ganzen Anlage und systematischen Stellung nach ist er der Versuch einer Antwort auf das Problem des kosmologischen Grundbegriffes.“9 Daneben erweitert Dieter Henrich diese Schlussfolgerung und sagt: „der Beweis aus dem Vernunftideal der omnitudo realitatis ist nur der Beweis von Gottes Existenz. Die klassischen Beweise und vor allem der ontologische sind aber zugleich von dem kosmologischen Problem des ‚ens necessarium‘ bestimmt.“10 Mit anderen Worten, der Beweisgrund und die traditionellen Gottesbeweise drehen sich um das Konzept des entis necessarii . Im Vergleich dazu führt das ens realissimum , das im 2. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes abgeleitet ist, nicht dazu, dass es notwendig existieren muss. Dieter Henrich macht jedoch nicht klar, welcher Unterschied zwischen der reinen Existenz und dem notwendigen Dasein besteht, denn Kant sagt auch: „Es versteht sich von selbst, daß die Vernunft zu dieser ihrer Absicht, nämlich sich lediglich die nothwendige durchgängige Bestimmung der Dinge vorzustellen, nicht die Existenz eines solchen Wesens , das dem ideale gemäß ist […] voraussetze“.11 Aus diesem Zitat ergibt sich, dass Kant die Grenze zwischen der Existenz und dem notwendigen Dasein verdeutlicht hat. Wir müssen Dieter Henrichs Urteil möglichst genau analysieren. Er behauptet: „Die Fehler des Beweises vom Jahre 1763 ist dem analog, den die Kritik der reinen Vernunft aufdeckt: Was nur subjektive Gültigkeit für die Möglichkeit des Denkens hat, wird hypostasiert zum Prinzip aller Dinge.“12 Henrich scheint zu sagen, dass das Ideal des entis realissimi nur eine subjektive Gültigkeit hat, dagegen wollen der Beweisgrund und die traditionellen Gottesbeweise darstellen, dass dieses Ideal notwendigerweise objektiv existiert.
Joseph Schmucker bringt zwei sehr subtile Kritikpunkte an Dieter Henrich vor: (1) Enthält das ens realissimum das Prädikat der Notwendigkeit? (2) Kann es sein, dass das Ideal des entis realissimi , das aus dem 2. Abschnitt des Theologie-Hauptstückes stammt, unmittelbar eine Umdeutung des Beweises im Beweisgrund aus der Perspektive der kritischen Philosophie ist? Im Folgenden möchte ich beide Punkte weiter verdeutlichen.
Читать дальше