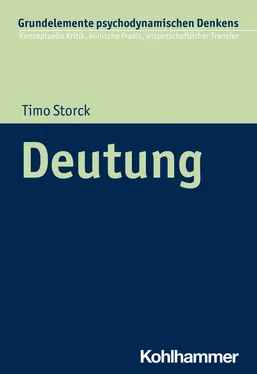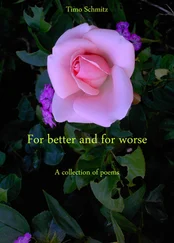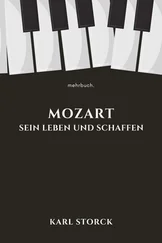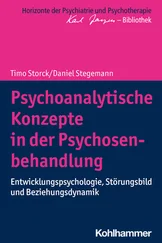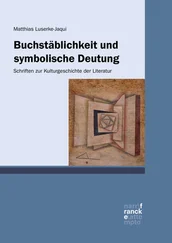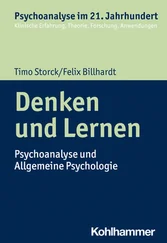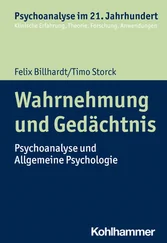Dabei werden umgrenzte Abwehrmechanismen beschrieben (etwa die Verdrängung, die insofern eine besondere Bedeutung hat, als sich in den meisten Fällen ein zweiter Abwehrmechanismus zur Umarbeitung des Verdrängten daran anschließt), aber auch Abwehrformationen, also Strukturen, die stärker die Persönlichkeit und/oder strukturelle Fähigkeiten betreffen, gleichsam stärker in die psychische Struktur eingefasste Abwehrweisen, die insofern globaler sind, als sie sich nicht auf konkrete Vorstellungen oder Handlungen beschränken.
Als Widerstand wird das Auftreten von Abwehrmechanismen und -formationen in der analytischen Arbeit beschrieben, im Wesentlichen als ein Widerstand gegen die Veränderung und das Aufgeben einmal gefasster, dysfunktionaler, aber sinnhafter Abwehr. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Übertragungs-, aber auch dem Gegenübertragungswiderstand zu. In einer zeitgenössischen und potenziell auch schulenvergleichenden Perspektive wird außerdem die Bedeutung von Beziehungskrisen bzw. Brüchen in der Arbeitsbeziehung und deren Reparatur diskutiert.
Ferner ist es in einem nächsten Schritt (Storck, 2022a) um die Konzeptionen des Ich und des Selbst gegangen. Meist wird das Ich in der Psychoanalyse als eine Bezeichnung der Summe der Ich-Funktionen verwendet, was sich in Auffassungen zur psychischen Struktur (als Vermögen der Regulierung, Differenzierung und Integration in Form unterschiedlicher struktureller Fähigkeiten) fortsetzt. Bei Freud kommt dem Ich als Instanz die Aufgabe zu, zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen von Es, Über-Ich oder Außenwelt zu vermitteln. Daraus entwickelt sich die psychoanalytische Strömung der Ich-Psychologie mit zentralen Themen wie der Frage nach einer »Autonomie« des Ichs von den Trieben. Das Selbst wird psychoanalytisch meist im Sinne der Selbstrepräsentanz verstanden, es steht in einem engen Zusammenhang mit Narzissmustheorien. Im Freud’schen Verständnis, in dem gleichwohl die Begriffe »Ich« und »Selbst« verschwimmen, kann man sagen, dass sich die Selbstrepräsentanz in engem Zusammenspiel mit der Repräsentation des eigenen Körpers und seiner Grenzen vollzieht. Die gesonderte Richtung der psychoanalytischen Selbstpsychologie konzipiert den Narzissmus als gegenüber der Triebtheorie eigene Entwicklungslinie, in der es vor allem um die Möglichkeiten der Idealisierung und der Entidealisierung geht. Von besonderer Relevanz sind Ansätze, in denen »Ich« und »Selbst« im Sinne »dynamischer Strukturen«, so etwa bei Fairbairn (1944), verstanden werden, das heißt, dass psychische Funktionen und Repräsentanzen nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können.
Zugleich sind bei der bisherigen Auseinandersetzung einige Fragen offengeblieben, in erster Linie solche, die die Behandlungstechnik und die Theorie der Veränderung in der Psychoanalyse betreffen. Wie kann es gelingen, dass für Konflikte andere Lösungen gefunden werden? Wie wird (dynamisch) Unbewusstes erreicht, wie werden Abwehrstrukturen verändert? Wie können strukturelle Veränderungen auf den Weg gebracht werden? Wieviel muss geredet werden und worüber und wie lange? Welche Unterschiede gibt es dabei bei unterschiedlichen Patientinnen? Im Umfeld des psychoanalytischen Konzepts der Deutung wird dem im vorliegenden Rahmen nachgegangen.
Dazu wird es zunächst ( 
Kap. 2
) um die Konzeption der Deutung bei Freud gehen, bevor im dritten Kapitel psychoanalytische Bedeutungstheorien diskutiert werden, um darauf blicken zu können, wieviel Einsicht in unbewusste Bedeutungen die psychoanalytischen Interventionen möglich machen sollen ( 
Kap. 3
). Danach wird es unter der Bezeichnung »diverse Deutungen« ( 
Kap. 4
) um Fragen dazu gehen, wie in der Psychoanalyse, der oft genug der Vorwurf gemacht wird, nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen entwickelt und/oder geeignet zu sein, Aspekte der Vielfalt im Hinblick auf Geschlecht, Kultur u. a. Berücksichtigung finden und in welcher Weise die Behandlungstechnik und die Behandlungsziele sich im jeweiligen besonderen Fall unterscheiden. Im Anschluss daran wird es um eine Darstellung des Wandels in der psychoanalytischen Auffassung von Veränderung durch klinische Arbeit gehen ( 
Kap. 5
). Beschlossen wird der Band mit Überlegungen zur Stellung der psychischen Veränderung in Relation zu anderen psychologischen Konzepten und insbesondere dem Verhältnis der Deutung zu Interventionen in anderen psychotherapeutischen Verfahren ( 
Kap. 6
). Eine Zusammenfassung beschließt den Band ( 
Kap. 7
).
1Im vorliegenden Band wechsle ich kapitelweise zwischen einer sprachlichen Verwendung des generischen Femininums und des generischen Maskulinums. Soweit nicht konkrete Personen gemeint sind, sind damit jeweils alle anderen Geschlechter mit gemeint.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.