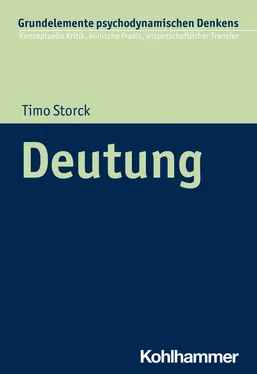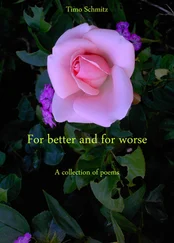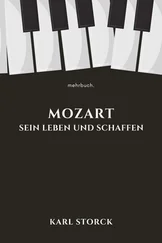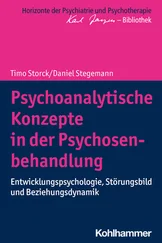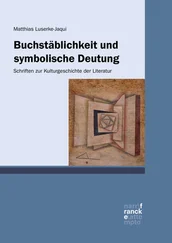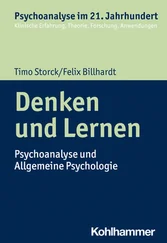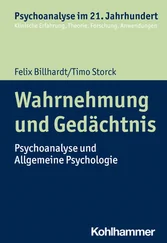Wissenschaftliche Konzepte lassen sich in allgemeiner Hinsicht derart beschreiben, dass in ihnen abstrakt auf den Begriff gebracht wird, wie sich Phänomene der Erfahrung (einschließlich der »inneren« Erfahrung, also etwa das Gefühlserleben) verstehen und begreifen lassen. Das trifft beispielsweise für physikalische Konzepte (Variablen, Konstanten und deren Verknüpfung in gesetzesförmigen Aussagen) zu: Das Konzept »Schwerkraft« hilft dabei, sich einen Reim darauf zu machen, weshalb die Dinge in der Regel zu Boden fallen. Dabei, und das ist konzeptuell entscheidend, lässt sich »die« Schwerkraft nicht beobachten, sondern es lassen sich bestimmte Vorkommnisse beobachten und beschreiben, die auf das Wirken von etwas, das wir als Schwerkraft konzeptualisieren, zurückgeführt werden. Das erlaubt kausale Erklärungen, Vorhersagen und eine experimentelle Untersuchung in Form von »manipulierter« Erfahrung. In Teilen lässt sich dies auch für Konzepte in der Psychoanalyse sagen. Auch hier sollen Phänomene der Erfahrung (oder »Empirie« im eigentlichen, weit gefassten Wortsinn) begreiflich gemacht werden, indem Konzepte entwickelt werden. Auch hier sind Konzepte Abstrakta, auch »das Über-Ich« oder »die Verdrängung« lassen sich nicht beobachten, denn sie sollen ein Modell dafür bereitstellen, Phänomene auf den Begriff zu bringen, etwa besonders starke innere Vorwürfe oder rigide Forderungen, mit denen jemand sich selbst bedenkt, oder das Nicht-Erinnern-Können gerade von emotional bedeutsamen Erlebnisinhalten.
Wissenschaftliche Konzepte werden entlang eines methodisch geleiteten Zugangs zur Welt der Phänomene gebildet, ob nun im Experiment oder in der Feldforschung. Konzepte werden methodisch gewonnen, sie sind methodenabhängig und diese Methoden wiederum beruhen auf Vorannahmen oder bestehendem Wissen. Ferner sind Konzepte Teil konzeptueller Zusammenhänge, aus denen ich einzelne nicht schlicht herauslösen und in einen anderen Kontext setzen kann, ohne sie diesem – metatheoretisch – vermittelt zu haben. Schließlich sollten Konzepte »sparsam« genug formuliert sein, sie sollen unter Zuhilfenahme möglichst weniger und möglichst einfach formulierter weiterer konzeptueller Annahmen gebildet werden und die Erfahrung begreiflich machen.
Das Spezifische der psychoanalytischen Konzepte liegt – neben dem Hinweis darauf, dass sie einer philosophischen Theorie näherstehen als einer psychologischen – darin, dass ihr Schritt in die Verallgemeinerung (den jedes Konzept geht) nicht in die Vorhersagbarkeit führt (wie im physikalischen Experiment, das ja letztlich Aussagen darüber möglich machen soll, was gesetzesmäßig in allen ausreichend ähnlichen Fällen auch zukünftig geschehen wird), sondern in der Konzeptbildung selbst liegt. Die Konzepte dienen nicht der Prognose, sondern sie sollen Erfahrung zugänglich machen. Anknüpfend an Zepf (2006b, S. 263) kann man sagen, dass psychoanalytische Konzepte nicht etwas darüber sagen sollen, wie Subjekte allgemein sind (wie etwa die Hirnforschung oft Aussagen über das »durchschnittliche Gehirn« machen möchte), sondern allgemein etwas darüber, wie Subjekte im Besonderen sind. Sie sollen den verstehenden und begreifenden Zugang zum Einzelfall (einschließlich des Einzelfalls einer analytischen Beziehung oder eines Prozesses) eröffnen.
Psychoanalytische Konzepte nehmen ihren Ausgang von der »Empirie« der klinischen Phänomene, das lässt sich bei Freud im Hinblick auf die unbewusste Fantasie oder die Übertragung zeigen, aber auch im Zuge der Weiterentwicklung psychoanalytischer Konzepte. Die enge Anbindung an den klinischen Einzelfall ist nicht nur ein Merkmal der historischen Konzeptbildung (derart, dass man zu Beginn der Psychoanalyse eben noch nicht so viel Konzeptuelles zur Verfügung hatte), sondern durchzieht psychoanalytisches Denken bis heute (der Einzelfall dient der Erweiterung oder Modifikation der Konzepte). Damit soll keineswegs gesagt sein, dass die Psychoanalyse einer quantitativen, messenden, naturwissenschaftlichen Zugangsweise verschlossen bleiben muss. Aber eine solche würde immer schon ein interdisziplinäres Unterfangen bedeuten. Auch psychoanalytische Konzepte können und sollten operationalisiert werden, es bedeutet aber deren Erweiterung in methodischer Hinsicht, bei der es in Kauf genommen werden muss, dass eine Zuspitzung ihres Gegenstands erfolgt.
Vor dem Hintergrund eines solchen Konzeptverständnisses ist es im Rahmen der vorliegenden Buchreihe zunächst um das Triebkonzept gegangen (Storck, 2018a). Dabei habe ich eine Lesart des Konzepts vorgeschlagen, die es entlang von Bemerkungen Freuds dazu, dass es sich beim Trieb um einen Grenzbegriff zwischen Soma und Psyche handele (Freud, 1915c, S. 214), erlaubt, von »Trieb« als der konzeptuellen Beschreibung einer Vermittlungsfunktion zu sprechen, die physiologische Erregung in psychisches Erleben vermittelt. In dieser Hinsicht ist es ein psychosomatisches, leibliches Konzept, ebenfalls mit Freud gesprochen bezieht es sich darauf, dass körperliche Vorgänge dem Erleben ein »Maß an Arbeitsaufforderung« (Freud, 1915c, S. 214) auferlegen – anders gesagt: »Trieb« beschreibt konzeptuell, weshalb wir konkret in die psychische Repräsentation hineingetrieben werden. So kann man von der psychoanalytischen Triebtheorie als einer Theorie der allgemeinen Motivation des Psychischen sprechen, in ihr ist gefasst, wie Psychisches als solches motiviert ist. Neben diesem »psychosomatischen« Kernaspekt ist das Triebkonzept auch ein sozialisatorisches, insofern diejenigen Empfindungen, die, konzeptuell gesprochen, das Triebgeschehen in Gang setzen, sich zwischen Selbst und anderem, auf einer »zwischenleiblichen« (Merleau-Ponty, 1964) Ebene zeigen. »Triebhafte« Erregung wird angesichts des anderen in der körperbezogenen Interaktion hervorgerufen.
Während sich die Triebtheorie also als eine Theorie der allgemeinen Motivation des Psychischen begreifen lässt, findet sich die psychoanalytische Theorie der speziellen Motivation in der Konzeption des (unbewussten) Konflikts (Storck, 2018b). Dazu ist als Hintergrund das psychoanalytische, erweiterte Verständnis von Sexualität heranzuziehen, in welchem damit das Erleben von Lust (und Unlust) im Kontext körperlicher Berührungen/Empfindungen verstanden wird. In dieser Betrachtung spricht die Psychoanalyse von einer »infantilen« Psychosexualität und dann wird plausibel, in welcher Weise von Lust und Unlust als wichtigen Elementen der psychischen Entwicklung gesprochen wird. So lassen sich im Hinblick auf die psychoanalytische Theorie der psychosexuellen Entwicklung eine »körpernahe« und eine »thematische« Lesart des Oralen, Analen oder Phallisch-Ödipalen formulieren. Die Phasen gründen in den, natürlich auch körperlich mitbestimmten, Entwicklungsaufgaben und altersspezifischen Interaktionen (Nahrungsaufnahme, Sauberkeitserziehung, Auseinandersetzung mit Geschlecht und Geschlechtsunterschieden), im weiteren Verlauf treten stärker »Themen« in den Mittelpunkt, so die Versorgung (Oralität), Kontrolle (Analität) oder das Wirkvermögen (Phallizität). Auch in heutiger Betrachtung kann von ödipalen Konflikten als einem leitenden Strukturierungsprinzip des Psychischen ausgegangen werden, wenn man darunter die Auseinandersetzung mit Generationen- und Geschlechtsunterschieden sowie mit der unausweichlichen Möglichkeit versteht, aus Beziehungen passager und relativ ausgeschlossen sein zu können. Anders gesagt: Ödipale Konflikte drehen sich darum, dass diejenigen, zu denen man in Beziehung steht, prinzipiell auch zueinander in Beziehung stehen, d. h. eine eigenständige Beziehung zueinander haben. So findet man in der Welt ein Geflecht von Beziehungen statt nur diejenigen, die vom Selbst als einzigem Planeten im Universum »wegstrahlen«. Das bringt eine spezifische Dynamik aus Begrenzung und Öffnung mit sich: Das Anerkennen der Möglichkeit von Begrenzung (psychoanalytisch oft beschrieben als Anerkennung der symbolischen Kastration, also dem »Beschnittensein« in der eigenen »Potenz«) ermöglicht es, in der Welt Beziehungen zu finden bzw. sich zu Beziehungen in Beziehung zu setzen. Psychoanalytisch tritt hier das Konzept der Triangulierung auf den Plan, ebenso wie Konzeptionen der Symbolisierung, verbunden mit psychischen Vermögen der Differenzierung, Integration und Regulierung.
Читать дальше