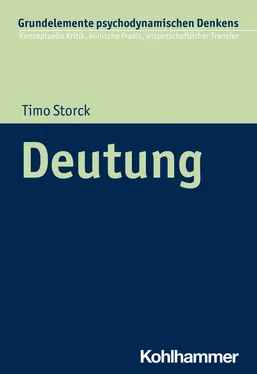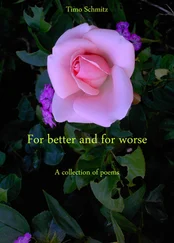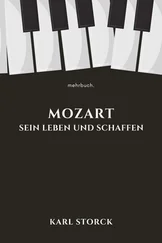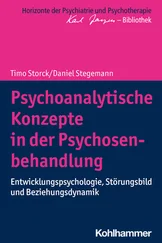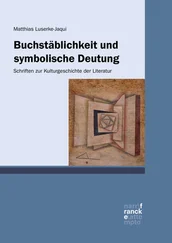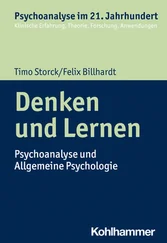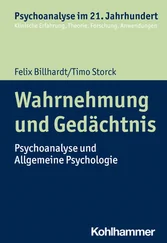Das Konfliktverständnis in der Psychoanalyse betrifft die Auseinandersetzung mit widerstreitenden Motiven bzw. zwischen Wunsch und Abwehr. Konflikte (sexueller, narzisstischer, aggressiver Färbungen) selbst sind dabei kein Anzeichen von Pathologie, das ist erst dann der Fall, wenn die Bewältigungsformen dysfunktional sind, d. h. das Erleben und/oder Handeln einschränken. Beispiele für die grundlegende menschliche Konflikthaftigkeit wären das Ineinander von Beruhigung und Stimulierung in der frühen Versorgung (zum Beispiel im Stillvorgang) oder die zu erarbeitende Ambivalenztoleranz für Liebe und Hass bzw. Verbindendes und Trennendes in derselben Beziehung.
Entscheidend für die Konzeption des Konflikts in der Psychoanalyse ist dessen Unbewusstheit. Das psychoanalytische Konzept des Unbewussten (Storck, 2019a) gehört zu den zentralen Aspekten dessen, was Freud seine Metapsychologie nennt, gleichsam eine »Psychologie mit Unbewusstem« (also eine Konzeption, in der etwas psychisch, nicht naturhaft unbewusst sein kann). Das spezifisch psychoanalytische Unbewusste ist nicht bloß in einem deskriptiven Sinn nicht bewusst, sondern in einem dynamischen, das heißt, es gibt konfliktbedingte Gründe dafür, dass etwas funktional vom Bewusstsein ferngehalten wird, nämlich damit verbundene unlustvolle Empfindungen (Angst, Scham, Schuldgefühle). Da es sich dabei allerdings um etwas handelt, das zugleich auch mit lustvollen Empfindungen verbunden ist, gibt es ein Zusammenwirken von »drängenden« und verdrängenden Kräften. Das Unbewusste ist dabei nicht in einem örtlichen oder anderweitig reifizierenden Sinn zu verstehen, es befindet sich nicht irgendwo anders, sondern weist den Charakter einer Veränderung des Bewussten auf, eine Auslassung, Überdeterminierung, Unterbrechung oder Hemmung. Unbewusstes zeigt sich »am« Bewussten; dabei wurde der Vorschlag gemacht, vom (dynamisch) Unbewussten als etwas auszugehen, das sich im Verhältnis der Vorstellungen und Affekte zueinander zeigt. Konflikte werden von Freud in seiner sogenannten ersten Topik als solche zwischen psychischen Systemen (Bewusst, Vorbewusst, Unbewusst) beschrieben und in der zweiten Topik als solche zwischen psychischen Instanzen (Ich, Es, Über-Ich). Zu beachten ist, dass auch in der Psychoanalyse verschiedene Auffassungen des Unbewussten bestehen bzw. sich der Begriff des Unbewussten auf verschiedene Formen (zum Beispiel auf implizite Aspekte der Beziehungsgestaltung und des Beziehungserlebens) bezieht.
Im Anschluss daran ist es um die psychoanalytische Auffassung zu Objektrepräsentanzen gegangen (Storck, 2019b). Das Konzept des Objekts als Bezeichnung der psychischen Repräsentation des Anderen erwächst terminologisch aus der Triebtheorie, in der das Trieb-Objekt als der Gegenstand psychischer Besetzung verstanden wird. »Objekt« ist also mitnichten etwas Objektives oder Objekthaftes im physikalischen Sinn, sondern Vorstellungsobjekt, erwachsen aus Beziehungserfahrungen. Als grundlegendes Modell kann genommen werden, dass sich Interaktionen mit anderen psychisch in Beziehungsvorstellungen (Selbst und Objekt, verbunden über einen Affekt) niedergeschlagen und dass diese Beziehungsvorstellungen weitere Interaktionen und deren Erleben färben. Aus Beziehungsvorstellungen werden sukzessive Vorstellungen vom Selbst sowie dem personalen Anderen herausgelöst, also Selbst- bzw. Objektrepräsentanzen. Damit ist psychoanalytisch die Fähigkeit zur Symbolisierung berührt, also basal die Möglichkeit, die Welt der Wahrnehmungen durch die Welt der Vorstellungen anreichern zu können, das heißt vor allem: sich Abwesendes vorstellen zu können. Erst dann gibt es eine Objektrepräsentanz im eigentlichen Sinn beziehungsweise wird es möglich, sich das eigene Erleben reflexiv vor Augen zu führen und nicht zuletzt Erinnerung, Erwartung, Fantasie etc. Dabei spielen auch Fragen nach der »Ganzheit« bzw. Integration der Selbst- und Objektrepräsentanzen eine Rolle. In vielen psychoanalytischen Ansätzen gibt es Konzeptionen fragmentierter Objektvorstellungen, das heißt einer Teilung beziehungsweise Spaltung zwischen den als »gut« und den als »schlecht« empfundenen Anteilen, die zum Beispiel als Schutz des Guten vor dem Schlechten getrennt gehalten werden. Daraus erwächst die Entwicklungsaufgabe einer Integration, die differenzierte Bilder vom Selbst und vom Anderen möglich macht. Hier taucht die Idee repräsentationaler statt allein motivationaler Konflikte auf: Teil-Selbst- oder Teil-Objektvorstellungen können mit anderen in Konflikt stehen.
Beziehungsvorstellungen können als »Bausteine« des Psychischen gelten. Aus dem Gedanken, dass das Resultat der Internalisierungen von Interaktion (samt der Anreicherung durch Fantasien) in Form von Beziehungsvorstellungen das weitere Erleben von anderen Interaktionen färbt und leitet, erwächst das psychoanalytische Konzept der Übertragung (Storck, 2020). Im Freud’schen Denken lassen sich zwei konzeptuelle Fassungen der Übertragung unterscheiden: zum einen eine erste, etwas frühere, in der damit gemeint ist, dass die »Besetzungsintensität« einer Vorstellung auf eine andere übertragen wird. Dadurch wird etwas in entstellter Form bewusst, die Übertragung schafft so Bewusstsein, wenn auch um den Preis einer Entstellung. Zum anderen wird wenig später »Übertragung« konkreter beziehungshaft verstanden, also als Ersetzen einer Objektvorstellung durch eine andere, an die sich Affekte und Fantasien heften. Besonders in dieser zweiten Form wird die Übertragung in behandlungstechnischer Hinsicht gebraucht, nämlich derart, dass sich angesichts dessen, wie die Analytikerin 1 1 Im vorliegenden Band wechsle ich kapitelweise zwischen einer sprachlichen Verwendung des generischen Femininums und des generischen Maskulinums. Soweit nicht konkrete Personen gemeint sind, sind damit jeweils alle anderen Geschlechter mit gemeint.
erlebt wird, Aspekte der internalisierten Objektbeziehungen, besonders aus der Kindheit, zeigen. Aber auch in der ersten, früheren Form ist das Konzept der Übertragung relevant, denn sie erlaubt ein Nachdenken darüber, wie das Bereitstellen der analytischen Beziehung eine Form des Erlebbaren schafft. Das Angebot einer Übertragung bietet zuvor unbewussten Erlebnisaspekten eine Art Bühne oder Kostümierung.
Die Vertiefung von Übertragungsprozessen ist ein Ziel analytischer Behandlungen und dadurch begründen sich auch bestimmte Elemente des Behandlungssettings, das dann nämlich der Regressionsförderung dienen soll, also der »Rückkehr« zu stärker affektgeleiteten, »unvernünftigen« Erlebnisweisen. Es ist davon die Rede, das Herstellen einer »Übertragungsneurose« zu fördern, das meint eine Zentrierung der (neurotischen) Symptome auf die analytische Beziehung, damit sie dort sichtbar, verstehbar und veränderbar werden. Das ist nicht nur für neurotische Symptome der Fall, sondern auch Symptome anderer psychischer Störungen zeigen sich im Erleben und Gestalten von Beziehung und können zum Gegenstand analytischen Arbeitens genommen werden. Veränderung, so die Annahme, beruht in unterschiedlichen (Teil-)Modellen darauf, dass im Rahmen einer emotional bedeutsamen und »korrigierenden« Beziehungserfahrung Einsicht in (unbewusste) Bedeutungen genommen bzw. eine Form für das eigene Erleben gefunden wird. Dabei stellt sich die Frage, wie auf »valide« Weise interveniert wird, so dass dies möglich wird. Die Psychoanalyse folgt methodisch dem szenischen Verstehen, also dem Verstehen derjenigen Szenen, die sich zwischen Analytikerin und Analysandin zeigen – und dies im Hinblick auf ein wiederkehrendes Gerüst oder Muster des Erlebens und Gestaltens von Beziehungen. Diese können dann deutend zugänglich gemacht werden – wie genau, wird im Weiteren diskutiert werden.
In einem weiteren Schritt ist es um die Bedeutung von Abwehr und Widerstand gegangen (Storck, 2021a). Die psychoanalytische Konflikttheorie steht mit dem Gedanken in Verbindung, dass eine psychische Abwehr dann einsetzt, wenn eine (bewusste) Vorstellung mehr Unlust als Lust nach sich ziehen würde. Sie dient also der Vermeidung unlustvoller Empfindungen und muss dazu ihrerseits unbewusst wirken. Im Rahmen der Freud’schen Werkentwicklung seiner Vorstellungen vom psychischen Apparat ist das ein besonderer Punkt, denn er führt ihn dazu, von unbewussten Anteilen der Ich-Instanz (die prinzipiell dem Realitätsprinzip folgt) auszugehen, also einerseits funktionalen und in irgendeiner Art gerichteten Prozessen (die etwas abwehren sollen), die andererseits aber unbewusst ablaufen, andernfalls wäre ja auch ihr Gegenstand dem bewussten Erleben zugänglich. Deshalb nimmt Freud an, dass ein Teil des Ichs unbewusst ist und konzipiert präziser als zuvor eine internalisierte Instanz von Gewissen, Moral, Geboten und Verboten: das Über-Ich.
Читать дальше