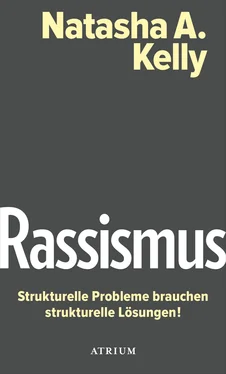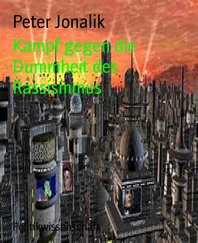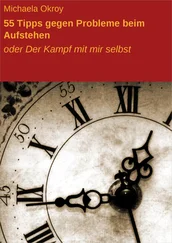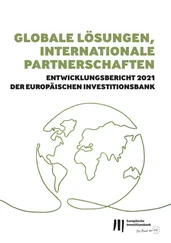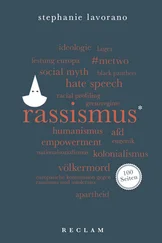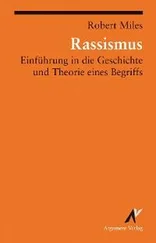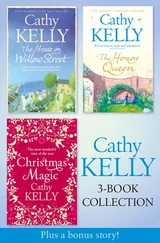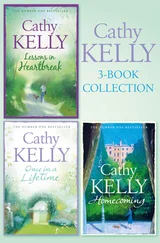Aber welche »würdigen Formen des Erinnerns« an europäische Kolonialgeschichte gibt es? Einige Kunsthistoriker:innen halten es für den falschen Weg, Denkmäler zu zerstören. Sie sagen, es sei besser, sich durch Gegendenkmäler kritisch mit Geschichte auseinanderzusetzen. Allerdings kommen solche Vorschläge erst, wenn radikale Interventionen erfolgt sind. Weniger radikale Einsprüche und Forderungen werden meist nicht gehört. So demonstriert etwa das Komitee für ein afrikanisches Denkmal in Berlin (KADIB) bereits seit 2007 für eine Gedenkstätte, die an die Schwarzen Opfer des Kolonialismus, des Nationalsozialismus und der rassistischen Gewalt der Nachkriegszeit erinnern soll. Jedes Jahr findet im Februar ein vom Komitee organisierter Gedenkmarsch statt, der sich zeitlich auf das Ende der Berliner Kongokonferenz von 1884/85 bezieht. Ins Leben gerufen wurde die Initiative laut Pressemitteilung, »um der Forderung nach Anerkennung der Verbrechen gegen afrikanische/Schwarze Menschen Nachdruck zu verleihen und um ihren Widerstand zu würdigen«. Aus demselben Grund hatten die Vereinten Nationen die internationale Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft[13] unter dem Motto »Anerkennung, Gerechtigkeit, Entwicklung« ausgerufen (2015–2024), heißt es weiter. Aber statt diese Forderung anzuerkennen, schließe die Bundesregierung neo-koloniale Freihandelsabkommen, schaffe Abhängigkeiten von europäischer Entwicklungshilfe, exportiere Waffen und externalisiere seine Grenzlinien, während Afrikaner:innen im Mittelmeer durch unterlassene Hilfeleistungen der EU ertrinken.[14]
Das KADIB kritisiert in seinem Schreiben auch das 2019 von der Bundesregierung eröffnete Humboldt Forum im Berliner Schloss. Zwar bezieht sich die Einrichtung des Forums auf Artikel 5, Absatz 3 des Grundgesetzes, in dem die Freiheit von Kunst und Wissenschaft garantiert wird. Auch wird der Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und jede Form von gewaltbereitem religiösem Fundamentalismus ins Zentrum ihrer Initiative gerückt.[15] Allerdings wird bei der Umsetzung des Projekts die Tragweite des deutschen Kolonialismus unterschätzt. So versäumen die Verantwortlichen, die Herkunft vieler historischer Objekte zu klären, die mit großer Wahrscheinlichkeit während der zahlreichen Kolonialkriege geraubt wurden. Im Zuge dessen fehle auch die Auseinandersetzung mit den Herkunftsgesellschaften der Objekte, konstatiert der Historiker Christian Kopp vom Aktionsbündnis No Humboldt 21 gegenüber der Deutschen Welle (DW).[16]
Es ist unangenehm, sich mit der eigenen Rolle im Kolonialismus auseinanderzusetzen. Einfacher ist es natürlich, Kolonialismus als Problem der anderen zu werten. Frankreich oder England seien schlimmer gewesen, heißt es, und außerdem sei der deutsche Kolonialismus nur sehr kurz gewesen.[17] In deutschen Schulbüchern wird Kolonialismus nur am Rande thematisiert. Mehr noch: In Unterrichtswerken der 1980er Jahre – und zwar in der DDR wie in der BRD – kam der deutsche Kolonialismus viel ausführlicher zur Sprache als heute.[18] Dabei kann Kolonialismus nicht von der Gründungsgeschichte Deutschlands getrennt werden – ebenso wenig wie die Geschichte des Rassismus. Welche Geschichte und Geschichten werden unseren Kindern heute bloß erzählt?
Genau genommen wäre die Gründung der ersten deutschen Nation ohne Rassismus gar nicht möglich gewesen. Denn im Glauben, es gebe »deutsches Blut«, wurden Rasse und Nation aufs Engste miteinander verstrickt.[19] In der Folge werden Deutsche noch heute als weiß , blond und blauäugig imaginiert. Diese Vorstellung fand ihren tödlichen Tiefpunkt bekanntermaßen im Nationalsozialismus. Doch es wäre falsch, zu glauben, dass der deutsche Rassismus im Nationalsozialismus begonnen habe und ausschließlich in der rechten Ecke zu finden sei. Und daher ist es auch falsch, Rassismus mit Rechtsextremismus gleichzusetzen.
Rassistische Ideen gibt es im Laufe der Geschichte immer wieder. Ende des 15. Jahrhunderts entwickelt sich in Spanien eine zu Anfang religiös begründete Idee von »Rassen«, die sich von dort aus in Europa ausbreitete. Im 18. Jahrhundert wird der Rassismus in Europa dann zu einer Wissenschaft verklärt. Daran war neben Disziplinen wie der Anthropologie, der Eugenik und den Sexualwissenschaften auch die europäische Philosophie maßgeblich beteiligt. Der deutsche Anthropologe Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840) und der deutsche Philosoph Christoph Meiners (1747–1810) führten die rassistische Hierarchisierung ein. Der Rassebegriff fand in Deutschland insbesondere durch Immanuel Kant (1724–1804) Verbreitung und regt noch heute hitzige politische Diskussionen an, wie später aufgezeigt wird. Kant hatte wesentlichen Anteil daran, dass die Idee von »Rasse« als biologische Kategorie hierzulande Verbreitung fand. Durch sein Rassedenken und seine darauf aufbauende Rassenlehre wurde Rassismus überhaupt erst materialisiert, d.h., die Kategorie »Rasse« wurde in seinen Vorlesungen (1790–1791) zu einem greifbaren Konzept, auf dessen Grundlage Schwarze Menschen herabgewürdigt und diskriminiert werden konnten.[20] Kants rassifizierenden Ideen bildeten auch die Grundlage dafür, dass spätere Philosophen wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) die Vorstellung verbreiten konnten, Schwarze Menschen seien keine geschichtlichen Wesen, was er als Beweis für ihre vermeintliche Unterlegenheit anführte.[21] Bis heute wirkt »Rasse« als strukturierendes und ordnendes Merkmal auf die Gesellschaft zurück und hat dadurch eine soziale Funktion, die jenseits von biologischen Kategorien wirkt.
Während Immanuel Kant allen bekannt sein dürfte, muss der Schwarze Aufklärer Anton Wilhelm Amo (ca. 1703–1753) wieder ins kollektive Gedächtnis gerufen werden. Der Philosoph und Jurist promovierte 1729 an der Universität Halle-Wittenberg zu den Rechten der Schwarzen (damals mit dem M-Wort fremdbezeichnet) in Europa.[22] Seine Arbeit verweist bereits auf die Wichtigkeit von Recht und Justiz in allen Epochen Schwarzer deutscher Geschichte, wie auch später noch deutlich wird. Nach dreißig Jahren aktivistischer Forderung wird nun zu Recht als richtige Antwort auf die BLM-Bewegung endlich die M-Straße in Berlin-Mitte nach Amo umbenannt. Schon fünfzig Jahre vor Kant hatte er die Menschenrechte diskutiert und Schwarze Menschen dabei einbezogen. Ob Kant hingegen tatsächlich alle Menschen meinte, als er in seinen Schriften von allen Personen sprach, oder doch nur den (inzwischen sehr alt gewordenen) » weißen Mann«, bleibt fraglich. Dass er wohl eher Letzteren meinte, zeigt folgendes Zitat:
»Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben I* haben schon ein geringeres Talent. Die N* sind weit tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. […] Die N* von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege.«[23]
Wir leben immer noch in der Verfestigung von Kants Rassenlehre, obwohl er selbst in seinem Spätwerk Zweifel an seiner eigenen Theorie hegte. Vom Sockel wurde Kant zwar nicht gestoßen, aber seine kritischen Schriften werden mit Blick auf den antirassistischen Protesten aufs Neue diskutiert – ein kleiner, aber wichtiger Fortschritt. Denn auch wenn Kant sich in seiner Altersschrift für die Gleichberechtigung aller Rassen aussprach und Kolonialismus und Versklavung verurteilte,[24] ist das Rassedenken, was die Grundlage seiner Rassenlehre war und zur Herausbildung der biologischen Kategorie Rasse geführt sowie Kolonialismus und Versklavung gerechtfertigt hat, nicht verschwunden. Noch heute sind die Nachwirkungen des Kolonialismus und somit auch des Rassedenkens der europäischen Aufklärung sowohl auf dem afrikanischen Kontinent als auch hierzulande in Form von Alltagsrassismus spürbar. Dieser reicht von Ablehnungen bei der Wohnungssuche über verweigerte Beförderungen im Beruf bis hin zu einfachen Fragen, die Schwarzen Menschen das Deutschsein absprechen, wie »Woher kommst du?« oder Aussagen wie »Du sprichst aber gut Deutsch«.[25]
Читать дальше