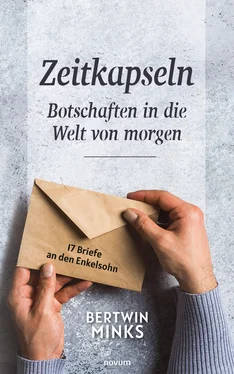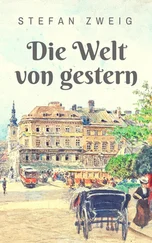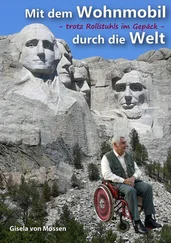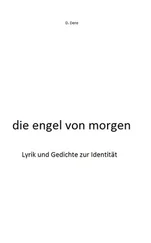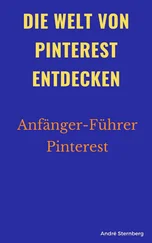3.3 Biobrennstoffe
Als Verstromungsmethode spielen die aus Biomasse gewonnenen Biobrennstoffe (überwiegend Methan) weltweit noch eine untergeordnete Rolle. Soweit es sich um die Verwendung tierischer Abfälle als Reststoffverwertung handelt, ist diese Form der Energieerzeugung nicht zu beanstanden. Sie dürfte, wirtschaftlich betrachtet, ohnehin nur lokal in landwirtschaftsnahen Bereichen von Interesse sein. Sobald man jedoch beginnt, Nahrungsmittel (hier vor allem „Energiemais“) gezielt für eine energetische Nutzung anzubauen, gerät das Konzept in den Fokus öffentlicher Kritik. Solange der Hunger auf der Welt nicht besiegt ist, scheint die Verstromung von Pflanzen, die der Nahrungsversorgung dienen, ein fragwürdiges Unterfangen zu sein. Doch abgesehen davon ist die Verstromung von Energiemais und anderen Getreidepflanzen aus naturgesetzlichen Gründen (geringe Leistungsdichte) und wegen des riesigen Flächenverbrauchs unsinnig. Würde man beispielsweise den gesamten Inlandsstrom Deutschlands ausschließlich durch Energiemais erzeugen wollen, wäre dafür eine Anbaufläche – man höre und staune – von der Größe der Bundesrepublik erforderlich.
4. Technischer Fortschritt und Umweltschutz
Physikalische Überlegungen zeigen, dass technischer Fortschritt bei gleichzeitigem Umweltschutz nur mit größeren Leistungsdichten in der Stromerzeugung, der industriellen Produktion und dem Verkehr zu erreichen ist. Die benötigte Energie für eine wachsende Bevölkerung bei gleichzeitig zunehmendem Lebensstandard kann wirtschaftlich nur mit Energiegewinnungs-Methoden hergestellt werden, die hohe Leistungsdichten gewährleisten. Die sogenannten „erneuerbaren“ Energien scheinen deshalb zur alleinigen Deckung des Energiebedarfs moderner Industriestaaten ungeeignet zu sein.
Was die Energieerzeugung anbelangt, stellen die in den Medien oft bemühten Gesichtspunkte „sanft“ und „erneuerbar“ im Hinblick auf den Umweltschutz die Fakten auf den Kopf. Es verhält sich genau umgekehrt. Je sanfter, weniger intensiv und damit großflächiger eine Methode zur Erzeugung von elektrischer Energie erscheint, desto kostspieliger und durch den hohen Flächenverbrauch umweltschädlicher ist meistens ihre Anwendung.
5. Der Erntefaktor ERoEI (Energy Returned on Energy Invested)
Dieser Faktor erlaubt es, die Energieeffizienz unterschiedlicher Methoden der Stromerzeugung zu quantifizieren. Er ist, vereinfacht ausgedrückt, das Verhältnis der während der gesamten Lebenszeit einer angewendeten Methode zur Stromerzeugung erzeugten elektrischen Energie zu derjenigen Energie, die für die Ingangsetzung und den Betrieb des Verfahrens aufgewendet werden muss. Der ERoEI ist ein Energiemultiplikator. Bei einem Wert von ≥ 1 investiert man eine KWh und erhält ein Vielfaches davon zurück. Daneben ist die Forderung ERoEI ≥ 7 zu beachten. Unterhalb dieses Wertes gilt eine Methode zur Energiegewinnung volkswirtschaftlich als nicht mehr sinnvoll (siehe nachfolgende Übersicht):
Erntefaktoren ERoEI für verschiedene Verfahren der Stromerzeugung:
Sonnenenergie 1,6
Biobrennstoffe 3,5
Windenergie 3,9
--------------------------------------------
Wirtschaftlichkeitsgrenze (Faktor 7)
--------------------------------------------
Gas 26
Kohle 30
Wasser 35
Kernkraft 75
Nach dem Erntefaktor-Ansatz ergeben Gas, Kohle und Wasserkraft Erntefaktoren von 26 bis 35, Kernkraft erreicht dagegen sogar einen Wert von 75. Allerdings existieren verschiedene Berechnungsmethoden, die auch die Entsorgung berücksichtigen. Unbestritten ist jedoch, dass Sonnenenergie, Biobrennstoffe und Windkraft unter der Wirtschaftlichkeitsgrenze von Faktor 7 bleiben. Damit haben die sogenannten erneuerbaren Energien auch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit keine Vorteile gegenüber den konventionellen Energieträgern.
6. Nutzung eines wetterabhängigen Fluktuationsstroms – Probleme und Konsequenzen
Die Wetterabhängigkeit von Sonnen- und Windenergie stellt einen bedeutenden Nachteil für ihre Nutzung dar. Diese Energiearten tragen damit praktisch nicht zur Versorgungssicherheit mit elektrischem Strom bei und erfordern nach dem heutigen Stand der Technik zu 100 % planbare Backup-Systeme. Wie untauglich das Konzept für sich genommen ist, zeigt sich beispielsweise an einem grauen dunklen und dazu noch windstillen Novembertag. Dann können die sogenannten erneuerbaren Energien nur noch etwa 3 % des in Deutschland benötigten Strombedarfs liefern. Insofern erweist sich die Pufferung des fluktuierenden Zufallsstromes als ein gravierendes Problem. Pumpspeicherwerke wie beispielsweise in Norwegen werden als Alternative zu Backup-Kraftwerken mit fossilen Brennstoffen hierzulande wohl eher die Ausnahme bleiben. Deshalb dürfte die wirtschaftliche Speicherung von Fluktuationsstrom eine große technologische Herausforderung bei der Nutzung „erneuerbarer“ Energien darstellen.
Ein weiteres Einspeisungsproblem stellt die Stabilität der Soll-Netzfrequenz von 50 Hz dar. Bei Kohle-, Gas-, Öl- oder Kernkraftwerken mit ihrem stetigen und stabilen Grundlaststrom war dieses Problem gänzlich unbekannt.
Fotovoltaik
Die geringe Leistungsausbeute dieser Energieform ist mit den Schwankungen des solaren Strahlungsflusses und den geringen Wirkungsgraden von Solarzellen hinreichend erklärt. Darüber hinaus gibt zu denken, dass sich auch in Ländern mit einer weitaus höheren Sonneneinstrahlung als in Deutschland eine flächendeckende Anwendung von Fotovoltaik- oder Sonnenspiegelanlagen bisher praktisch nicht durchgesetzt hat. Dieses Erscheinungsbild betrifft afrikanische Länder, aber auch die Südstaaten der USA und sogar Australien. In Ländern mit einer großen Insolation scheinen allenfalls lokale Lösungen für eine Nutzung der Sonnenenergie wirtschaftlich interessant zu sein. Für Großanlagen kann, was die Wirtschaftlichkeit anbelangt, die höhere Sonnenausbeute den Nachteil des kleinsten Erntefaktors offenbar nicht wettmachen.
Windkraft
Neben der Fluktuation des Windes ist bei Windturbinen auch die Kennlinie der Windmaschinen zu beachten. Für Strömungsmaschinen gilt das v3-Gesetz. Eine Verdopplung der Windgeschwindigkeit führt daher zu einer Verachtfachung der Stromleistung, eine Halbierung bewirkt dagegen eine Verringerung der Ausbeute auf ein Achtel. Im Binnenland sind häufige Windgeschwindigkeiten bis zu 6 m/s für eine effiziente Ausbeute viel zu gering. Im Offshore-Bereich liegen die Windgeschwindigkeiten zwar erheblich darüber, doch ab v=8 m/s muss wegen der zu hohen mechanischen Belastungen begonnen werden, die Windradleistung zu drosseln. Ab 13 m/s ist aus denselben Gründen eine Begrenzung der Maximalleistung auf die Nennleistung erforderlich. Aufgrund der mechanischen Instabilität der Windturbinen ist daher die Windenergie bei hohen Windgeschwindigkeiten nur eingeschränkt nutzbar.
Sicherheitsgrenzen
Dem weiteren Ausbau der Nutzung „erneuerbarer“ Energien werden auch durch die Garantie der Netzstabilität Grenzen gesetzt. Der verbleibende Anteil von Grundlastkraftwerken hängt wesentlich von der Netzstruktur und den Akzeptanzgrenzen eines noch tolerierbaren Black-out-Risikos ab. Expertenkreise schätzen ein, dass in der Bundesrepublik eine Grundkraftwerk-Mindestleistung von 20 GW nicht unterschritten werden sollte. Die totale Abschaltung der noch betriebenen Kernkraftwerke und der beschlossene Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger für die Strom- und Wärmeerzeugung könnte jedoch die Energieversorgung in Deutschland gefährden. Daher sollten die naturgesetzlichen und technologischen Schranken sowie die wirtschaftlichen Grenzen eines weiteren Ausbaus der sogenannten erneuerbaren Energien von den Entscheidungsträgern nicht länger ignoriert werden.
7. Wie erneuerbar sind die „erneuerbaren“ Energien?
Der Begriff „erneuerbare“ Energie scheint eine unglückliche Wortschöpfung zu sein. Unter dem Vorgang der Erneuerung werden gemeinhin die Aufbereitung und Instandsetzung eines verschlissenen oder verbrauchten Produktes oder Objektes verstanden. Was aber bedeutet diese Vorstellung für die Erneuerung der Energie?
Читать дальше