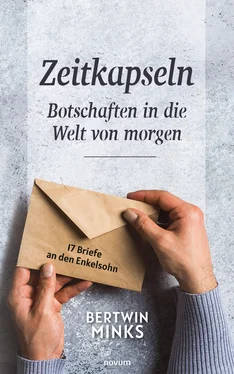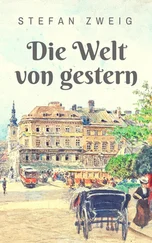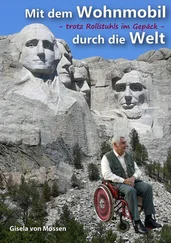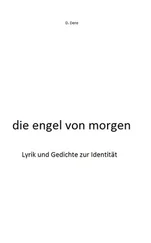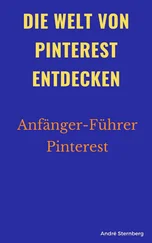Wenn man die Diskussion in den Medien aufmerksam verfolgt oder im Internet dazu recherchiert, dann führt an diesem Energiekonzept bei energiepolitischen Betrachtungen heutzutage (2019) kaum mehr ein Weg vorbei. Politik und Medien versuchen, den Leuten zu vermitteln, dass dieser energiepolitische Ansatz als ein energiewirtschaftlicher „Königsweg“ alternativlos sei. Es heißt, dass bei dessen konsequenter Umsetzung es sogar gelingen könnte, die Eintracht von Menschen und Natur wiederherzustellen. Doch sind diese Vorstellungen bloße energieromantische Schwärmereien oder wirklich so folgerichtig, zwangsläufig und scheinbar unabwendbar?
Matti, ich gestehe dir unumwunden, dass ich an der angeblich so alternativlosen Energiewende grundlegende Zweifel habe. Das Nachdenkblatt soll dich auf einige Schwachstellen und Ungereimtheiten an dem von der Politik und den Medien propagierten energiepolitischen Konzept aufmerksam machen.
Versteh’ mich bitte nicht falsch, Sonne und Wind können trotz der in der Anlage zu diesem Brief skizzierten technologischen Unzulänglichkeiten und naturgesetzlichen Schranken regional durchaus einen sinnvollen Beitrag zur Versorgung von Haushalten oder auch Gewerbebetrieben mit elektrischer Energie leisten. Was mich an dem Konzept der angeblich alternativlosen Energiewende stört, ist der ideologisch daherkommende und vehement propagierte Ausschließlichkeitsanspruch der sogenannten „erneuerbaren“ Energien. Die Initiatoren und Befürworter der als „Energiewende“ deklarierten energiepolitischen Vorstellungen versuchen, den Leuten weiszumachen, dass man den Energiebedarf eines hoch industrialisierten Landes wie Deutschland mit Windturbinen, fotovoltaischen Anlagen und vielleicht noch Biobrennstoffen problemlos decken kann. Ein so einseitig ausgerichtetes energiepolitisches Konzept, das unser Land vor allem zu einem großflächigen Windpark umgestalten möchte, kann aufgrund naturgesetzlicher Schranken nicht nachhaltig funktionieren.
Für mich hört der erneuerbare Spaß auf, wenn Windturbinen bedrohlich nahe an Siedlungen errichtet, Abstandsregeln aufgrund des enormen Flächenverbrauchs immer mehr aufgeweicht und gesundheitliche Bedenken verharmlost werden. Darüber hinaus sind Windräder, die inmitten von Wäldern entstehen sollen, wegen der Beeinträchtigung, Störung und Beunruhigung örtlicher Biotope ökologisch als bedenklich einzuschätzen und daher abzulehnen. Wo bleibt denn bei solchen energiewirtschaftlichen Praktiken der Aufschrei des vermeintlich grün angestrichenen Zeitgeistes?
Die Schlüsselfrage in der Diskussion um die künftige Energieversorgung ist nach meinem Dafürhalten die friedliche Nutzung der Kernenergie. Aus heutiger und mehr noch künftiger mitteleuropäischer Sicht wird sich der nationale Ausstieg aus der Kerntechnologie als ein Fehler herausstellen. Er ist als eine hektische und unbegründete Reaktion auf das Reaktorunglück im japanischen Fukushima erfolgt. Dort sind durch einen Tsunami Notstromaggregate ausgefallen, wodurch nicht redundant ausgelegte Pumpen versagt haben. Das gegen eine Tsunami-Einwirkung anfällige Konstruktions- und Betriebskonzept des nuklearen Kraftwerkes mag ein sträflicher technologischer Leichtsinn gewesen sein. Die lokale Havarie ist jedoch kein Grund, eine leistungsfähige Kraftwerkssparte zu ächten, die zudem Energie erzeugt, die das globale Klima nicht belastet.
In unserem Land gibt es weder Tsunamis noch nennenswerte Erdbeben. Außerdem schließen die modernen Kraftwerkstechnologien Havarien wie seinerzeit in Japan aus. Die populistische Entscheidung, national aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie auszusteigen, war eine unnötige Verbeugung vor dem Druck grüner Ideologiepropaganda. Sie ist nach meinem Dafürhalten eine politische Kurzschlussreaktion gewesen und hatte mit technologischer Vernunft und energiewirtschaftlichem Sachverstand nichts zu tun. Wahrscheinlich sollte sie den Regierenden Wählerstimmen sichern.
Von Kritikern wird oft übersehen, dass die Kernkrafttechnologie in den letzten Jahrzehnten erheblich vorangeschritten ist. Inzwischen gibt es Kernreaktoren der vierten Generation, die sehr effizient arbeiten. Aufgrund des geringen Mengeneinsatzes an nuklearem Brennstoff erweist sich die Lagerung von Spaltprodukten auf dem Betriebsgelände zunehmend als eine realistische Option. Dadurch können Gefahrguttransporte reduziert, ja vielleicht sogar überflüssig gemacht werden. Darüber hinaus lassen sich inzwischen mithilfe von Transmutationsverfahren die Halbwertszeiten der verbleibenden Nukleotide signifikant verringern. Damit ließe sich zukünftig möglicherweise auch die Endlagerproblematik relativieren.
Neben den modernen nuklearen Kraftwerktechnologien stellt das sogenannte small modular reactor (SMR)-Konzept eine technologisch pfiffige Variante der friedlichen Nutzung der Kernkraft dar. Die in den USA erfundene technologische Lösung besteht aus Mini-Atomkraftwerken in modularer Bauweise, die überall anwendergerecht in Wasserbecken aufgestellt werden können. Die Reaktoren benötigen keine Bedienperson, gelten aufgrund ihrer geringen Größe als „durchschmelzungssicher“ und sollen ohne Entsorgungsprobleme abgewrackt werden können. Diese bemerkenswerte kerntechnische Innovation erfreut sich weltweit zunehmender Beliebtheit. Da die SMR-Technologie auch mit „erneuerbaren“ Energiekonzepten effizient kombiniert werden kann, soll sie sogar schon den einen oder anderen engagierten Klimaaktivisten überzeugt haben. Wer weiß, vielleicht wird das SMR-Konzept in 16 Jahren längst zu einer globalen Erfolgsgeschichte geworden sein?
Dagegen stammen die Feindbilder der ideologisch politisch „grün“ aufgestellten Gegner der friedlichen Nutzung der Kernkrafttechnologie überwiegend aus den letzten drei Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts. Aus dieser Zeit resultiert vor allem die Altlasten- und Endlagerproblematik. Doch angesichts der Fortschritte in der aktuellen Entwicklung moderner Kernspaltungstechnologien mutet die Kritik an deren friedlicher Nutzung heute etwas museal an.
Allerdings dürften die Menschen das globale Energieproblem erst gelöst haben, wenn sie in der Lage sein werden, die Kernfusionstechnologie zu beherrschen. Warum sollte es nicht gelingen, die Prozesse, die die Sonne seit Jahrmilliarden in ihrem Innern betreibt, trotz immenser technologischer Herausforderungen auch auf der Erde zu realisieren? Dazu bedarf es natürlich einiger Visionen. Verbote, Vorbehalte, Gängelei und Ignoranz sind auf einem so anspruchsvollen Weg in die energetische Zukunft nicht hilfreich. Sie werden sich eines Tages ganz gewiss als ein energiepolitischer Fehler erweisen!
Zum Glück gibt es, was die friedliche Nutzung der Kernkraft anbetrifft, in anderen Ländern keine derartig ideologisch begründeten Denk- und Innovationsverbote. Die Vorstellung, dass die Menschen eines Tages die Kernfusion technologisch beherrschen könnten, erfüllt mich mit Zuversicht und Hoffnung. Denjenigen, die stets nur vor den unwägbaren Risiken der Kernenergie und vor Super-GAU-Szenarien warnen, ist entgegenzuhalten, dass nach der Logik einer solch’ pessimistischen Philosophie der Mensch niemals hätte ein Feuer anzünden dürfen!
Wenn es in unserem Land nicht gelingt, die öffentliche Meinung von der Konkurrenzlosigkeit der friedlichen Nutzung der Kernenergie mit dem Fernziel Kernfusion zu überzeugen, wird Deutschland irgendwann mit Windturbinen zugestellt sein. Spätestens dann werden die Menschen hierzulande erschrocken feststellen, dass sie eigentlich in einem großflächigen Windpark leben und sich energietechnologisch in einer Art Steinzeitalter befinden. Matti, ich bin aber optimistisch, dass schon deine Generation die für mich unverständliche und unbegründete Ächtung der friedlichen Nutzung der Kernenergie auf den Prüfstand der energiepolitischen Vernunft stellen wird. Meine Zuversicht resultiert aus der Tatsache, dass im globalen energiepolitischen Mainstream die Kerntechnologie als unverzichtbar angesehen wird. Warum also sollte nicht eine nationale politische Fehlentscheidung, die künftigen Generationen intelligente energietechnologische Innovationen verbieten will, korrigiert werden können? Wenn man die naturwissenschaftlichen Fakten kritisch würdigt, kommt man zwangsläufig zu der Ansicht, dass die Energiewende aus naturgesetzlichen Gründen nur ein Weg in eine energiewirtschaftliche Sackgasse sein kann. Die Politik wird irgendwann zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich auf die Dauer gegen naturgesetzliche Schranken keine vernünftige Politik gestalten lässt. Diese Erkenntnis mag heutzutage nicht für jedermann verständlich sein. Doch auf lange Sicht wird sie sich für die Gesellschaft als unvermeidlich erweisen. Dann dürfte die nationale Forschung auf dem Gebiet der Reaktortechnik jedoch längst den Anschluss an die internationale Entwicklung verloren haben.
Читать дальше