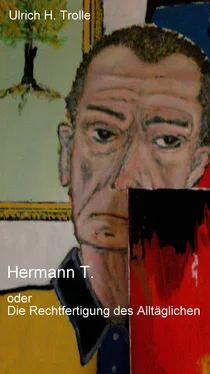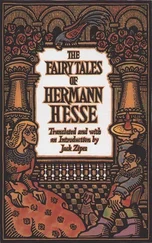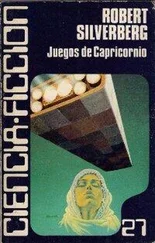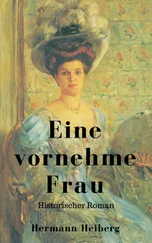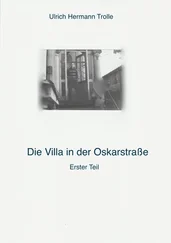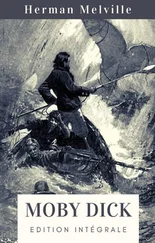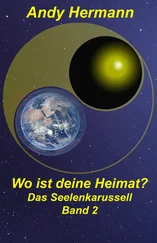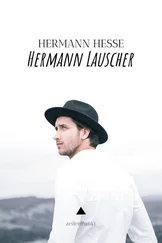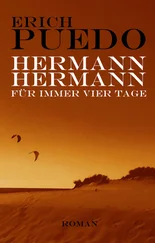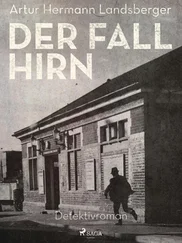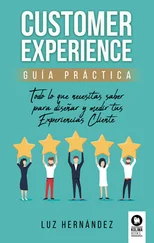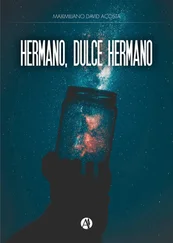Ulrich Hermann Trolle - Hermann T.
Здесь есть возможность читать онлайн «Ulrich Hermann Trolle - Hermann T.» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Hermann T.
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Hermann T.: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Hermann T.»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Sogar über den nächtlichen Zeitungszusteller regt er sich auf und scheut sich nicht, körperliche Gewalt gegen ihn aufzufahren. Gehässig wird Hermann angesichts einer dicken Frau, die als Pflegekraft angestellt ist und schlechten Mundgeruch haben muss, weil sie raucht. Die Ehe mit Lisa durchforstet Hermann eitel nach Schwachstellen und stellt abenteuerliche, ausspähende Theorien des Zusammenlebens mit Lisa auf.
Hermann T. — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Hermann T.», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Hermann reitet.
Treffender gesagt, Hermann reitet einen alten Gaul mit kindlicher Rute. Seit seinem zweiten Arztbesuch sucht er nach einem Weg, die Tabletten zu umgehen, wie ein Schüler, der die Hausaufgaben nicht machen will. Er ist inzwischen schon feige und unsicher gegen sich selbst geworden. Was würde geschehen, so fragt er sich, wenn ich die Ärztin täuschte und sie beim nächsten Termin anlügen würde? „Ich könnte ihr gegenüber behaupten, ich habe alle Tage die Tabletten eingenommen, obwohl ich bereits seit einem Monat abstinent wäre. Die Ärztin kann mich nicht kontrollieren. Das geht praktisch nicht.“ Dem steht gegenüber, dass sich Hermann selbst zu kontrollieren hat. Er hat sich die Tabletteneinnahme selber zur Pflicht gemacht. Da wird es für ihn schwierig, von der kasteienden Selbstverpflichtung hinweg zu kommen. Wie er auch sinnt, der Tabletteneinnahme auszuweichen, er findet keine Lösung und mitunter fürchtet er sogar, dass die Erkrankung heftiger würde? Hermann sieht sich wie in einem Spiel, dessen Regeln er aber bestimmen, und ohne Not auch verlassen könnte. Er könnte doch die lästigen Regeln abschaffen. Er könnte neue Regeln aufstellen und das Spiel neu beginnen, oder einfach anders spielen. Aber am besten wäre es für Hermann, irgendjemand würde plötzlich aus heiterem Himmel sagen, das Spiel ist aus, die Sache mit den Tabletten hat sich ab sofort erledigt. Dann käme sich Hermann wie im Märchen vor, so wie vor vielen Jahren im Ferienlager, als die allmorgendlichen ungemütlichen zwanzig Minuten des peinigenden Frühsports mit den hässlichen Kniebeugen und dem ekelhaften Langlauf plötzlich zu Ende waren, und Hermann nach den kühlen Nächten auf dem Strohsack und noch mit dem Schlaf in seinen Knochen sich nicht mehr zum Frühsport überwinden musste, und den anderen Jungen aus den anderen Lagergruppen gegenüber nicht mehr anzugeben brauchte, mit zu den Ersten, den Besten, zu den Schnellsten zu gehören, wenn er danach gefragt worden war. Damals, in jenem Feriensommer, schlug eines Morgens tatsächlich jemand den Eingang vom Zelt zurück, zeigte sein Haupt und kommandierte mit blechern scharfer Zunge ins Zeltinnere: „Heute kein Frühsport, es regnet.“ Wie weggezaubert war plötzlich die verhasste Anstrengung. Sie hatte sich aufgelöst im lapidaren Frühregen. Dauerlauf, Kniebeuge, Rumpfbeuge, Liegestütze, Armkreisen vorwärts und rückwärts und erst nach diesen Anstrengungen, lange, lange Minuten danach erst gab es die dicke Butterstulle mit der süßen Marmelade oben drauf und den heißen Milchkaffee... Die ganze Regel des Frühsports galt nicht mehr. Es galt jetzt anderes. Das bisherige Reglement hatte sich erledigt. Die Wolken am Kinderhimmel hatten sich einfallen lassen zu regnen und alle konnten die verpflichtende Frühsportregel vergessen. Von da an blieb auch das Gras um das Ferienlager herum morgens immer feucht. Und feuchtes Gras hieß, nasse Schuhe und Gänsehaut und Grippe und Mandelentzündung. Das wollte niemand. Das Marmeladenbrot konnte genüsslich gleich nach dem Aufstehen und nach dem Waschen und ohne Frühsport verzehrt werden. Niemand wurde krank, weil der Frühsport ausgefallen war. Wer aber erwartet hatte, Hermann und die anderen würden von der Regel des Frühsporttreibens gesünder werden, fand weder zur einen noch zur anderen Seite hin eine Bestätigung. Das Gesundbleiben und das Nichtkrankwerden waren wohl mehr fiese Gedanken und Überzeugungen aus der Erwachsenenwelt. Die den Körper angeblich ertüchtigende Wirkung eines Ferienlagerfrühsports war deshalb Hermanns kindlichem Empfinden immer ein wenig fremd geblieben. Im Ferienlager ist Hermann sowieso nie krank geworden. Die aufgelöste, die weggefallene Frühsportregel machte ihn vielleicht sogar noch gesünder oder noch reicher. Das Wegfallerlebnis führte zu einer unerwarteten Freude, denn alle freuten sich über die durchnässte Frühsportregel. Vom Wegfall hatten alle bisher nur still gehofft. Und die Hoffnungen auf den Wegfall waren jeden Tag zerschlagen worden, bis, ja, bis der Regen kam. Doch Kinderfreuden sind nicht wiederholbar. Sie sind nicht neu zu erleben. Das ist gar nicht schade. Manchmal wünscht sich Hermann, wie ein Kind zu sein. Es ist an diesem Morgen noch einigermaßen still für die immer unruhige Großstadt Berlin. Noch dringt kein lästiger Dieselgeruch von der Straße her durch das geöffnete Badfenster. Hermann spürt leichten Wind von Südwesten her. Er tritt vom Fenster zurück, atmet tief, sein Brustkorb hebt sich, senkt sich wieder. Den zweiten Atemschub nimmt er durch die Nasenflügel. Er wölbt seine Bauchdecke, hält die Luft wenige Sekunden an, presst sie in seinen Körper, bis er einen leichten Druck im Brustbereich verspürt. Laut bläst er dann seinen Atem wieder aus. Noch einmal verfährt er so, spannt die Muskeln, richtet sich gerade und aufrecht. Ein hohes singendes Rauschen durchfährt seinen Kopf, zieht sich in den Nacken. Dann lockert er sich, lässt die Arme fallen und atmet im normalen Rhythmus weiter. Heute kann er sich auch zu Liegestützen durchringen. Hermann gibt sich die Marke fünfzehn vor. Gelegentlich und wenn er auch die Bauchmuskeln anstrengt und seine Halsmuskeln in die Bewegung mit einbezieht, gelingen ihm auch zwanzig Liegestütze. Aber mehr als fünfzehn Liegestütze zu drücken, ist meist nicht sinnvoll. Bei mehr als fünfzehn wird die Übung mehr und mehr zur Anstrengung gegen den Schmerz in seiner rechten Schulter. Heute also nur fünfzehn Liegestütze, sagt sich Hermann und dehnt noch einmal die Arme nach oben, lässt sie einige Male kreisen, zieht sie an den Rumpf zurück und mit durchgedrückten, leicht gegrätschten Beinen senkt er dann seinen Oberkörper, drückt ihn gegen die Oberschenkel, wiederholt die Dehnung solange, bis seine Fingerspitzen den Fußboden erreichen. Dann geht er in die Hocke, streckt die Beine nach hinten aus und beginnt seine Liegestütze, die er zunehmend keuchend bis fünfzehn abzählt. Über seinem Kopf hängt das Waschbecken. Nach der Fünfzehn schiebt er den Oberkörper gegen die Beine, geht wieder in die Hocke und richtet sich langsam mit lautem Atem nach oben auf. Er sieht seine Röte im Spiegel und die pulsierende Ader am Hals. Er ist froh, für den Erhalt seiner Muskeln etwas getan zu haben aber auch darüber, dass ihm beim Frühsport kein Zuschauer stört. Er kommt sich in der sportlichen Rolle etwas lächerlich vor, voller dümmlichem Eifer. Doch er bleibt beim Frühsport, übt mit Vorsicht und mit der restlichen Bettwärme, die von der Nacht her noch seine Muskelfasern warm gehalten hat. Jetzt schließt Hermann das Fenster, zieht sich die neuen blauen Jeans über die Unterhosen, stopft das T-Shirt unter den Gürtel und greift nach seiner leichten Morgenjacke. Er schlüpft erst mit der rechten Hand und dann mit der linken folgend in die Ärmel und geht, während er den Kragen richtet, in die Küche, um sich den Frühstückskaffee zu bereiten. Hermann nimmt aus dem Hängeschrank über dem Tisch den Messbecher, lässt frisches Leitungswasser hinein, etwa einen halben Liter, und schüttet es durch die schmale Einfüllöffnung in die Kaffeemaschine. Die Wassermenge reicht für zwei große Tassen. Dann knickt er am Falz die Filtertüte um, greift viermal in die Kaffeedose und holt viermal einen Löffel voll Kaffeepulver aus der Dose und dann schaltet er das Gerät ein. Die Kaffeemaschine knarzt und krächzt. Dünnes feines Aroma breitet sich im Raum aus. Leicht schwebt noch etwas Wasserdampf aus der Maschine während der Zubereitung des Kaffees. Es dauert etwa vier Minuten, dann kann er die Kanne auf den Tisch stellen. Hermann nimmt derweil von der Hakenleiste einen kleinen Schlüssel, öffnet die Haustür und geht zum Briefkasten an der Pforte, vorn, wo der Fußweg am Grundstück entlang führt. Von hier aus hat er freien Blick nach beiden Seiten der Straße. Nur wenige Menschen sind um diese Zeit zu sehen. Einige Jugendliche fahren stumm auf dem Fahrrad zu Schule, ihren Blick nach vorn auf den Gehweg gerichtet. In einiger Entfernung kommen zwei Männer hintereinander und mit schräg über die Schulter gehängten breiten, im Rhythmus ihrer Hüften wippenden Taschen den Gehweg entlang. Die modischen Taschen, in die bequem ein mittelgroßes Notebook hineinpassen könnte, verhindern ein lockeres Schwenken der Männerarme, erzwingen eine fortdauernde abstehende Haltung der Arme. Die ausschreitende Gangart der beiden erinnert Hermann an soldatisches Marschieren, auch an die Westernhelden aus dem Kino, die auf einen unsichtbaren Gegner zugehen und blitzschnell den Colt ziehen müssen. Die Männer hier müssen keinen Colt ziehen, aber das Western-Bild gefällt Hermann. In seinem Kopf glimmt es. High noon. Auf den Ahornbäumen entlang der Straße krächzen und lärmen mehrere Elstern und flattern mit lautem Flügelschlag durch das Geäst. Eine nach der anderen fällt im Gleitflug auf die Erde. Vor den Grundstücken parken die ersten anwohnerfremden Autos im frühen Schatten auf beiden Seiten. Nach neun Uhr wird nichts mehr frei sein, geht es Hermann missmutig durch den Kopf. Den ganzen Tag über wird die Straße zugeparkt bleiben, sehr oft bis in die Nachtstunden hinein. Hermann vermeidet es, am Briefkasten länger als erforderlich zu stehen, oder gar die Briefabsender noch an der Tür vorab zu lesen, um nicht die ständig neu hinzu kommenden Autos zu bemerken und die seine Laune nur verderben. Ein Kleinwagen mit der Werbung eines mobilen Pflegedienstes wendet eilig und mitten auf der engen Straße. Der Motor heult auf, stört den morgendlichen Frieden, und entfernt sich über das holprige Straßenpflaster mit klappernden Geräuschen, die aus dem Achsbereich des Autos zu kommen scheinen. Hinter dem Lenkrad sitzt eine korpulente Frau. Sie zündet sich gerade in dem Moment des Vorbeifahrens eine Zigarette an. Sie sitzt steif, scheint wie eingequetscht zwischen Lenkrad und der Lehne ihres Sitzes. Ein Dummi sitzt so, denkt Hermann und dreht den Schlüssel im winzigen Schloss an der Leerungsklappe des Briefkastens herum, nimmt die Tageszeitung und die erste Briefpost heraus, sieht erneut, aber nun schon von hinten auf das sich entfernende kleine Auto mit der adipösen Frau und fragt sich halblaut die Lippen bewegend, wie eine Person mit derartiger Leibesfülle überhaupt einen Pflegedienst erledigen kann. Hermann wettert sofort innerlich los und brubbelt seine Gedanken vor sich hin. Es hört ihm niemand zu. Wenn Lisa jetzt an seiner statt die Zeitung aus dem Briefkasten nähme, was hätte sie bemerkt? Aber nein, Lisa würde die Fettleibige in dem kleinen Auto gar nicht sehen. Lisa interessiert sich nicht für den Pflegedienst. Nicht einmal am Kaffeetisch kann Hermann das Thema Altenpflege ansprechen. Lisa schiebt das Altwerden von sich weg. Sie hat Angst vor dem Altwerden. Sie ekelt sich davor. Der Pflegedienst existiert nicht für Lisa. Doch! Lisa hätte vielleicht doch etwas gesehen. Dass der Zaun zur Straße hin allmählich rostet. Aber dass sie den Rost sehen würde, statt der Dicken im Auto, ist nur eine Vermutung, die Hermann hat. Er weiß nicht wie seine Lisa am frühen Morgen denkt. Und Hermanns Stimmung bessert sich überhaupt nicht, wenn er den Gartenzaun vor Augen hat. Es schaudert ihn, wenn er an die Menge kleinteiliger Arbeit denkt, die er sich mit dem Zaun wieder aufbürden würde, wollte er den Zaun in die Liste der Erhaltungsleistungen für das Haus aufnehmen. Er sieht heute Morgen lieber das Fahrzeug mit der dicken Frau, wie es in die Richtung der nächsten Querstraße abbiegt. Was will sie dort, diese Dicke? Hermann spinnt sich ein schnelles Bild von ihr zurecht, wie sie vor seinem Haus umständlich in die kleine Parklücke einparkt, die Wagentür öffnet und sich aus dem Fahrzeug heraus zwängt, ihre Tasche greift und ihr T-Shirt, auf dem sich bereits dunkle Schweißflecken zwischen den Schulterblättern zeigen, mit schüttelnder Armbewegung lüftet und versucht, von ihrer klebenden Haut abzuziehen. Hermann stellt sich vor, er wäre selbst ein Pflegefall und diese Dicke vom Pflegedienst würde zu ihm kommen. Sie würde mit seinem, ihr überlassenen Schlüssel in der Hand, die Gartenpforte öffnen, ihre Massen fünf Stufen bis zur Haustür hoch stemmen und sich dabei mit einem Arm, die Beine unterstützend, am Geländer emporziehen, den Schlüssel heftig im Haustürschloss herumdrehen und dann breit in seinen Flur treten. Hermann würde alles mit wachen Sinnen wahrnehmen müssen, die Tür zu seinem Zimmer steht offen. Es würde ihn ärgern, dass er nicht mehr selbst auf die Beine kommt, die Insuffizienz ihn ans Bett kettet, wer weiß, wie lange noch, und er sich wünscht, endlich davon befreit zu sein, befreit von der Altersschwäche, und von der Dicken. Diese Wünsche würden seine Gedanken bestimmen, sobald er morgens die Augen aufgemacht und dem Dämmerzustand entkommen wäre. Und dann würde er in diesem Zustand an nichts anderes denken wollen als daran, wieder gesund zu sein, die Dicke nicht mehr zu benötigen, beweglich auf eigenen Beinen zu stehen und sich fortbewegen zu können… Da tritt die Dicke aber schon an sein Bett heran. Ihren schweren Schritt hat er gespürt an dem Vibrieren der Dielung. Er wird sich nicht wehren können. Wie oft schon hat er den Zigarettengeruch ihres schweren Atems verflucht, den er nicht ertragen kann, der sich aber auf sein Gesicht legt, wenn sie auf ihn herunter schaut und sagt: „Guten Morgen, Hermann, da wollen wir mal wieder. Haben Sie gut geschlafen heute Nacht?“ Im Wohnviertel gibt es etliche Pflegefälle, mindestens drei. Vielleicht sogar in jeder Straße drei? Sieben Querstraßen mal drei Pflegefälle ergeben einundzwanzig Termine. Für jeden einzelnen Termin in den Wohnungen zwanzig Minuten Verweildauer, gemäß Pflegevertrag, zum Beispiel für das Aufwecken, Ankleiden und auf den Stuhl helfen; oder dreißig Minuten für die vorige Leistung plus das Bereiten des Frühstücks und für das Sortieren und Verabreichen der Tabletten; oder dreißig Minuten für die Kleine Morgentoilette einschließlich Ankleiden des Patienten; oder für die Kleine Morgentoilette plus Zubereiten und Verabreichen des Frühstücks und für das Sortieren inklusive der korrekten Einnahme der sortierten Tabletten zusammen eine dreiviertel Stunde. Wenn die Pflegefälle mit oder ohne Kleine Morgentoilette und dem Frühstück bedient sind, ab sechs Uhr dreißig etwa, inklusive Fahrzeit von einem zum anderen Fall einschließlich des Suchens und des Findens eines Parkplatzes sind vier Stunden vergangen. Also reicht die Zeit noch für zwei weitere Pflegefälle und deren Vorbereitung auf das Mittagessen bis die Dicke Pause machen kann. Frühstück haben alle, also bekommen sie nach der Pause alle das Mittagessen, oder das Essen auf Rädern ist gerade für sie geliefert worden und es wird von der Dicken auf einen Suppenteller präsentiert. Es ist genießbar auch in der transportablen, wasserdichten Warmhalteverpackung, in der es bis zur Haustür gelangt ist. Die Dicke wird vielleicht diesen oder jenen männlichen bzw. weiblichen Patienten füttern müssen. Anschließend wird sie den Abwasch kurz noch erledigen und den bleichen Lippen des Pflegefalls beim Trinken nachhelfen, der wieder mal nicht schlucken will und dadurch zuviel von dem Wasser am Kinn entlang den faltigen Hals hinunter auf die Oberbekleidung rinnt. Die überwiegende Zeit ihrer Anwesenheit im Haus des Pflegefallpatienten wird nicht geredet. Ihre Tätigkeiten verrichtet die Dicke nonverbal, aus Gewohnheit oder aus Ermattung oder aus irgendeiner persönlichen Verstimmung heraus. Am meisten sprechen die Augen im Gesicht beider Beteiligter, die der Dicken und die der anderen, der zu versorgenden Person. Beide stehen mal mehr, mal weniger in einer ziemlich emotionalen Enge zueinander. Beim Ankleiden und Verabreichen der Medikamente sind sich beide am nahesten und ein längerer Austausch, ein Wortwechsel, der intensivste während des Termins, ist hierbei am wahrscheinlichsten. Vielleicht ist es ein Austausch von Gefühlen, eine wiederholte Aufforderung, die Tablette endlich zu schlucken oder eine Tröstung in den dement vergesslichen Kopf hinein. Aber wenn die Dicke einmal etwas ruppig zupackt und die langbeinigen Unterkleider kräftig nach oben zieht, die Vorlage samt Netzhose dadurch verrutscht und der Schlüpfer auch noch verknüllt, wird aus der Kommunikation zwischen ihr und dem Pflegefall ein Geschrei und ein Gezänk. Dieser Zustand ist gänzlich unangebracht und hat launische Auswirkungen auf die Worte beider und auch auf den nächstfolgenden Pflegefall. „Guten Morgen!“ und „Auf Wiedersehen!“ zählen nicht zur Kommunikation. Es sind die automatisch aus dem Mund gesendeten Signale vom Beginn und vom Ende der Dienstleistung für einen oder eine aus der Liste der pflegebedürftigen Personen in dem Wohnviertel. Dann fliegt die Haustür zu. Über jeden Pflegefall liegt bei der Dicken eine Plastikmappe mit Klarsichtdeckel vor. Der Fall wurde angelegt zu Beginn der Pflegezeit als Leistungsvertrag und unterschrieben vom Pflegefall selbst oder von seinem Betreuer. Die Mappe ist ein Dokument. Es ist täglich zu aktualisieren. Es enthält die wesentlichen menschlichen Daten, auch übersichtlich für eine Vertretungskraft, die den Pflegefall und seine zu beanspruchenden Leistungen schnell und doch vollständig zu erfassen hat, wenn die Dicke mal ausfällt oder Urlaub genommen hat. Im Vertragstext zuoberst und auf den grün-gelb-rosa gefärbten Seiten der Anlagen zum Vertrag voller gedruckter Zeilen und Spalten ist das Wort ‚Pflegebedürftiger’ nicht zu finden. Dafür taucht der Begriff ‚Patient’ immer wieder auf. An dem Wort ‚Patient’ ist formal nicht zu mäkeln, wenn sich auch ein ungutes Gefühl im Nacken einstellen will, weil der Zusammenhang zwischen der Pflegebedürftigkeit und dem Patienten plötzlich hartnäckig ins Bewusstsein drängt und das Weiterlesen behindert. Aber das geht den Nacken eigentlich nichts an. Der allgemeine Begriff ‚Patient’ scheint für die Angelegenheit des vertraglich vereinbarten Pflegens zweckmäßig zu sein. Man kann mit einem Patienten als Vertragspartner nämlich leidenschaftslos umgehen. Und selbst wenn das Wort Patient als Vertragspartner und Leistungsnehmer häufig im Vertragstext erwähnt ist, impliziert dies noch lange keine subjektive Gefühlsreaktion. Bei einem Patienten hat man lediglich eine vage Vorstellung davon, dass irgendein Anonymus erkrankt sei und geheilt werden soll. Der Begriff ‚Patient’ beschreibt die Vertragssache per se eindeutig und man kann alle Regungen beiseite schieben. Der Patient ist krank und hat eine Pflege zur Folge. Oder Erkrankung und Pflege kommen gemeinsam daher. Nicht selten ist Pflege gar das Ende einer Krankheit. Also ist alles am Patienten lediglich krank. Und vor Augen stellt sich für den gesunden Vertragspartner der Pflegtermin dann als ein mehr oder weniger mechanischer Vorgang ein, den er, der Leistungserbringer, in Form von Tablettenverabreichung, Fiebermessen, Verbandswechsel und physiotherapeutischen Bewegungsreizen in einer täglichen Arbeitsdosis bündelt und bewältigt. Easy doing. Jedoch bei einem, der sich Pflegebedürftiger nennt, möchte man sich immer gleich und im Gegensatz zum Patienten ein lebendiges Wesen als Vertragspartner vorstellen wollen, weniger ein krankes Wesen. Man malt sich dazu wie von selbst zwei Augen in einem alten Gesicht aus, versieht es mit Falten, Schmerzen und eingeschränkter Sensorik, mit Blutergüssen, mit Geruch und Speichel. Da wird es einem beim Lesen des Vertragstextes schon mulmig und im Kopf entsteht ein sperriges Gefühl. Also ist der Begriff Patient im Vertragstext wohl doch besser. Das Pflegeverhältnis zum Patienten muss nämlich ein nüchternes und kaufmännisches bleiben. Es unterliegt einer vertraglichen Vereinbarung, die der Patient einging oder hat abschließen lassen als Leistungsnehmer mit einem Leistungserbringer. Und dieser Leistungserbringer, wie die Dicke im kleinen Auto, ersetzt nicht nur die feuchte Unterwäsche des ihr anvertrauten Leistungsnehmers, sondern füllt auch jeden Tag die bunt bedruckten Formblätter aus, die hinter dem Vertragstext in der Klarsichtmappe angetackert sind. Die Jurisprudenz will das so. Es gilt als Leistungsbestandteil. Vielleicht ist das tägliche stoische Ausfüllen der Formblätter in der Mappe jener Teil eines Pflegetermins, der zwar im Streitfall relevant, aber im Willen des Pflegedienstpersonals ein heftiges Unwohlsein erzeugt und die geringste Sympathiequote erreicht, weniger noch als das Erklimmen der Stufen zum Hochparterre, wo in den ansehnlichen Stadtvillen dieser Wohngegend erst die Wohngeschosse beginnen. Und auch die Alltagskompetenzen des Leistung entgegen nehmenden Patienten werden von den Listen insofern berührt, als jede Verbesserung oder jede Verschlechterung ihrer Kompetenz in den Listen anzukreuzen ist, oder einen Schrägstrich zu erhalten hat. Das wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein, je nach dem Typ des Leistungserbringers und seiner Schreiblust oder abhängig von seiner oder ihrer Differenzierungsfähigkeit. Diese Kompetenz wird allerdings in keiner Strichliste geführt. Der Dicken in dem kleinen Auto werden die farbigen Listen in der Mappe jedenfalls lästig sein und sie nur vom Rauchen abhalten, denkt Hermann, weil er gerade noch eine Qualmwolke deutlich aus dem geöffneten Fenster des kleinen Autos abziehen sieht. Niemand, und auch die Dicke nicht, will gern freiwillig und andauernd Striche, Kürzel und Aktualisierungen immer und immer wieder in die Protokolllisten eintragen. Wertschätzung ist das nicht. Mehr Geld wäre mehr wert, so denkt die Dicke in dem Bild, das Hermann jetzt am Morgen vor dem Briefkasten stehend von ihr hat, ausgedacht während des kurzen Blickes auf ihre Körperhaltung in dem kleinen Fahrzeug und besonders auf die qualmende Zigarette zwischen ihren Lippen zielend. Im Grunde genommen hat Hermann das Bild von der Dicken aus einer Laune heraus gezeichnet und gemixt mit einer vagen Vorstellung über seinen eigenen Lebensabend. Ob die Dicke so denkt, wie Hermann von ihr denkt, bleibt ungeklärt und den anderen Lästerern überlassen. Soweit sich Hermann im Zuhause seiner Kindheit an Gespräche der Eltern über das Altwerden und die Pflege der Alten erinnern kann, soweit er daran teilhaben durfte, waren alle Altgewordenen in der Familie immer zunächst zuckerkrank geworden. Die Zuckerkrankheit war in allen Erwähnungen über Krankheit und Tod stets der Anfang vom Ende und so blieb es. Es schien Hermann, als wäre der Tod eine Sache des Geschmacks. Und eben aus diesen Gesprächen über das Alter und den Tod festigte sich in Hermann die Gewissheit, die Spucke der Alten auf dem Sterbebett müsse zuckersüß sein. Alle Altgewordenen waren in den elterlichen Gesprächen zusätzlich zum Diabetes dann noch durch eine Apoplexie bettlägerig und nach dem neun Tage später unweigerlich folgenden zweiten Schlaganfall gestorben. Oder sie siechten im Bett des Altenheims, weil gestürzt, mit nicht heilen wollender Oberschenkelhalsfraktur vor sich hin. Manchmal schlug Mutter die Hände zusammen und rief den Lieben Gott an, wenn sie in der tödlichen Abfolge noch von einer Pneumonie berichtete. Soviel hält kein Mensch aus. Der Korrektheit wegen ist zu erwähnen, dass der kleine Hermann natürlich niemals andere Worte als Zucker, Gehirnschlag, Knochenbruch und Lungenentzündung vernahm. Medizinische Termini grassierten nicht in der elterlichen Küche. Wie hätte er sonst aus Diabetes Mellitus oder Apoplexie schließen sollen, irgendwann einmal am Ende seines eigenen Lebens werde auch er in einem Pflegeheim oder in der Geriatrie eines Krankenhauses mit zerbrochenen Knochen, nach Luft ringend und mit süßer Spucke im Mund auf den Tod harren müssen. In Hermann hatte sich lange Jahre an dieser Vorstellung vom Altwerden und vom Altsein nichts geändert. Er hat ein paar Jahre später erst und dann aber häufig überlegen müssen, an welcher Stelle seines eigenen Hauses eigentlich ein Sturzrisiko liegen könne, das er in jungen Jahren übersah oder geringschätzig übersprang, aber in zukünftigen Jahren, er sich doch dort den Oberschenkelhals brechen werde. Die Dicke vom Pflegedienst. Weiß sie beim Treppensteigen eigentlich auch von ihrem Sturzrisiko? Es könnte sein. Gewiss, es wird so sein. Sicher sogar. Aber wenn sie an ihr Sturzrisiko zu denken kommt, erinnert vielleicht durch die körperliche Anstrengung des Treppensteigens ist schon fast der Nachmittag ran. Bis dahin muss sie jedenfalls die vier Kriterien für das Risiko ihrer Patienten in der Checkliste ausgewählt, beurteilt und angekreuzt haben. Hermann räsoniert wie ein Kannegießer am Biertisch und freut sich sogar an seinem Gebelfer. Er bläst sich innerlich auf wie ein Luftballon. Nur, wem will er sich denn mitteilen? Er geht doch in keine Kneipe. Er geht nur in Ausnahmefällen in die Kneipe und dann ist es keine richtige Kneipe, sondern immer das gleiche Restaurant, das er aufsucht und einlädt, wenn er oder Lisa Geburtstag haben und alle zusammenkommen können zu einem Abendessen. Schmähreden über einen Pflegedienst gehören dann auch nicht an die Tafelrunde. Es würde sich auch niemand für den Pflegedienst interessieren, zumal die Reden am Tisch an solchen Abenden sowieso nicht Hermann, sondern andere führen, die sich gerne den allgemeinen Themen des Wohlstandes und der Ahnenforschung hingeben. In diese Kerbe haut der Hermann nicht. Deshalb bringen wir seine Tiraden hier zu Papier, wenden uns von den Abendgästen ab und der Dicken vom Pflegedienst wieder zu. Die Dicke soll in der Parklücke ihre Zigarette ausdrücken, ohne zu stürzen über die Schwelle des Hauses treten und ihre Garderobe in der breiten Diele ablegen. Sodann wird sie die Küche erreichen und sich eventuell die Hände waschen oder Gummihandschuhe überziehen. Der rauchende und der nicht gestürzte dicke Pflegedienst soll einer pflegebedürftigen Person im Haushalt zur Hand gehen, das Essen bereiten, das Bett aufschütteln, auf der Toilette und beim Ankleiden helfen, in der Küche den Morgenkaffee mit Kondensmilch versehen und an den Ohrensessel bringen. Wenn sie, die bedürftige Person, bzw. ihr Magen, keinen Kaffee verträgt, wird es ein Glas stilles Wasser sein, oder einfaches Leitungswasser, das wird sie doch wohl vertragen, Himmel-Herr-Gott-Noch-Mal! Danach wird die ganze Pflegebedürftigkeit zum Ausfahren präpariert und in den Rollstuhl gewuchtet. Oder sie wird an den Rollator gebracht, zur Fortbewegung innerhalb der Wohnung, wenigstens bis in die etwas für neuzeitliche Gehhilfen nicht ausreichend bemessene Küche. Meistens liegen in den Häusern hier in den Straßen dieser bevorzugten Wohngegend die Küchen im Hochparterre und die Schlafgemächer im Obergeschoss. Und zwischen den beiden mindestens Dreimeterzwanzig hohen Räumen und ihren schönen stuckveredelten Decken verbindet eine prächtige Vollholztreppe das Erdgeschoss mit dem ersten Stockwerk, zweiarmig natürlich, eventuell mit Podest, mindestens aber Einmeterzwanzig breit zwischen den Wangen, weil das Faible des Bauherrn seinerzeit gebot, auf die im Land Preußen gebräuchliche vierziger bis sechziger Zollbreite zurück zu greifen. Auch im 19. Jahrhundert gab es nostalgisches Denken, sagt Hermann. Für das Thema ist er ja zu haben. Er kennt sich da aus. Weniger die Dicke. Die braucht das auch nicht. Sie fragt nicht nach dem gewendelten An- und Austritt, nach siebzehn Zentimeter hohen Setzstufen und nach dem geschnitzten Löwenkopf auf dem unteren Treppenpfosten. Sie ächzt lieber auf der Treppe. Eine Dicke ab neunzig Kilogramm Eigengewicht wird wenig lustvoll die vielleicht zwanzig Treppenstufen hinauf steigen. Sie wird zwar die angeformte Kopfleiste annehmen müssen aber die gedrechselten Traljen aus der Gründerzeit ignorieren. Die profilierten Zierleistchen, hölzernen Noppen, Pfropfen und Messingknöpfe am Holzwerk werden ihr überhaupt nicht auffallen. Stattdessen wird es ihr schwer fallen, die Treppe leichtfüßig zu nehmen. Na, vielleicht geht es, wenn sie alle drei bis vier Stufen einmal kurz stehen bleibt und ihren 90 Kilogramm eine Atempause gönnt. Für eine Geschosstreppe wie in der Villa nebenan braucht die Dicke dann beim zweiten Mal Herauf und Herunter ungefähr fünf Minuten und muss danach ihre versorgenden Handgriffe schneller erledigen. Wie will sie dann, fragen wir, nach dem dritten täglichen Pflegefall, ihre Pflegezeiten überhaupt einhalten? Wenn die Dicke in der Küche das Wasserglas hat stehen lassen, stampft sie wieder herab und dann den Rückweg vom Erdgeschoss wieder herauf. Dieser Gang erzeugt im Gebälk Erschütterungen der Stufe Fünf auf der Richterskala. Die Dicke ist weiter gefahren in ihrem engen kleinen Auto zum nächsten Pflegefalltermin. An der Haustür angekommen, hat sie ihre Zigarette bestimmt noch nicht aufgeraucht. Das wird ihr nicht egal sein. Sie wird die Zigarette deshalb vorsichtig ausdrücken und nach dem erledigten Termin den Stummel wieder anzünden. Sie raucht ein paar Züge weiter, wenn sie im Auto sitzt, und eine Minute später vor der nächsten Haustür beim nächsten Termin wird sie die Zigarette wieder ausdrücken und vor der dritten Haustür ist die mehrmals angezündete und wieder ausgedrückte Zigarette dann endlich aufgeraucht. Zigarettensport. Die Dicke steckt sich die drohende Warnung jeden Tag zwanzig Mal in die Fresse. Der Tod küsst sie auf ihre Lippen in kleinen Dosen zwanzig Mal am Tag. Die Augen der Dicken registrieren nur noch oberflächlich, ihr Wille schaut zwanzig Mal weg. Was täglich zwanzig Mal in sie eindringt ohne fühlbare Veränderungen an ihr vorzunehmen, verliert an Wirkung. Die Dicke ist ein beleibter rauchender Pflegedienst. Der rauchende Pflegedienst ist ein Diensttuender des Todes, er arbeitet dem Tod in die Hände. Er hantiert an todgeweihten Menschen. Alle Pflegedienstler, die Hermann in seiner Straße sieht, rauchen. Die Dicken ebenso wie die Schlanken und vor allem die Jungen. Und sie werfen ihre Kippen auf den Fußweg. Hermann fühlt sich davon provoziert und beleidigt, obwohl ihm rauchende Menschen auf der Straße doch meistens gleichgültig sind. Aber wenn Hermann eine Kippe vor seinem Haus erblickt oder in seinem Vorgarten Kippen auflesen muss, würde er am liebsten laut und apodiktisch in die Welt hinaus schreien: Raucher sind süchtig und eklig. Weil er sich aber vor dem Schreien scheut, es wäre zu albern, im Vorgarten vor sich hin zu schreien wie ein Geisteskranker, wohin soll er dann seinen Ärger über die Zigarettenkippen transportieren? Einfach zurück auf die Straße ist ihm zu billig. Dann wäre er nicht besser als die Kippen wegschnipsenden Raucher. Also nimmt er die Kippen hin. Er übergeht sie und kippt sie in die Mülltonne. Er schont seine Nerven und stellt sich über die Raucher. Er tröstet sich mit seinem aufgeklärten Umweltbewusstsein, das jene nicht haben können. Raucher können keine sauberen Menschen sein. Ihre Sucht nach Nikotin unterdrückt ihr Bedürfnis nach Sauberkeit, sagt Hermann und geht noch weiter. Er postuliert Grundsätze und einen davon hat er immer parat und der lautet: Rauchen und Pflegen sind nicht vereinbar. Und spielend ergänzt er: Dicksein und Pflegen geht auch nicht. Ein dickleibiger Pflegedienst kann nichts. Er ist unsauber und unlogisch und ein Widerspruch in sich, contradictio in adjecto, sagt Hermann. Es sind Hermanns oberflächliche, wenn nicht gemeine Worte. Weil die Gegenwart gemein ist, bin ich es auch, rechtfertigt er sich. Ich bin so gemein wie der Anblick der Zigarettenkippen in meinem Vorgarten. Hermann spinnt sich im Thema ein. Davon weiß die Dicke vom Pflegedienst nichts. Die Dicke kann die Anforderungen an ihren häuslichen Pflegedienst in Häusern mit Vorgärten ja auch erst einschätzen, wenn sie überhaupt einmal in so ein Haus in einer bevorzugten grünen Wohngegend kommt, wie Hermanns Wohnstraße eine ist, und wenn sie erst einmal richtig die Wohnungen mit ihren Flurtreppen und den etwa zwanzig Stufen zwischen der Dreimeter und zwanzig hohen Küche und dem drei Meter hohen Schlafraum im Obergeschoss wahrgenommen hat. Da wird die Dicke vielleicht zunächst etwas resignierend ins Grübeln kommen und den Standort wechseln wollen und ihren Pflegedienst doch lieber in vielgeschossigen Wohnbauten der Plattenbausiedlungen mit Fahrstuhl tun. Dort ist jede Wohnung mit dem Pflegefall auf einer Ebene. Aber für so eine Entscheidung ist es dann zu spät. Die Dicke kann sich dann nicht mehr umentscheiden. Sie muss sich zwischen Küche und Schlafgemach bewegen und die breitstufigen Treppen rauf und runter, ob sie will oder nicht. Und sie wird ja auch nichts wollen. Schon gar nicht sich entscheiden wollen. Nichts will sie. Sie will rauchen wollen. Was, sie will wollen? Quatsch, das versteht die doch sowieso nicht. Hermann fragt sich, ob die Dicke vielleicht Gelüste verspürt. Ob sie in so einer fremden Wohnung, so mitten drin zwischen den Wohngeschossen mit eingeschränkt handlungsfähigen Personen verführbar ist. Mal heimlich eine Schublade in der Diele öffnen, so nebenbei, unauffällig, es bemerkt niemand. Im Winter wird es wieder kalt. Sie könnte gefütterte Handschuhe brauchen. Und in der Schublade darunter? Schals, Regenschirm, Tücher. Lieber nicht. Die gefallen ihr nicht. Sie hat einen anderen Geschmack. Eher wird die Dicke vielleicht dem Pflegefall nachhelfen auf dessen endlichen Wege. Mal ein bisschen die Halsschlagader zudrücken... die Dosis verwechseln... einen harten Brocken in dem offenen Mund einführen... Wer kann etwas dafür, dass die Peristaltik nicht mehr funktioniert? Hat doch keiner gewusst. Und Atemnot war schon häufiger... ist in der Klarsichtmappe notiert... Ging aber wieder weg. Der Dicken fällt der Pflegedienst zwischen den Wohngeschossen nicht leicht. Sie wird auf der Treppe zwischen den Geschossen keine Freude empfinden, es sei denn, sie hat gleich nach dem Termin Feierabend und kann nach Hause, in ihre Wohnung, in der alles eben ist und sie dort über keine breite Treppe braucht, um in ihr Schlafzimmer zu gelangen. Nur, dass sie sich in es reinquetschen muss jeden Abend. Aber es ist ihr Lebensraum, den mag sie, wie sie sich ihn leisten kann, wie auch ihren Vierbeiner und die Kinder, ihre und seine. Über all dem Unmut, den Hermann ablässt, fragt sich Hermann auf einmal, ob ihm die Dicke nicht leid tun sollte. Er ist doch ziemlich weit gegangen mit seinem Zynismus. Aber er will nichts dafür können an diesem Morgen. Es floss aus ihm heraus, ganz leicht. Die Gehässigkeiten machten sich selbständig, und Hermann hat sie nicht zurückgehalten. Er spürte ein Gefühl in sich, dass sein Lästern ihm gut tut. Lästern hielt er immer für eine Schwäche und für eine Waffe dummer Menschen. Aber jetzt empfindet er das Lästern als Erleichterung, und er muss sich gar nicht anstrengen dabei. Es erhebt ihn, macht ihn gelöst und befreit. Aber wie ein dummer Mensch will er auch nicht sein und nicht so wie diese sprechen. Und sogleich schämt er sich seiner Entgleisungen gegenüber der Dicken. Hermann wird ernst und versucht, von seinen Gehässigkeiten abzukommen, einen anderen Gedanken zu finden. Er will nicht mehr verbal über die Dicke herfallen. Es gelingt ihm nicht. Er ist auf der Lästerschiene, bleibt auf ihr, kann ihr nicht entrinnen. An der Dicken kommt er einfach nicht vorbei. Er bleibt gepolt auf die Dicke vom Pflegedienst, fühlt sich leichter und beschwingter und klimmt sich an ihr empor. Überhaupt kommt dem Hermann dickleibiges Personal einer Täuschung der Pflegebedürftigen gleich. Die Pflegestufe 1 wird die Täuschung vielleicht noch erahnen und mit leisem Zweifel über die Vereinbarkeit von Dicksein und Pflegedienst versehen, in den Tag hutschen. Die Pflegestufe 2 erlebt diese Zweifel schon weniger bis gar nicht, und die Pflegstufe 3 ist nicht in einem Haus mit zwanzig hölzernen Treppenstufen zwischen zwei Wohngeschossen untergebracht. Die Pflegestufe 3 verfügt über Zwei-Bett-Zimmer mit Linoleum, Gitter und Notruftaste und gegebenenfalls mit Fixierungsgurten. Da pflegt es sich weder gemütlich noch unterversorgt. Hermann grinst in sich hinein. Wie zur Bestärkung sie durchschaut zu haben, und das auch nur, weil er sie sie zufällig so eingezwängt im Auto rauchen sah, erkennt er in ihr eine Betrügerin, die den Pflegedienst nur solange macht, bis sie einen vernünftigen BMI bekommen hat und dann kündigt. Also nach ein paar Monaten bereits. Oder sie wird gesundheitlich am Boden sein, was eine andere Form der Kündigung nach sich ziehen könnte. Unter Umständen aber hat sich die Dicke lange bewerben müssen für diesen Pflegejob und ist froh darüber, endlich wieder in Lohn und Brot zu sein und auf ihrem Girokonto monatlich einen Fixbetrag mit einem Pluszeichen dahinter zu erkennen. Noch dazu, weil sie das Pflegen ja gelernt hat. Wird sie in diesem Fall länger aushalten, vielleicht sogar durchhalten, auch wenn sie in ihrem Selbstbild bereits schlank genug geworden ist? Oder wird sie vom häufigen Treppensteigen zwischen Erd- und Obergeschoss von einem anderen Job träumen, von einem weniger anstrengenden? Der erträumte und wenig anstrengende Job ist heutzutage eine Illusion, völlig wertlos. Der erträumte Job ist wie das Versprechen in einer Zeitungsanzeige, gutes Geld zu verdienen, wenn man an der Haustür Lebensversicherungen verkauft. An der ersten Klingel schon zerplatzt der Traum. Das wird der Dicken auch durch den Kopf gehen, wenn sie die Treppen steigt. Ihr ausgeübter Job ist ihr mehr wert als der gewünschte und noch mehr Wert als der Gang zum Sozialamt. Dafür nimmt es die Dicke in Kauf, täglich aus der Puste zu kommen und nicht richtig Zeit zum Essen zu finden. Ihr Gehalt am Monatsende wird für die Ansparung einer soliden Rente nicht ausreichen. Dann wird ihr Gang zum Sozialamt vielleicht doch fällig, irgendwann, vielleicht kurz bevor sie selber zum Pflegefall wird. Aber ihre Zigarette muss sie rauchen. Ihr Atem beschwert sich nicht, wenn sie die Treppe heraufkommt. Der wirklich richtige Fall liegt noch vor ihr im Bett. Die Angelegenheit mit der Dicken kann aber auch eine ganz andere sein, vermutet Hermann. Vielleicht nämlich vermittelte die Arbeitsagentur der Dicken einen Ein-Euro-Job, und deshalb ist sie heute nur vertretungsweise in Hermanns Wohnstraße zu Gange und gibt, wenn ihre Aushilfe beendet sein wird, wieder in der Tafel die übrig gebliebenen Schrippen und die gefleckten Bananen aus dem Discounters an sozial Bedürftige ab. Oder sie macht im Küchenbereich eines Pflegeheimes ihren Job und streitet dort mit der Pflegestufe eins, die das vergorene Dessert verweigert und brüllt die Pflegestufe zwei an, dass beim Essen nicht gekleckert werden darf, und keift mit einem Lappen in der Hand, weil manche der Stufe drei ihren Nachbarn bespucken und dessen Kompott mir nichts dir nichts wegfuttern und dem auch noch die Tablettenschälchen auf dem Nachtisch leeren. Der merkt es gar nicht. Ob sie sich selber aus der Küche des Pflegeheimes versorgt, fragt Hermann. Vielleicht nimmt sie heimlich eine Portion Essen mit nach Hause für ihren Lebenspartner, der seit einiger Zeit auffallend lethargisch in der Wohnung herum hängt und gerade noch den Hund zweimal ausführt, ansonsten am Tage zu nichts mehr richtig Lust hat außer Fernsehen im RTL-Kanal... Hermann schließt den Briefkasten. Er hat genug gesehen und sich genug echauffiert. Er zieht den Schlüssel vom Briefkasten ab und geht zurück ins Haus, in seine Küche, Hochparterre, fünf Stufen, Podest, Windfang. Sanft drückt er das breite Türblatt ins Schloss. Hinter der Tür herrscht die Stille.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Hermann T.»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Hermann T.» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Hermann T.» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.