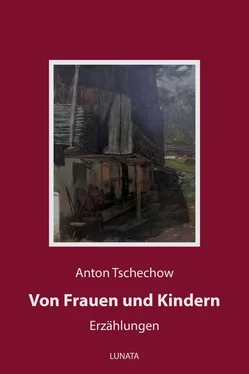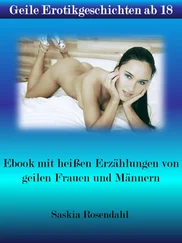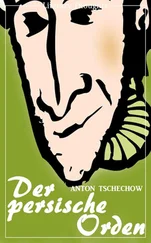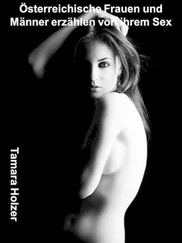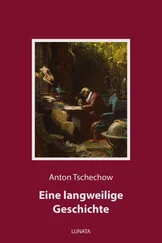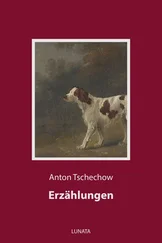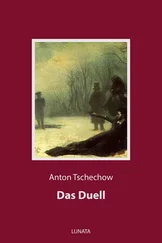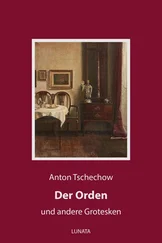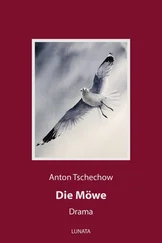»Nikolai, ich verstehe nichts! Was ist los?«
»Hör' nur, was dieser junge Herr erzählt!« sagte Bjeljajew, auf Aljoscha weisend.
Aljoscha wurde erst rot, dann blaß, und sein Gesicht verzerrte sich vor Entsetzen.
»Nikolai Iljitsch!« flüsterte er laut. »Psst!«
Olga Iwanowna blickte erstaunt auf Aljoscha, dann auf Bjeljajew und dann wieder auf Aljoscha.
»Frag' ihn nur!« fuhr Bjeljejew fort. »Deine Pelageja, diese dumme Gans, geht mit den Kindern in Konditoreien und richtet ihnen Zusammenkünfte mit dem Herrn Papa ein. Es handelt sich aber nicht darum, sondern darum, daß der Herr Papa leidet und ich ein Verbrecher und Schurke bin, der euer Leben zerstört hat!«
»Nikolai Iljitsch!« stöhnte Aljoscha. »Sie haben doch Ihr Ehrenwort gegeben!«
»Ach, laß mich in Ruh!« sagte Bjeljajew, mit der Hand abwehrend. »Hier handelt es sich um etwas Wichtigeres als alle Ehrenworte. Mich empört hier die Heuchelei, die Lüge!«
»Ich verstehe gar nichts!« versetzte Olga Iwanowna, und in ihren Augen erglänzten Tränen. »Hör' einmal, Aljoscha,« wandte sie sich an den Sohn: »Kommst du mal mit deinem Vater zusammen?«
Aljoscha hörte nicht auf sie und blickte entsetzt Bjeljajew an.
»Es kann nicht sein!« sagte die Mutter. »Ich will mal die Pelageja ins Gebet nehmen.«
Olga Iwanowna ging hinaus.
»Hören Sie, Sie haben doch Ihr Ehrenwort gegeben!« sagte Aljoscha, am ganzen Leibe zitternd.
Bjeljajew winkte nur mit der Hand und fuhr fort, auf- und abzugehen. Er dachte nur an die ihm zugefügte Kränkung und merkte nicht mehr die Anwesenheit des Jungen. Er, der erwachsene und ernste Mann hatte ganz andere Sorgen. Aljoscha setzte sich aber in eine Ecke und erzählte mit Entsetzen Ssonja, wie man ihn betrogen hatte. Er zitterte, stotterte und weinte; zum erstenmal in seinem Leben war er so roh mit der Lüge zusammengestoßen; bisher hatte er aber nicht gewußt, daß es in dieser Welt, außer den süßen Birnen, Pasteten und teuren Uhren auch noch vieles andere gibt, wofür seine kindliche Sprache keinen Namen hat.
Papa, Mama und Tante Nadja sind nicht zu Hause. Sie sind zur Taufe gefahren zu dem alten Offizier, der immer mit dem kleinen Schimmel fährt. Ihre Rückkehr erwartend, sitzen Grischa, Anja, Aljoscha, Ssonja und der Sohn der Köchin, Andrej, im Speisezimmer am Esstisch und spielen Lotto. Die Wahrheit gesagt, hätten sie schon längst schlafen gehen müssen, aber wie kann man denn einschlafen, ohne von der Mutter erfahren zu haben, was bei der Taufe für ein Kindchen war, und was es zum Abendessen gegeben hat? Der von einer Hängelampe erleuchtete Tisch ist besät mit Ziffern, Nussschalen, Papierschnitzeln und Gläserchen. Vor jedem Spieler liegen zwei Karten und ein Haufen Glasstückchen zum Bedecken der Zahlen. In der Mitte des Tisches steht eine Untertasse mit fünf Einkopekenstücken. Neben der Untertasse ein angebissener Apfel, eine Schere und ein Teller, in den eigentlich die Nussschalen gelegt werden sollen. Die Kinder spielen um Geld. Der Satz ist eine Kopeke. Abmachung: wenn einer mogelt, wird er sofort an die Luft gesetzt. Im Speisezimmer ist außer den Spielern niemand. Die Wärterin, Agafja Iwanowna, sitzt unten in der Küche und zeigt der Köchin das Zuschneiden an, während der ältere Bruder Wassja, seines Zeichens Tertianer, im Salon auf dem Sofa liegt und sich langweilt.
Das Spiel ist aufregend. Die größte Erregung liegt auf dem Gesicht von Grischa. Das ist ein kleiner neunjähriger Junge mit einem kahl geschorenen Kopf, Pausbacken und Lippen, so dick wie bei einem Neger. Er geht schon in die Vorbereitungsschule und gilt darum für den allergrößten und klügsten. Spielen tut er ausschließlich wegen des Geldes. Würden auf der Untertasse keine Kopeken liegen, so hätte er sich schon lange schlafen gelegt. Seine braunen Augen laufen unruhig und neidisch auf den Karten der Partner umher. Die Angst, daß er vielleicht nicht gewinnen könnte, der Neid und finanzielle Erwägungen, die seinen glatten Kopf erfüllen, lassen ihn nicht ruhig sitzen und seine Aufmerksamkeit sammeln. Er dreht sich herum wie auf Nadeln. Wenn er gewonnen hat, ergreift er gierig das Geld und steckt es sofort in die Tasche. Seine Schwester Anja, ein Mädchen von acht Jahren mit einem spitzen Kinn und klugen, glänzenden Augen vergeht auch vor Angst, daß jemand gewinnt. Sie wird bald rot, bald blaß und folgt aufmerksam den Bewegungen der Spieler. Die Kopeken interessieren sie nicht. Glück beim Spiel zu haben ist für sie eine Sache des Ehrgeizes. Die andere Schwester Ssonja, die einen Lockenkopf und einen Teint hat, wie man ihn nur bei sehr gesunden Kindern, teuren Puppen und auf Bonbonnieren findet, spielt nur um des Prozesses des Spiels willen. Ihr Gesicht drückt Entzücken aus. Wer auch gewinnt, sie lacht immer gleich und klatscht in die Hände. Aljoscha, ein dickes, kugelrundes Bürschchen, keucht und pustet und stiert die Karten unverwandt an. Er kennt weder Habsucht noch Ehrgeiz. Man jagt ihn nicht vom Tisch, schickt ihn nicht schlafen – das ist auch schon was wert. Dem Ansehen nach ist er phlegmatisch, im Innern aber eine ziemliche Bestie. Er sitzt da, nicht so sehr um des Lotto willen, als wegen der Missverständnisse, die beim Spiel unvermeidlich sind. Es macht ihm ein unbändiges Vergnügen, wenn einer den andern schlägt oder schimpft. Er müßte aus gewissen Gründen schon lange auf einen Moment weggehen, aber er verläßt den Tisch nicht auf einen Augenblick aus Furcht, daß ihm jemand seine Gläserchen und Kopeken rauben könnte. Da er nur die Einer und die Zahlen, die auf Null endigen, kennt, so bedeckt Anja für ihn die Ziffern. Der fünfte Partner, der Sohn der Köchin, Andrej, ein brünetter, kränklicher Knabe in einer Kattunbluse und mit einem kupfernen Kreuz auf der Brust, steht unbewegt da und schaut die Zahlen nachdenklich an. Gewinn und fremdes Glück haben für ihn keinen Reiz. Er ist ganz versunken in die Arithmetik des Spiels, in die primitive Philosophie desselben; wieviel verschiedene Zahlen gibt es doch auf dieser Welt und wie erstaunlich ist es, daß sie nicht verwechselt werden!
Die Zahlen werden von allen, außer von Ssonja und Aljoscha, ausgerufen. Die dauernde Praxis und die Einförmigkeit haben eine Menge technischer und komischer Ausdrücke für die Zahlen geschaffen, so heißt sieben – Schürhaken, elf – Stäbchen, siebenundsiebzig – Ssemjon Ssemjonowitsch, neunzig – Großpapa usw. Das Spiel geht rüstig vorwärts.
»Zweiunddreißig!« ruft Grischa, die gelben Zylinderchen aus der Mütze des Vaters herausholend. – »Siebzehn! Schürhaken! Achtunddreißig – Grischa heiß ich.«
Anja sah, daß Andrej die achtunddreißig verpaßt hatte. Zu einer anderen Zeit hätte sie ihn darauf aufmerksam gemacht, jetzt aber, wo auf dem Tellerchen neben dem Kopeken auch ihre Eitelkeit liegt, triumphiert sie.
»Dreiundzwanzig!« fährt Grischa fort. – »Ssemjon Ssemjonowitsch! Neun!«
»Ein Schwabe, ein Schwabe!« ruft Ssonja, auf einen über den Tisch laufenden Schwaben weisend. – »Ai! Schlag ihn nicht,« sagt im Basston Aljoscha. »Er hat vielleicht Kinder …«
Ssonja verfolgt mit den Augen den Schwaben und denkt an seine Kinder: was müssen das doch für kleine Schwäbchen sein!
»Dreiundvierzig! Eins!« fährt Grischa fort, unter dem Gedanken leidend, daß Anja schon zwei Reihen hat. »Sechs!«
»Gewonnen! Ich hab' gewonnen!« schreit Ssonja, die Augen kokett verdrehend und lachend.
Die Gesichter der Spieler verlängern sich.
»Kontrollieren!« sagt Grischa, Ssonja voll Haß betrachtend.
Nach dem Recht des Ältesten und Klügsten hat Grischa sich die entscheidende Stimme erobert. Was er sagt, wird getan. Ssonja wird einer langen und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, und zum größten Leidwesen aller Mitspieler zeigt es sich, daß sie nicht gemogelt hat. Die nächste Partie beginnt.
Читать дальше