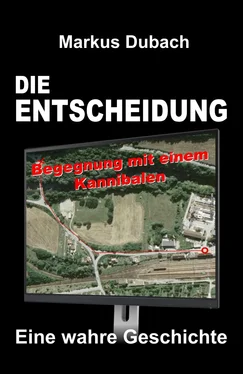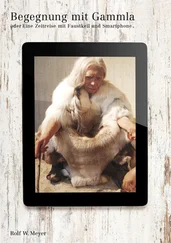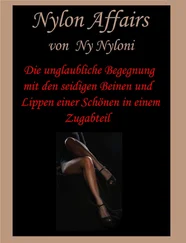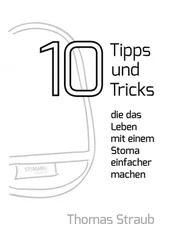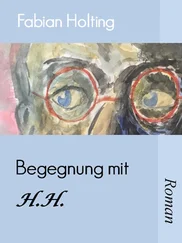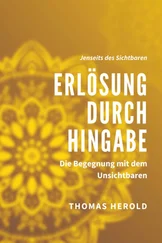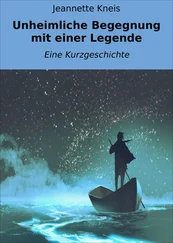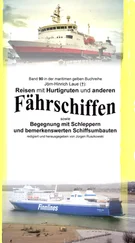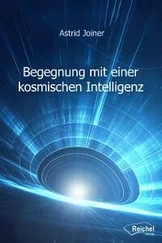Im Bekannten- und Freundeskreis ist die Betroffenheit groß: »Das würde man überhaupt nicht denken, dass du Krebs hast. Du siehst doch so gesund und sportlich aus.« Einige sind überfordert: »Bitte sag nichts mehr, ich will nichts mehr davon hören.«
Um mich trotzdem austauschen zu können, suche ich deshalb Kontakte in einem Krebsforum im Internet. Was ich da an Schicksalen mitbekomme, erschüttert mich sehr, gerade weil ich ja selber davon betroffen bin. Ich werde mit Ratschlägen, Ermutigungen und Trost unterstützt. Ich solle meine Diagnose nicht als Todesurteil auffassen, sondern hätte großes Glück gehabt, dass mein Tumor in einem so frühen Stadium entdeckt wurde.
Die überwiegende Zahl der Kontakte im Krebsforum sind hilfreich, allerdings auch beängstigend und bedrückend, sind doch hier hauptsächlich Patienten anzutreffen, die es schlimm erwischt hat. So ist da ein Mann, mit dem ich eines Abends chatte und der ein paar Tage später stirbt. Oder die Patientin mittleren Alters, die sich aufopfernd um alle Neuankömmlinge im Forum kümmerte, sich deren Ängsten angenommen und ihnen Mut gemacht hat und die dann erfahren muss, wie ihre eigenen Hoffnungen brutal zerschmettert werden. So etwas vergisst man nie mehr.
Unter dem Eindruck dieser Erlebnisse klammere ich mich umso mehr an das kommende Staging , in der Hoffnung, dieses möge Entwarnung geben. Bei Krebs – insbesondere Hautkrebs – gibt es nämlich nur schwarz oder weiß: entweder man überlebt die Krankheit oder man stirbt daran; das Staging zeigt an, auf welcher Seite man steht. Könnte man Krebs in eine chronische Krankheit verwandeln, wäre damit viel gewonnen. Leider ist das nur bei einer Handvoll Krebsarten möglich. Schwarzer Hautkrebs gehört definitiv nicht dazu.
1.1.2. Erster Spitalaufenthalt
27. September: Spitaleintritt
Heute werde ich um 9 Uhr in der dermatologischen Klinik des Inselspitals aufgenommen. Da ich kaum Erfahrung mit Spitalaufenthalten habe, bin ich sehr nervös. Eine Krankenschwester holt mich ab und weist mich ein. Ich erhalte ein Bett in einem Viererzimmer, in dem allerdings nur zwei Betten belegt sind.
Etwas später kommen zwei Ärzte zur Visite. Ich bombardiere sie mit Fragen zur Krankheit und zum Verlauf meines Aufenthaltes. Ich soll optimistisch bleiben und mir im Moment keine zu große Sorgen machen, meint einer der Ärzte. Das ist leichter gesagt als getan.
Im Verlauf des Tages erfolgen verschiedene Untersuchungen wie Hautscreening, Bluttests etc.
Am Abend informiert mich die Chirurgin, die mich operieren wird, über den Ablauf der am nächsten Tag stattfindenden Operation. Sie erklärt mir unter anderem, dass ich mich als geheilt betrachten dürfe, sollte man keine Ausbreitung des Tumors feststellen können. Entscheidend sei, dass die für das Tumorgebiet verantwortlichen Lymphknoten – sogenannte Wächterlymphknoten [2]– nicht mit Krebszellen befallen sind. Um das festzustellen, müssten diese histologisch untersucht werden und dazu muss man sie zuerst entfernen.
Wie findet man nun diese Lymphknoten? Dazu wird eine radioaktive Substanz ins Hautgewebe um den Tumor gespritzt und dann beobachtet, entlang welcher Lymphbahnen die Substanz abfließt.
Ich erhalte also mehrere Spritzen ins Umgebungsgebiet des Tumors. Außer einem Brennen merke ich davon nicht viel. Danach lege ich mich auf eine Bank und eine Krankenschwester positioniert das Gerät, das die radioaktiven Strahlen aufzeichnet, nahe des Brustkorbes. Sie fragt mich, ob ich das Geschehen beobachten wolle und dreht den Monitor, damit ich das Bild sehen kann. In der Mitte ist eine relativ große, rundliche und leuchtende Fläche zu erkennen. Die Schwester erklärt mir, dass es sich um das Gebiet handelt, in das soeben die radioaktive Substanz gespritzt wurde. Von dort würden nun eine oder auch mehrere leuchtende Bahnen zu den Achselhöhlen entstehen, wo sich die Wächterlymphknoten befinden. Sie schaltet Musik ein und verlässt den Raum.
Es dauert etwa zehn Minuten, dann erkenne ich deutlich zwei gebogene leuchtende Linien, die sich in entgegengesetzter Richtung verlängern. Das bedeutet nichts Gutes, denn man wird mich nun auf beiden Seiten operieren müssen. Ich frage mich, was wohl sein wird, wenn man befallene Lymphknoten in beiden Achselhöhlen findet. Dann werden gemäß den aktuellen Richtlinien beidseitig alle Lymphknoten ausgeräumt. Das hätte erhebliche Einschränkungen für meine bisherige Lebensweise zur Folge, könnten doch im schlimmsten Fall in beiden Armen Lymphödeme entstehen. Ich bin den Tränen nahe. Ich erinnere mich an die Leiterin [3]meines Kinderheims, die auch an Krebs erkrankt und daran gestorben ist und bei der sich infolge Lymphknotenausräumung ein Ödem gebildet hat. Ihr Arm ist mit der Zeit stark angeschwollen und zuletzt musste sie diesen in eine Armschleife legen. Nicht nur, dass der Arm schmerzte, sie konnte am Schluss mit ihm auch überhaupt nichts mehr machen. Ich bekomme es mit der Angst zu tun.
Die Krankenschwester kommt wieder in den Raum zurück und sieht sich das Bild an: »Das habe ich befürchtet. Die Lymphe fließt auf beide Seiten ab.« Der Tumor befinde sich mittig auf der Wirbelsäule, sagt sie, und daher sei dieses Resultat nicht erstaunlich. »Seien Sie aber froh, dass der Tumor sich im Bereich des oberen Rückens befindet, sonst hätten wir schlimmstenfalls auch noch Lymphknoten in der Leiste entfernen müssen.« Das ist für mich ein schwacher Trost, aber immerhin. »Gleich werden zwei Ärzte vorbeikommen und die Wächterlymphknoten auf der Haut markieren.«
Einige Zeit später tauchen die Ärzte auf und erklären die nächsten Schritte. Mit einer Sonde – einer Art Geigerzähler – fahren sie über die Haut unter den Achseln und markieren die Stellen, wo der Zähler heftig ausschlägt. »Da befindet sich jeweils ein Wächterlymphknoten, welcher Ihnen herausoperiert werden wird.«
Auf der rechten Seite finden sie nur eine Stelle, links ist die Situation etwas komplizierter. Einerseits scheinen die Stellen mit starker Strahlung nicht so eindeutig zu sein, andererseits sind es mehrere über ein relativ großes Gebiet verteilt. Sie markieren letztlich rechts eine und links drei Stellen mit starker radioaktiver Strahlung.
Nach getaner Arbeit kehre ich markiert mit blauen Punkten unter den Armen in das Krankenzimmer zurück.
28. September, nachmittags
Da ich nun schon seit dem Vorabend nichts mehr essen und seit dem Aufstehen nichts mehr trinken darf, fühle ich mich zusehends unwohl und bin froh, dass die Operation bald erfolgen wird. Nach dem Mittag erhalte ich eine Pille, die mich schläfrig macht und ein angenehmes leicht schwebendes Gefühl auslöst. Kurz danach werde ich im Bett durch viele Gänge geschoben und komme schließlich in einem breiten und hellen Korridor an, in dem sich Tür an Tür reiht. Das werden wohl die Operationssäle sein. Hoffentlich werde ich in den richtigen gefahren.
Noch bevor ich mich beunruhigen kann, werde ich schon vom Anästhesisten mit Namen angesprochen: »Guten Tag, Herr Dubach, haben Sie gut geschlafen?«
»Ja, danke, ich werde ja gleich wieder einschlafen.«
Alle lachen und ich bin beruhigt, dass ich mich wohl im richtigen Operationssaal befinde. Kurz danach erhalte ich das Narkosemittel und sehe noch, wie die Decke verschwimmt. Dann verliere ich das Bewusstsein.
Ich höre, wie jemand meinen Namen ruft: »Herr Dubach, hallo, Herr Dubach.«
Ich öffne die Augen und sehe den Anästhesisten. Ach ja, ich bin im Operationssaal, erinnere ich mich. Es sei alles gut gegangen, nehme ich erleichtert zur Kenntnis. Ich werde erst später die Bedeutung dieser Aussage richtig begreifen. Danach geht es zurück ins Krankenzimmer.
Читать дальше