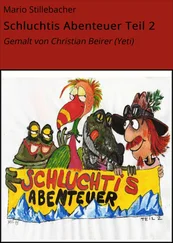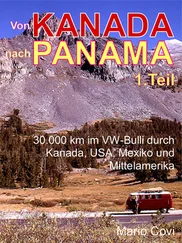Am folgenden Tag erfuhren wir, dass Banditen aus Sapele im friedlichen Koko ihr Unwesen trieben. Sie hätten einen Überfall auf die Lagerschuppen an der Pier vorgehabt, seien aber von Polizisten vertrieben worden.
Es kursierte eine Story über einen russischen Frachter, der vor einigen Jahren in Sapele von einer schwerbewaffneten Räuberbande geentert wurde. Es war noch lange vor Glasnost und Perestroika, also leistete sich das System vollbesetzte Schiffe. So gelang es den Männern der Nachtwache, die Piraten in einem Teil der Aufbauten einzukesseln und fertig zu machen. Der Kapitän ließ die Leinen kappen, fuhr ohne Lotsen durchs Nigerdelta seewärts und meldete über Funk jeweils die Position, wo er in provozierenden Abständen einen der insgesamt acht oder neun Banditen über Bord werfen ließ. Tot. Erschossen oder erschlagen, ich weiß es nicht...
Die Regenzeit floss träge dahin wie der düstere Benin, der in den frühen Morgenstunden als dunstverschmierte Fläche um unser Schiff lag. Alles war klamm und feucht, der Urwald ein stetes Tropfen und Triefen. Über den höchsten Baumriesen segelten Nebelfetzen, waberten Wolken, legten sich wie nasse Lappen über knorriges Astwerk. In der tropfnassen Tiefe dieses Waldes hatte vor ein paar Tagen ein Einheimischer auf der Pirsch nach Ducker-Antilopen eine Begegnung mit einem Gorilla, der ihn so entsetzlich zurichtete, dass er wohl nie wieder wird jagen können.
Es war reizvoll, der ungestümen tropischen Natur so nahe zu sein, mit all ihrem furchterregenden Schrecknis. Aber oft erkennt man Reize erst, wenn sie räumlich oder zeitlich passiert sind, falls der versteckte Zauber überhaupt spürbar wurde... Viele von uns waren mürrisch, maulten, die bedrückende Warterei in einem noch bedrückenderen Klima legte sich aufs Gemüt.

Sicher, da war ein sonniger Sonntag, wir puckerten mit dem Rettungsboot auf verschlungenen Wasserläufen hinein in eine wilde Landschaft, in ein paar Stunden verwegenen Lebens! Sonnenverbrannt und biertrunken kamen wir uns wie Abenteurer, wie gutmütig-draufgängerische Sonntags-Söldner vor. Wir alberten mit der Leuchtpistole herum, die wir für alle Fälle mitgenommen hatten, kamen uns beim Ballern echt tollkühn vor. Wir staunten aber auch, wie armselig das Leben im Busch sein kann. Wir sahen Hütten, die inmitten moskitoverseuchten Sumpfgrasröhrichts im Wasser standen. Und wenn sie auf festem Grund erbaut waren, fand sich Wasser nur fußabdrucktief darunter. Zwischen drohenden Drachenbaumdschungeln und dem wirren Wurzelwerk der Mangroven wurde der Mensch nur geduldet. Wir lachten mit den Bewohnern des schwankenden Sumpflandes, verschenkten mitgenommene Koteletts, versuchten Palmwein und "African Gin" und stellten fest, dass Afrikaner gastfreundliche, lebensfrohe Menschen sind, - und keineswegs nur Banditen oder korrupte Beamte!
Doch dann herrschte wieder angespannte Stimmung. Der Koch hatte keine Lust mehr, einer aus der Maschine stänkerte dauernd, legt sich mit dem Chief an, mimte schließlich krank. Neben uns ankerte ein kleinerer Frachter, ein nach Panama ausgeflaggter Holländer. Kapitän, Chief und Erster Steuermann waren Niederländer, das restliche Dutzend der Besatzung kam von den Kap-Verde-Inseln. Als der Erste anfing durchzudrehen, wurde er auf dem schnellsten Wege in die Heimat geflogen. „Was soll ich mit einem ‚Chief-Mate‘, der den Tropenkoller hat?“ - so der Kapitän während eines Klönschnacks am UKW-Sprechfunkgerät.
Einige Tage später klang seine Stimme ernst und gehetzt: Unser Rettungsboot sei doch motorisiert und rasch zu Wasser zu lassen? Der Elektriker sei über die Kante gegangen, vor aller Augen, einfach so – und er sei doch Nichtschwimmer!
Die Suche blieb erfolglos. Nach drei Tagen rief uns ein Fischer aus seinem Einbaum zu, er habe flussabwärts die Leiche entdeckt. So konnten die grausam stinkenden Überreste des Insulaners geborgen werden, den irgendwelche, wohl für immer unbekannt bleibende Beweggründe ins Wasser getrieben hatten. In einer Persenning hing dann der Tote noch tagelang am weit außenbords geschwenkten Ladebaum des Frachters, bis der träge Behördenapparat endlich die Überführung des aufgedunsenen Körpers in ein Leichenhaus veranlasste. Zwecks Obduktion! Da es sich um einen Afrikaner handelte bestand der Verdacht, dass weiße Herrenmentalität den schwarzen geknechteten Bruder in den Tod getrieben hatte. Afrikanische Behördenarroganz trieb in verletzender Selbstgefälligkeit wieder mal schikanösen Schabernack – und lag dennoch gar nicht so falsch. Denn auf einigen Schiffen herrschten durchaus kolonialistische Herren-Knecht-Verhältnisse. Ich entsinne mich eines zufällig ebenfalls holländischen Kapitäns an der Küste Gabuns. Selbstgefällig hatte er damit geprahlt, für seine schwarze Crew nur noch billiges Hundefutter zu verarbeiten: „Die fressen das mit wahrer Begeisterung! Denen glänzt richtig das Fell!“
Auf unserem Nachbarschiff hatten wir aber das gute Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen kennen gelernt. Der Tote selbst bereitete den bürokratischen Triezereien ein Ende. Er war so stark in Verwesung übergegangen, dass die Beamten – nach dem üblichen Whiskyflaschen- und Zigarettenstangen-Bakschisch – strahlend zur Überzeugung gelangten, es sei doch angebrachter, den Toten endlich zu bestatten...
Als die Beerdigung stattfand war unser Kapitän der einzige weiße Teilnehmer. Ich war zutiefst erstaunt über dieses Mitgefühl am Schicksal eines unbekannten Seemanns. Ich war beschämt, denn unser Alter war nicht gerade beliebt an Bord. Wir empfanden ihn als knorzeligen Beamtentyp, auf leise Art zynisch und voll gestrigen Gedankenguts. Wir verdächtigten ihn der heimlichen Süffelei und verachteten ihn, weil er moralisch aufkreischend den Stecker aus der Wand riss, wenn wir mit "all hands" in der Messe hockten und in verzweifelter Geilheit die Pornofilme des Zweiten Ingenieurs anschauten.
Auch ein Wartetörn von einem Monat ist irgendwann vorbei. Wir hievten Anker und auf der Weiterfahrt nach Sapele saßen wir prompt zweimal fest. Der Lotse hatte den ihm vertrauten Kurs gesteuert. Zuvor waren wir von einem griechischen Kapitän vor den sich verändernden Sandbänken gewarnt worden. Unser Kapitän hatte mich zu einer umständlichen Dienstfahrt mit Boot und Buschtaxi nach Sapele mitgenommen. Dort hatte uns der Grieche leidenschaftlich ermahnt: „Don’t go this way!“ Dabei zeigte er uns einen Kurs auf der Flusskarte, der bislang als einzig sicherer Weg über die Untiefen galt. „Hier müssen Sie längs!“, war er fortgefahren und hatte brutal eine Kurslinie über die Sandbank gezeichnet. „Die Sandbank hat sich verlagert, glauben Sie mir! Nur die Lotsen wissen das noch nicht!“

Nun war unser Kapitän in seiner zaudernden Art doch den alten Kurs gefahren, und als der Pott plötzlich festsaß, war das Geschrei groß. Doch trotz dieser Ärgernisse erreichten wir Sapele unbeschadet.
Als wir nach Löschende seewärts durch den Dschungel tuckerten, sahen wir bei Youngtown, wo der Nana-Creek abzweigt, einen großen japanischen Frachter auf Scheiße sitzen. Aber so richtig hoch und trocken!
5. VOM REGEN IN DIE TRAUFE
Einen Monat lang hatten wir im Nigerdelta vor uns hin gegammelt. Nun aber wehte der lang entbehrte Fahrtwind der offenen See in unsere erwartungsvollen Gesichter. Wir fühlten uns frei und erhofften eine neue Reise-Order, die uns dorthin führen sollte, wo Hein Seemanns Träume wenigstens ein bisschen erfüllt würden... Doch leicht geriet man vom Regen in die Traufe, denn unser nächster Hafen hieß – Lagos! Glücklicherweise dauerte die Wartezeit auf Reede nur einige Tage, dann ging’s an die Pier. Dort schlug uns wieder jene Atmosphäre entgegen, die Lagos zum Albtraum werden ließ: Dreck und Gestank, Korruption, Misswirtschaft, Kriminalität. Die altbekannte Litanei!
Читать дальше