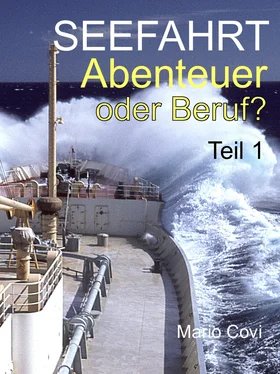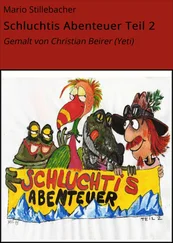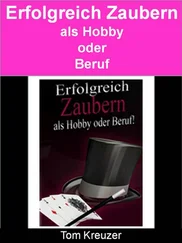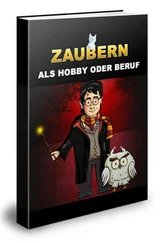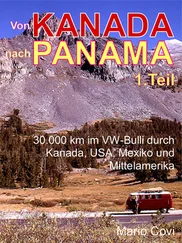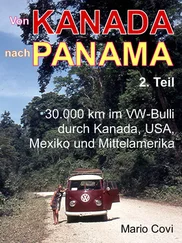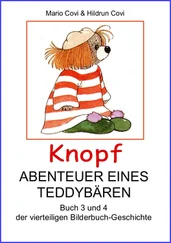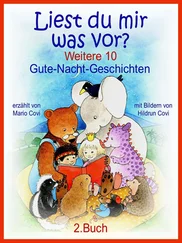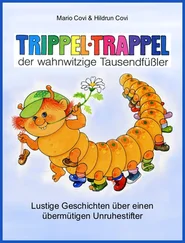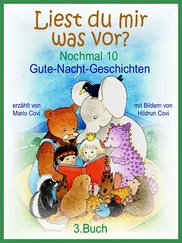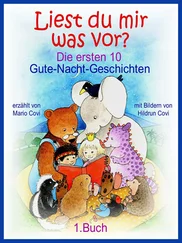Ich gebe es ja zu, was war das oft für ‘n Schiet und Dreck auf diesen Rattendampfern! Auf der "Schürbek" hieß es zweimal täglich: „Rohre blasen!" Dann quoll aus dem Schornstein eine fette schwarze Rußwolke. Heizerflöhe rieselten über Deck, in die Aufbauten, wo man auch hin fasste, die Hände wurden schwarz. Der Zossen qualmte normalerweise schon so erbärmlich, dass die Crew, die achtern hauste, regelrecht geräuchert wurde.

Einmal fiel die Dampfdruck-Ruderanlage aus, und der Schlitten musste mit dem Notruder über den Atlantik gesteuert werden. Dieses aber stand auf der Poop, dem erhöhten Achterdeck. Und dort durfte der Rudergänger an dem rustikalen Speichenrad drehen, umweht von Qualm und Ruß, das Rauschen von Palmen und südamerikanischen Mädchenröcken noch im Ohr. Ganz im Sinne eiserner Traditionalisten, die mit der Erfindung des Ruderhauses den endgültigen Untergang der Seefahrt heraufdämmern sahen. Gemäß dem Lehrsatz von den hölzernen Schiffen und den eisernen Seeleuten. Aber die Zeiten, da Jan und Hein noch nach Tang und Teer rochen, sind vorbei. Heute muffeln sie eher nach Maschinenöl, nach Verdünnung und Schweiß und, landfein gemacht, nach all den zollfreien Duftwässerchen aus dem Kantinen-Store.

Zurück zum M/S "Bernhard-S". Die Kammern waren hübsch eingerichtet, sogar mit ausziehbarer Koje. Jedenfalls bei den Offizieren. Das war im Allgemeinen immer noch die Ausnahme. Es schien nicht möglich zu sein, Kajüten so zu gestalten, dass bei einer Mitreise von Frauen und Kindern das Wohnen nicht zum Camping wurde. Mit improvisierten Feldlagern auf dem Boden und Kinderbetten aus zusammengeschobenen Stühlen. Die Skandinavier hatten uns da einiges voraus!
Manchmal kam es mir so vor, als sprächen Schiffskonstrukteure und Werften den Seeleuten jegliches Bedürfnis nach Lebensqualität von vornherein ab. Wenn Kajüten und Kojen auf kleinen Schiffen zwangsläufig schmal waren, musste man damit klarkommen. Yachtähnliche Enge konnte urgemütlich und voller Seefahrtsromantik sein. Auf einem kleinen Hochseeschlepper hatte ich eine Kajüte von vier Quadratmetern mit dem Dritten Offizier geteilt, ohne unglücklich zu sein. Unsere Kammer war derart eng, dass man nicht nebeneinander stehen konnte. Auf geräumigen Frachtern von 10 000 BRT indes standen mir manchmal nicht viel größere Kabinen zur Verfügung. Kajüten mit getrenntem Schlafraum gab es nur für die "heiligen drei Könige", den Alten, den Chief (Leitender Ingenieur) und den Ersten Offizier. Als ob die heilige Tradition der Bordhierarchie in den Konstruktionsbüros der Schiffswerften hätte verteidigt werden müssen. Wenn die Seeleute schon keine Uniformen mehr trugen und sich gleichmacherische Denkweise breit zu machen drohte, musste der Dienstgrad wenigstens an der Kojenbreite abzulesen sein: 120 Zentimeter für Kapitän, Chief und Ersten, 90 Zentimeter für die übrigen Schiffsoffiziere und 80 Zentimeter für die Mannschaft!
Klar, da gab es soziale Schutzgesetze und ein Sammelsurium von Verordnungen, das wäre doch gelacht! Oft waren sie uralt, stammten aus den Zeiten der Tiefwassersegler und hatten erst in den 1970-er Jahren einen zeitgemäßen Beschnitt erhalten. Etwa das löbliche Versprechen einer Wohnraumverordnung, demzufolge jedem Besatzungsmitglied vierzehntäglich frische Bettwäsche und wöchentlich mindestens zwei frische Handtücher zur Verfügung zu stellen war. Und Matratzen durften nicht mehr mit Stroh gefüllt sein!
Natürlich blieb die Bedeutung dieser längst fälligen Verordnungen ungeschmälert, man denke nur an die hunderttausend zu berücksichtigenden Dinge auf einem Schiff. Aber es blieben auch die Fragen vieler Seeleute, wo denn wirkliche Verbesserungen spürbar geworden waren und warum nicht nachdrücklicher kontrolliert wurde.
Ein Kapitän erzählte mir von einem Kühlschiff, dessen Vibrationen so enorm waren, dass man an manchen Stellen an Deck nach einer gewissen Zeit einfach ohnmächtig wurde. „Wenn man diese Ecken genau kannte, konnte man als Erster Offizier widerspenstige Matrosen leicht zähmen“, bemerkte er grinsend.
Auf einem sechs Monate alten Containerschiff schwollen einem Besatzungsmitglied die Hoden derart an, dass er an ein bösartiges Souvenir vom Karneval auf Trinidad glaubte, wo das Schiff zehn Tage gelegen hatte. Erst nach langwierigen Untersuchungen in Deutschland stellte man fest, dass rein platonische Vibrationen die Ursache gewesen war. Das wäre auf der alten "Schürbek" nicht passiert. Die Dampfmaschine drehte so sacht und langsam, dass man das Auslaufen leicht verschlafen konnte.
Einer wusste über seine Zeit auf einem dreiundzwanzig Knoten schnellen Bananenjäger zu berichten, auf dem Vibrationen den Alltag bestimmten: „Auf der Brücke konnte man kein Schiffstagebuch schreiben, in der Kammer konntest du keine Flasche Bier auf den Tisch stellen, im Aufenthaltsraum Mühle, Dame oder Schach zu spielen, alles unmöglich! Bei Schlechtwetter holte der Dampfer 35 oder 40 Grad über, bei einer Rollperiode von sieben Sekunden! Da klatschte dem Funker die Funkstation so von der Wand. In der Kammer versperrte dir losgerissenes Mobiliar den Weg, in der Dusche lösten sich die Fliesen und an Deck riss die Ersatzschiffsschraube aus ihrer Verankerung und rutsche über die Kante..."
Eigentlich müssten Schiffbauer und Reeder zwischendurch ein Pflichtjahr auf so einem Schiff abdienen, um das mal selber zu erleben, war unser Resümee nach diesem Gespräch.
Doch was soll’s, auch die miesen Zeiten auf See gehörten zum Abenteuer Leben! Wir wollten ja unbedingt hinaus, hinter den Horizont, irgendeiner unsäglichen Freiheit nachjagen. Und was schon hätte uns letztendlich wirklich davon abgehalten, zur See zu fahren? Wahrscheinlich die heutige Situation, die einem Ende der Handelsmarine unter deutscher Flagge gleichkommt. Nun ja, damals, auf den alten Pötten, schrieb man Seeschifffahrt noch mit zwei F!
Ende Februar 1981 lag die "Bernhard-S" vor Alexandria. Zirka 50 bis 55 Schiffe dümpelten mit ihr am Schlickhaken. "Alex", Ägyptens größter Hafen, war völlig verstopft, seine Kapazität dem Ladungsaufgebot nicht mehr gewachsen. Das war und ist in vielen Häfen dieser Welt so, überall dort, wo ein riesiges Hinterland über ein viel zu enges Einfallstor versorgt werden muss. Zum Beispiel Djidda in Saudi-Arabien oder Lagos in Nigeria. Letzterer Hafen war jahrelang ein Albtraum für Seeleute.

Vor Lagos hatten zeitweise mehr als 250 Schiffe geankert und nicht nur Tage oder Wochen gewartet. Sie lagen dort drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate. Es gab sogar still vor sich hin gammelnde Rattendampfer, die es auf ganze zwei Jahre Wartezeit brachten. Ein paar von diesen Seelenverkäufern endeten als heimlich verlassene Wracks, deren Ladung längst unbrauchbar geworden war. Ich entsinne mich an einen auf Grund gesetzten Frachter von dem nur noch die Masten und der Schornstein aus dem Wasser schauten.
Nigeria hatte in seinem Petrodollarrausch Zement in derart größenwahnsinnigen Mengen bestellt, dass eine Entladung der Frachter-Armada in absehbarer Zeit nicht in Aussicht stand. Man erzählte sich haarsträubende Halsabschneider-Döntjes über kaltschnäuzige Geschäftemacher. Diese, meist levantinisch-griechischer Provenienz, kauften zunächst von irgendeiner gottverlassenen Abwrack-Werft einen billigen Schrottkahn. Hauptsache, der Zossen schaffte die georderte Zementladung gerade noch bis Lagos-Reede. Dann meldete der Kapitän und Eigner sein Schiff bei den Hafenbehörden löschklar. Die Antwort war so lapidar wie erhofft: „Ihr Schiff wird irgendwann – any time from now – zum Löschen aufgefordert werden. Sie hören von uns ...“
Читать дальше