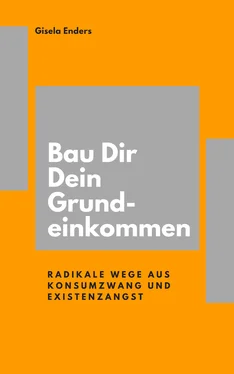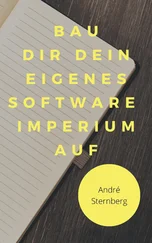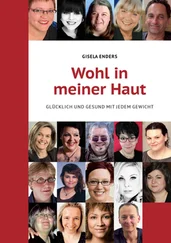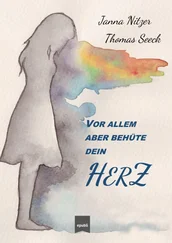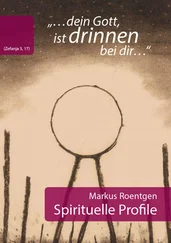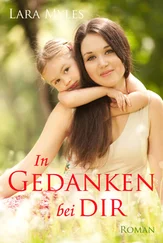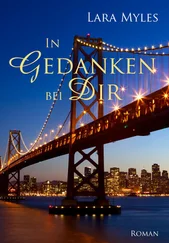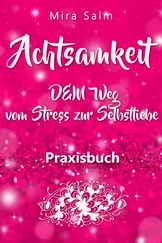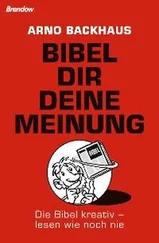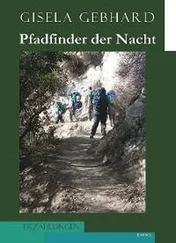Ich habe auch mit Menschen zu tun, bei denen sich die Ausgaben schneller entwickeln, als die Einnahmen. Logisch, dass sich hier der Druck, auf jeden Fall die Stelle zu behalten, nochmals erhöht. Bei meinen Selbständigen erlebe ich auch viel Druck. Oft werden die Angebote und Preise in der Gründungsphase nach den Lebenshaltungskosten festgelegt. Das Ziel sind monatlich 6.000 €, also braucht es entsprechend monatlich 60 Stunden, die für 100 € verkauft werden. Logisch, dass der Druck steigt, wenn es nicht genügend Kunden gibt, die diese Stunden in Anspruch nehmen und bezahlen. Hier entsteht dann gerne ein anstrengender Teufelskreis: Der Kunde spürt, dass er dringend gebraucht wird. Man will aber nicht händeringend für die Einkünfte eines Anderen zuständig sein, sondern frei die entsprechende Dienstleistung in Anspruch nehmen, wenn man diese eben gerade braucht. Ohne Verpflichtung und ohne schlechtes Gewissen, wenn man sich aus welchen Gründen auch immer abwendet. Um keine Verpflichtung einzugehen, bucht man die Dienstleistung bereits beim ersten Mal nicht oder bleibt, wenn man den Druck erst später unbewusst spürt, dann schnell weg. Die Existenzangst steigt.
Viele Menschen sorgen sich um die Sicherheit ihrer Arbeitsstelle bzw. ihres Einkommens. Bei Selbständigen ist dies meist präsenter, bei Angestellten wird es immer dann ein Thema, wenn die Firma sich verkleinern muss oder wenn sich der Standort verändern soll oder wenn es keinen geeigneten Nachfolger für die jetzigen Inhaberinnen gibt. Immer dann – und wahrscheinlich noch in vielen anderen Situationen – wird das eigene Lebenskonstrukt in Frage gestellt. Die Frage ist simpel: Kann ich mir mit Lohnersatzleistungen meinen Lebensstil leisten und werde ich wieder was Neues finden? Für viele kommt hier eine reale Existenzangst ins Spiel.
Unsere Arbeitssicherheit wird sich in Zukunft durch weitere Automatisierung und Digitalisierung noch verringern. Es wird einfach weniger Arbeit geben, für die Unternehmen oder Andere bereit sind, zu zahlen. Aus diesen Zukunftsaussichten und sicherlich auch aus einer Unzufriedenheit, dass Arbeit heute für viele nur noch schlichte Notwendigkeit zum Überleben ist, entstand und entsteht immer mehr eine wachsende Bewegung, die das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland und in vielen anderen Ländern fordert. Zur Bundestagswahl 2017 ist zum ersten Mal eine Parteimit dieser Botschaft angetreten. Ein Signal an alle anderen Parteien, sich diesem Thema zuzuwenden und es nicht als Phantasterei abzutun.
In den jüngeren Generationen wird außerdem der Wert der Arbeit immer mehr in Frage gestellt. Die Nachkriegsjahre in denen eifrig aufgebaut und damit gearbeitet wurde, sind vorbei. Auch die Generation aus den etwa 70ger Jahren im Westen und im Osten noch früher – bei denen Männer wie Frauen gearbeitet und Kinder großgezogen haben, wird heute teilweise kritisch angeschaut. Einfach, weil wenig Zeit für die eigene Person, für das eigene Leben blieb. Muss man sein gesamtes Leben – bis auf die Randzeiten der Kindheit und der Rente – wirklich dem stetigen Arbeitsleben widmen? Freiheiten wie Arbeitszeiten zu Hause, mehr Urlaubstage und flexible Arbeitsformen werden bei der Wahl der Stelle wichtiger. Besonders bei denen, bei denen sich bereits ein Bewerbermangel auf Stellen bemerkbar macht und die sich entsprechend erlauben dürfen, Forderungen an ihr Stellenprofil zu stellen. Dazu kommt ein immer kritischerer Blick auf viele Arbeitsstellen, die heute so angeboten werden. Macht es wirklich Sinn, Werbung zu gestalten für Produkte, die ich gar nicht kaufen will? Macht es Sinn, in welcher Form auch immer an der Pestizidproduktion, an Waffenproduktionen oder am Abbau von Braunkohle beteiligt zu sein? Machen wir unsere Welt damit wirklich besser? Wie absurd wird es dann erst, wenn bestimmte Praktiken unbedingt beibehalten werden sollen, wie beispielsweise den Braunkohleabbau, nur um Arbeitsplätze zu schützen. Kein Wunder, dass sich gegen die Arbeitswelt immer mehr leiser Widerstand regt. Konkret in dem Ziel vieler Menschen, sich anständige Stellen zu suchen. Jobs mit Sinn haben Konjunktur, denn man muss ja schließlich irgendwas machen.
Einige gehen noch radikaler heran. Sie bauen an ihrem eigenen Grundeinkommen. Sie gestalten ihr Leben anders, als es vom Mainstream als normal wahrgenommen wird. Mich faszinieren diese individuellen Lösungen sehr. Ursprünglich habe ich Menschen gesucht, die die finanzielle Freiheit angestrebt haben. Erst dachte ich, diese Menschen haben komplett ausgesorgt, müssen nie wieder was machen und verbringen ihre Tage im Süden. Im Rahmen vieler Gespräche bin ich schlauer geworden. Ich habe mich viel über den Sinn der finanziellen Freiheit ausgetauscht und sehr genau hingeschaut, warum Menschen dies machen. Es geht ihnen um die Freiheit, selbst entscheiden zu dürfen, nicht von einem Arbeitgeber oder Kundinnen abhängig zu sein und auch keine Existenzangst empfinden zu müssen. Dabei ging es fast nie um unendlichen Reichtum, nicht mal um ein luxuriöses Leben. Luxus ist Zeit und Selbstbestimmung. Je intensiver ich mich mit dem Thema befasst habe, desto mehr kam für mich die Erkenntnis, dass hier die Zielstellungen des bedingungslosen Grundeinkommens von einzelnen Menschen individuell verwirklicht wurden. Meine Gesprächspartner haben nicht auf eine staatliche Entscheidung für ein generelles Grundeinkommen gewartet. Stattdessen haben sie ihr Leben so gestaltet, dass sie auf der einen Seite wenig Geld brauchen und auf der anderen Seite genügend Geld da ist, um sparsam aus den Erträgen zu leben.
Wir alle arbeiten übrigens an unserem eigenen bedingungslosen Grundeinkommen. Je nach Anstrengung und Aufwand wird es höher oder niedriger ausfallen, wir haben auch das Risiko, dass wir es nicht erleben werden. Wenn wir es erleben, nennen wir es Rente. Für diese Rente haben wir investiert. Teilweise hat dies der Staat für uns übernommen und gleich den Rentenbeitrag von unserem Gehalt eingezogen. Teilweise hat dies auch noch der Betrieb unterstützt, für den wir arbeiten und in eine Betriebsrente eingezahlt. Und zunehmend werden wir auch selbst in die Pflicht genommen und zahlen in unserem aktiven Berufsleben in eine private Altersvorsorge ein. Wenn wir gut gerechnet haben, dann entsteht irgendwann die finanzielle Freiheit. Nämlich der Zustand, dass wir mit unseren Einkommen aus der Altersvorsorge unsere Lebenshaltungskosten decken können. Haben wir zu knapp kalkuliert, dann verfügen wir auch nach 65 oder 67 nur über ein Grundeinkommen und müssen uns wahlweise in unserem Lebensstandard einschränken oder eben doch noch dazuverdienen. Wir sind es also alle gewöhnt, für unsere finanzielle Freiheit oder unser Grundeinkommen zu arbeiten. Der gesellschaftliche Konsens sieht dafür eine Altersgrenze um die 65 vor. Die wird sich in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich eher nach oben verschieben. Das soll einzelne aber nicht daran hindern, die eigene Grenze weiter nach vorne zu schieben. Mit einem Grundeinkommen ist es eben auch schon möglich mit 35 mit der klassischen Erwerbsarbeit, dem Zwang arbeiten zu müssen, auszusteigen. Oder eben mit 40, mit 45 und für viele ist es auch ein Traum sich dies mit 55 oder 60 verwirklichen zu können. Und da man in diesem Alter hoffentlich gerne noch aktiv ist, reicht sozusagen die Grundrente. Denn es wird sich, vielleicht nach einer Zeit des Ausruhens, wieder ein Modus einstellen, in dem man Lust hat, was zu machen. Zumindest war das bei fast allen Menschen so, mit denen ich im Laufe meiner Recherche sprechen durfte.
Gerne stelle ich meine Gesprächspartner hier kurz vor. Sie werden im Laufe des Buches immer wieder über ihren Weg und von ihren Erfahrungen berichten. Die Interviews in Langform habe ich bereits in meinem Buch „Finanzielle Freiheit“ veröffentlicht, allerdings wurden sie für dieses Buch zum Teil aktualisiert.
Читать дальше