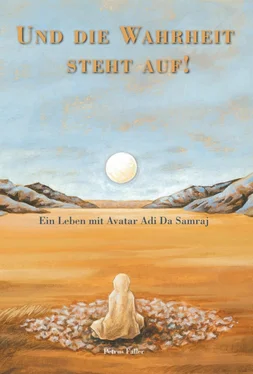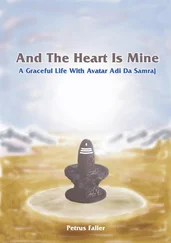Ich fuhr per Anhalter den Rest des Weges, kam in dem Wallfahrtsort an, wo in der Krypta unter dem Altarraum die drei heiligen Marien 3standen, die bei der Prozession im Mai reichlich geschmückt und verziert auf einem Schiff präsentiert wurden. Sehr unheilig und eher wie eine Schaufensterdekoration standen sie auf einem einfachen Tisch und ich konnte nicht widerstehen sie genau zu inspizieren. Ich lüpfte ihre Röcke, sah mir all die Rosenkränze an, die unzähligen Tafeln mit Danksagungen und alle möglichen anderen Dinge, die sich dort über Jahrzehnte angesammelt hatten, während in der Kirche oben für das Weihnachtsfest der Boden von fleißigen Frauen geputzt und gewienert wurde. Der Humor fand mich wieder und ich musste mich schwer zurückhalten, nicht irgendeinen dummen Scherz mit den Figuren anzustellen. Danach ging ich zum Strand. Die ganze Küste war komplett in Nebel eingehüllt, nicht einmal das Wasser war zu erkennen, nur die kleinen, ausdruckslosen Wellen, die nichtsagend das Ufer erreichten. Ich setze mich kopfschüttelnd und in spontaner Heiterkeit in den Sand und musste an Samuel Becketts „Glückliche Tage“ 4denken. Ein tiefes befreiendes Lachen stieg urplötzlich aus meiner Kehle hervor.
Hier passierte gar nichts mehr und wahrscheinlich war noch nie etwas sogenannt Heiliges oder Besonderes passiert. Der Ort war leer, gefüllt mit Glauben, wie ich selbst.
Ich ging ins nächste Cafe kaufte vier Croissants, bestieg den nächsten Bus und fuhr am Abend des vierundzwanzigsten Dezember mit dem Nachtzug über die Papststadt Avignon, die sich im Weihnachts-Shopping-Fieber befand, wieder nach hause.
Ich liebte meine Arbeit mit den schwerbehinderten Kindern. Verstand sie, auch wenn keines von ihnen sprechen oder sich artikulieren konnte. Die Sorgen und Ängste, die sie bei den meisten Betrachtern oder Weg-Schauern auslösten, konnte ich nicht nachvollziehen. Sie lebten in einer vollkommen anderen Welt, deren Glück oder Unglück nicht von uns beurteilt werden konnte. Die Arbeit mit den Kindern und meine Kolleginnen verschafften mir ein Minimum von Anbindung, während ich in meinem Haus vollständig die Kontrolle über mein Essverhalten verlor. Mein Altar und meine Wahrheit war jetzt die Kloschlüssel. Keiner wusste von meiner Bulimi und niemand ahnte etwas. Ich legte Fastenzeiten ein, fraß und kotzte dann wieder. Ort und Zeit spielten keine Rolle. Ich tat es überall. Das Ende meines zwanzig Monate dauernden Zivildienstes nahte. Ich hatte nie eine normale Berufskarriere angestrebt. Geld war mir so wichtig oder unwichtig, wie eine rote Fußgängerampel für einen echten Fahrradfahrer. Ich brauchte nicht viel zum Leben und hatte nie etwas vermisst.
Ich musste wieder los. Unterwegs sein. Weg. Weg von meiner Ess-Brechsucht. Weg aus dieser westlichen Kultur und dieser von Männern geprägten Welt.
What’s your name, what’s your country?
„Die Tiefe ist nicht in dir. Die Tiefe ist in Mir.“
Adi Da
Obwohl ich nie ein Buch über Indien gelesen hatte und mir auch seine Religionen noch fremd waren, zog es mich genau dort hin. Wer Yoga erfunden hatte, konnte nicht ganz und gar schlecht sein.
Als Vorbereitung kaufte ich vier Landkarten von dem gesamten indischen Subkontinent, ein Hindulexikon und nähte mir in einer langwierigen Prozedur das Outfit eines Troubadours. Ich schrieb mein Testament, in dem ich alles meinen Freunden vermachte und setzte mich ohne bestimmtes Ziel im Oktober 1987, kurz vor meinem dreiundzwanzigsten Geburtstag, ins Flugzeug, Ziel die Stadt Mumbay, welche damals noch Bombay hieß.
Bei der Landung auf dem Flughafen von Mumbay, der mitten in den Slums lag, erlebte ich meine erste unbegreifliche Ent-Täuschung. Noch nie hatte ich so viel Elend und Leid gesehen. So viel Kummer, zusammengedrängt auf einer scheinbar unendlichen Fläche. Die verarmten und verwahrlost aussehenden Kinder der Slums drückten sich die Nasen an den Fensterscheiben des Flughafengebäudes platt und Polizisten scheuchten sie mit groben Worten davon. Jeder der Mitreisenden riet mir, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen und ich folgte dem Rat und reiste noch am gleichen Tag mit dem Bus nach Goa weiter. Dort akklimatisierte ich mich in einer stillen paradiesischen Bucht, die noch unerschlossen vom Tourismus, mit einem Süßwassersee direkt hinter dem Strand, umgeben von riesigen Banyan-Bäumen vor sich hin träumte. Beim ersten Spaziergang an der Küste entlang lernte ich einen indischen Mann mit dem Namen Kali kennen, der ein Anhänger des gerade verstorbenen Meisters Babaji aus Haidakhan war. Er gab mir Tipps von heiligen Hindu-Pilgerorten, die ich in den nächsten Wochen alle aufsuchte und lud mich in den Ashram von Babaji im Himalaya ein. Nachts saß er oft betend am Feuer, sang zu Ehren seiner Göttin Kali, deren Namen er auch trug, und ließ die Flammen Tag und Nacht nicht ausgehen.
Während meiner weiteren Reise zu den hochgeschätzten Pilgerorten der Hindus schlief ich meist draußen oder in den Tempeln. Die Sadhus, denen ich begegnete, sahen meist bekümmert und krank aus, gezeichnet von ihrer harten Askese und nur wenige hatten glückliche Augen. Das Leid der Frauen und Kinder in den Dörfern war schrecklich und erbarmungslos. Die Unberührbaren schliefen überall, und überall sah man schwerst arbeitende Kinder und Frauen, die Straßen bauten oder ausbesserten. Die indische Gesellschaft war mir fremd. Wie konnte eine Religion so etwas zulassen? Gleichzeitig begegneten mir so viele lachende und glückliche Menschen, wie ich es noch nie vorher an irgendeinem Ort kennen gelernt hatte. Nach vier Wochen umherreisen strandete ich desillusioniert in Südindien in einem Naturschutzreservat. Quartier hatte ich bei einem Deutschen namens Klaus gefunden, der eine indische Frau geheiratet hatte und vom Pfefferanbau und den Touristen, die bei ihm logierten seinen Lebensunterhalt bestritt. Nach wie vor war mein täglicher Altar die Kloschlüssel – auch in Indien. Die Verzweiflung wuchs und wuchs, ich schrieb Seiten über Seiten in mein Tagebuch, aber ich führte das gleiche Leben wie in Deutschland. Es gab kein Entkommen. Ich suchte keinen Ashram, keinen Guru, ich wollte frei sein.
Eines Nachts saß ich im Vollmondlicht auf der Veranda, vor mir die drei Meter hohen Pfefferstauden. Wieder überkam mich das fast zwanghafte Verlangen diesem Leben ein Ende zu machen, verrückt zu werden oder den Körper zu verlassen. Ich hielt es einfach nicht mehr aus. Alles tat mir weh von dem täglichen Fressen und Kotzen, und mein Mund hatte sich durch den Verzehr von unreifen Papayas, die ich mir gierig einverleibt hatte, entzündet. Schreibend und flehend, die Mondgöttin inständig bittend, überstand ich wieder eine Nacht. Am nächsten Tag erzählte mir Klaus von Vipassana, einer buddhistischen Meditationstechnik, die er in einem Meditationszentrum in Igatpuri, einem Dorf in der Nähe von Mumbay kennen gelernt hatte. Da war auf einmal ein Ausweg. Ich packte noch am selben Abend meine Sachen zusammen und brach in aller Eile auf. Die Reise führte mich über 2000 km von Kerala, einem Bundesstaat im Süden von Indien, nach Igatpuri, einem kleinen Ort im indischen Staat Maharashta, ungefähr fünf Busstunden östlich von Mumbay gelegen. Ich war Tag und Nacht mit dem Bus unterwegs und sollte dank Unterstützung vieler freundlicher Menschen am Morgen vor Beginn des Meditationskurses dort ankommen. Der letzte Teil der Busfahrt führte durch eine sehr weite Ebene, die seitlich von großen felsigen Gebirgszügen begrenzt war. Die Himmel leuchtete klar und blau. Um mich herum saßen die indischen Menschen schlafend und eingehüllt in ihren Decken und Tücher, um sich vor der morgendlichen Kühle zu schützen, während der Bus über die marode Straße holperte. In einer kleinen Stadt, zwei Stunden von meinem Zielort entfernt, bestieg ein junger Mann den Bus. Gekleidet in dunkelrotes Tuch setzte er sich neben mich. Wir begannen ein Gespräch und er erzählte mir, dass er nach Ganeshpuri 5unterwegs sei zu dem Ashram seiner Meisterin, die er Gurumayi nannte. Ich verstand nur Bahnhof. Ganeshpuri schien ein Dorf zu sein, das erst einige Kilometer weiter nach Igatpuri angefahren wurde. Er packte einen Bildband aus und zeigt mir die farbigen Bilder der Gurumayi. Sie war ebenfalls ganz in rot gekleidet, sah sehr schön aus, erotisch und erhaben. Er bat mich, während der Dauer unserer Unterhaltung immer inständiger nach Ganeshpuri mitzukommen, um seine Meisterin zu sehen. Ich kapierte immer noch nicht, was er eigentlich von mir wollte und wies seine Bitten freundlich und bestimmt zurück. Als ich den Bus verließ begann der Mann zu weinen. Tränen rannen aus seinen Augen. Er schaute mir enttäuscht durch die Fensterscheiben nach, während der Bus hupend weiterfuhr.
Читать дальше